Weitere Sprachen
Weitere Optionen
Walter Ulbricht: Zeitzeugen erinnern sich | |
|---|---|
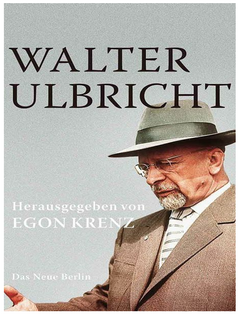 | |
| Autor*in | Egon Krenz |
| Verlag | Das Neue Berlin |
| Veröffentlicht | 2013 |
| ISBN | eBook 978-3-360-50043-4 Print 978-3-360-02160-1 |
Vorwort
Zum Ende ihrer Tage zählte die DDR 17 Millionen Einwohner. Deren Ansichten über das Land zwischen Saßnitz und Suhl sind äußerst vielfältig und widersprüchlich. Meist sachlich, differenziert und ideologiefrei. Auf jeden Fall anders als bei bestimmten Behörden, die beauftragt sind, die DDR als ein großes Gefängnis darzustellen, in dem das Führungspersonal nur darüber sinnierte, wie die Bürger drangsaliert werden können. Wie sie war, diese DDR, und wie jeder darin gelebt hat, können vor allem jene beurteilen, die hier zu Hause waren. Mein Standpunkt ist deshalb einer unter vielen. Ulbricht und seine Ansichten haben mein Leben beeinflusst und mich politisch stark geprägt. Der herrschende Zeitgeist sortiert Biografien jedoch nach politischen Interessen. Macht sich zum Richter über »richtiges« oder»falsches« Leben. Jubiläen werden benutzt, um genehme Personen zu glorifizieren und politisch Andersdenkende zu diffamieren. Die »Guten« kommen meist aus den Eliten der Bundesrepublik, die »Gescholtenen« fast immer aus der DDR. Zweierlei Maß für deutsche Biografien. Losgelöst von der Zeit, in der Menschen lebten und handelten. Ein irres Geschichtsbild, jenseits jeder Objektivität. Vor Jahrzehnten erschien in der DDR ein Bildband über Ulbricht. Damals die Abgrenzung der beiden deutschen Staaten war längst vollzogen – hatte das Buch einen für diese Zeit bemerkenswerten Titel: »Ein Leben für Deutschland«. Ulbricht und die deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert, dieses Thema reizt mich. Heute mehr denn je. Insofern musste ich nicht lange überlegen, als mich der Verlag bat, aus Anlass des 120. Geburtstages des ersten DDR-Staatsratsvorsitzenden am 30. Juni 2013 und seines Todes am 1. August 1973 mit Weggefährten zu sprechen, die ihn noch aus eigenem Erleben kennen. Besteht bei diesem Vorhaben nicht auch die Gefahr, ihn zu heroisieren? Diesen Gedanken schob ich von mir. Und selbst wenn: Solange man hierzulande mehr über Hitler, seine Generäle, seine Helfer, seine Frauen, seine Hunde, seinen Bunker erfährt als über die Kämpfer gegen den Faschismus, scheint mir eine gewisse Überhöhung sogar verständlich. Trotzdem: Unter den von mir befragten Zeitzeugen war keiner, der Ulbricht idealisierte. Spürbar wurde allerdings, dass in der Rückschau auf vierzig DDR Jahre und die nachfolgenden Jahrzehnte Ulbrichts Konturen wesentlich deutlicher sind als vielleicht noch zu seinen Lebzeiten. Der Volksmund sagt, erst wenn man das Dorf verließe, würde man erkennen, wie hoch der Kirchturm ist. Ähnlich ergeht es mitunter historischen Persönlichkeiten. Das Urteil der Nachwelt scheint jedenfalls sachlicher und gerechter. Ulbricht hat drei Viertel des 20. Jahrhunderts durchlebt. Mit Höhen und Tiefen, Siegen und Niederlagen, Irrungen und Wirrungen. Mit den Widersprüchen einer Epoche, die oft »Zeitalter der Extreme« genannt wird. Er stellte sich ihr als Kommunist. Kapitulierte nicht vor Schwierigkeiten, nicht vor seinen politischen Gegnern, nicht vor Verleumdungen. Wenn er irrte, war er fähig, sich zu korrigieren. Ich erwarte nicht, dass seine politischen Gegner ihn lobpreisen. Respekt aber vor dem Leben eines deutschen Antifaschisten mit kommunistischer Gesinnung würde sich angesichts seiner Biografie schon geziemen. Zwei Weltkriege griffen in Ulbrichts Leben ein. Den Ersten erlitt er als unfreiwilliger Soldat des Kaisers. Am Ende war er Mitglied eines Arbeiter und Soldatenrates. In seiner Heimatstadt Leipzig wurde er Mitbegründer der KPD. Den Zweiten bekämpfte er lange vor dem ersten Schuss. Schon als bürgerliche Politiker noch darauf setzten, die Nazis würden von allein abwirtschaften. Seine Partei hatte vorausgesagt: Wer Hitler wählt, wählt Krieg. Zwei Revolutionen prägten seinen politischen Werdegang: Die russische Oktober- und die deutsche Novemberrevolution. Lehren aus der Geschichte zu ziehen, war ihm immer wichtig. Es heißt, Historiker sei sein dritter Beruf gewesen. Aktiv war er an den fundamentalen Umwälzungen auf deutschem Boden beteiligt: Die Enteignung der Nazi- und Kriegsverbrecher, die Boden-, Schul und Justizreform, die Beseitigung des Bildungsprivilegs der Reichen, die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die politische Mitbestimmung der Jugend, ihre Rechte auf Arbeit, Bildung und Urlaub gehörten zum Programm der 1946 gegründeten SED. Ulbricht war an der Seite von Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl einer der Ideengeber und Organisatoren dieser revolutionären Umgestaltungen. Mit dem sozialistischen Aufbau, so die Hoffnung vieler Menschen, sollte die von Friedrich Engels aufgeworfene und von Ulbrichts Kampfgefährtin Rosa Luxemburg 1915 erneut gestellte Frage »Sozialismus oder Barbarei?«[Anmerkung 1] zugunsten der Menschlichkeit entschieden werden. Die bittere Niederlage von 1989/90 erlebte Ulbricht nicht mehr. Er hätte sie vermutlich auch als seine eigene empfunden. Geraten hätte er wahrscheinlich: Analysiert genau, was falsch gemacht wurde. Lernt aus den Fehlern. Lasst aber nicht miesmachen, was an Gutem und Einmaligem in der DDR erreicht wurde. Nur wer selbstbewusst verteidigt, was an den sozialistischen Werten verteidigungswürdig ist, wird als Zeitzeuge auch ernst genommen. Ulbricht war Patriot. Damit auch überzeugter Gegner einer Teilung Deutschlands. Das schreibe ich im Wissen um den Vorwurf seiner Gegner, er sei ein Spalter gewesen. Er wollte immer das ganze Deutschland. Nicht nur in einem halben sollte es antifaschistisch, demokratisch und sozial gerecht zugehen. Es entsprach seiner inneren Überzeugung, was sein Freund, der Dichter Johannes R. Becher, in die DDR-Nationalhymne schrieb: »Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland.« Die sowjetischen Deutschlandnoten von 1952, die den Weg für ein einheitliches Deutschland hätten freimachen können, fanden seine Zustimmung. Als der Westen das Angebot ignorierte, machte er sich für eine Konföderation beider deutscher Staaten stark. Er forderte »Deutsche an einen Tisch!« Nachdem sich diese Ideen nicht mehr realisieren ließen – sie waren mit den Vorstellungen der Führungsmächte in den beiden politischen und militärischen Bündnissen nicht kompatibel –, sah Ulbricht in der DDR den »sozialistischen Staat deutscher Nation«, der offen bleiben sollte für eine linke Option der deutschen Frage. Als die SPD ihre Neue Ostpolitik verkündete, mahnte Ulbricht in Richtung der östlichen Bündnispartner: Man dürfe den Stoß nicht gegen Kanzler Brandt richten, sondern gegen Strauß[Anmerkung 2] und von Thadden.[Anmerkung 3] Gemeinsam müsse man die westdeutsche Bevölkerung für eine Politik des demokratischen Fortschritts gewinnen. Moskau kritisierte diese Strategie als Illusion und ging auf Distanz zu ihm. Ulbricht sah sich nicht selten Widersachern in den eigenen Reihen gegenüber. Wo immer er »Fraktionen« zu erkennen meinte, kämpfte er für die Einheit seiner Partei. Als er Ende der 60er Jahre noch glaubte, seine Mitstreiter würden ihm folgen, isolierte er sich zunehmend im Politbüro. Er war alt geworden. National und international waren zudem Probleme entstanden, die ihn überforderten. Auch darum lässt sich der Wechsel an der Parteispitze 1971 nicht auf Honeckers Machtanspruch oder Moskaus Dominanz reduzieren. Das wäre eine Simplifizierung komplexer politischer Vorgänge. Es macht für mich keinen Sinn zu spekulieren, ob die DDR 1989/90 mit einem Politiker vom Format Ulbrichts sich hätte behaupten können. Als Marxist weiß ich um die starke Rolle von Persönlichkeiten in der Geschichte. Mir ist aber auch klar, dass das Ende der DDR nicht nur dem Versagen einzelner Personen zuzuschreiben ist. Vielmehr wirkte ein ganzes Ensemble von objektiven und subjektiven, von internationalen und nationalen Faktoren, die auch Walter Ulbricht nicht hätte ignorieren können. Nicht nur Marxisten, auch viele bürgerliche Historiker lehnen eine spekulative Beantwortung der Frage »Was wäre gewesen, wenn …« – als unwissenschaftlich ab. Ich kenne die antikommunistischen Vorurteile, die über Ulbricht existieren. Die Vokabeln sind die gleichen wie zu Hochzeiten des Kalten Krieges: »Statthalter Stalins in Ostberlin« oder »Verlängerter Arm des Kreml«, »Pankows erster Mann« oder der »Zonenchef«. Man amüsiert sich unverändert über seine Stimme und seinen sächsischen Akzent. Die Anfeindungen haben sich weder mit seinem noch dem Ende der DDR erledigt. Gern lasten Politiker und Medien allein der DDR das Unrecht, die Härten und Herzlosigkeiten des Kalten Krieges zwischen beiden Weltsystemen an. So, als hätte sie mit sich selbst Krieg geführt und die Bundesrepublik wäre aufrechter Friedensstifter gewesen. Üblicherweise gibt es bei Auseinandersetzungen immer zwei Seiten. Stets lautet die Abfolge Aktion und Reaktion. Keine Seite ist ausschließlich auf »gut« und keine nur auf »böse« abonniert. Keiner verlässt am Ende nur mit weißer Weste das Feld. Die Bundesrepublik Deutschland, ihre Institutionen und deren politisches Personal natürlich ausgenommen: Sie waren und sind stets ohne Fehl und Tadel. So jedenfalls ist die gängige Lesart des vom Deutschen Bundestag verordneten Geschichtsbildes über die DDR.[Anmerkung 4] Wenn es dieser Geschichtsinterpretation dient, wird die tatsächliche historische Rolle der DDR sogar überhöht. Aus dem kleineren deutschen Staat, von Adenauer abschätzig als »Soffjetzone« gescholten, wird nachträglich eine Übermacht konstruiert, die angeblich diktiert habe, was Moskau zu tun oder zu lassen habe. So soll Ulbricht Stalin zur Gründung der »ungeliebten DDR« sowie zum Aufbau des Sozialismus genötigt und Chruschtschow zum Mauerbau gezwungen haben. Die vermeintliche Ostberliner Vormundschaft wurde sogar gerichtsnotorisch. Das Bundesverfassungsgericht stellte wahrheitswidrig fest, der Einfluss der UdSSR auf die DDR-Grenzsicherung »sei eher gering gewesen«.[Anmerkung 5] 2003 ermittelte ein Fernsehsender mit Hilfe seiner Zuschauer den »größten Deutschen«. Konrad Adenauer soll es sein. Karl Marx belegte hinter Martin Luther den dritten Platz. Die Ostdeutschen hätten in ihrer Mehrheit, so hieß es, Marx sogar auf Platz 1 gesehen, was für deren realistisches Geschichtsverständnis spricht. Wenn Adenauer Spitzenreiter war, sollte man ruhig auch an eine Feststellung Sebastian Haffners aus dem Jahre 1966 erinnern. Der bürgerliche Publizist und Historiker ging der Frage nach, warum Ulbricht nach Bismarck und neben Adenauer zum erfolgreichsten deutschen Politiker wurde? Dass Adenauer und Ulbricht von kundigen Personen in einem Atemzug genannt wurden, halte ich für bemerkenswert. Allerdings: Sie waren nie politische Brüder. Antipoden waren sie. Erbitterte Widersacher. Jeder im Interesse seiner Klasse. Als Adenauer schon im Dienst des Deutschen Kaiserreiches stand, schloss sich der junge Sozialdemokrat Ulbricht dem politischen Credo von August Bebel und Wilhelm Liebknecht an: »Diesem System keinen Mann und keinen Groschen.« Als Adenauer nach dem Ersten Weltkrieg separatistische Gedanken über die Bildung eines westdeutschen Staates im Rheinland umtrieben, stellte sich Ulbricht auf die Seite von Karl Liebknecht, der am 9. November 1918 vom Balkon des Berliner Schlosses aus die sozialistische Republik proklamierte. Dieser Balkon wurde 1964 in das Staatsratsgebäude der DDR integriert, den Amtssitz des DDR-Staatsoberhauptes. Bei meinen Recherchen zu diesem Buch stieß ich auf einen Spitzelbericht eines Landesjägerkorps aus Leipzig vom 27. Mai 1919. Darin heißt es, dass »der Kommunist Ulbricht, Mitarbeiter der Roten Fahne, überwacht werden« müsse. Bei besonderen Feststellungen: »Sofort Meldung.«[Anmerkung 6] Ulbricht blieb über Jahrzehnte der »vaterlandslose Geselle«– wie Sozialisten, Sozialdemokraten und Kommunisten einst genannt wurden. Er wurde der Gehetzte, der Verfolgte, der Inhaftierte, der Geächtete und später außer Landes Getriebene. Zusammen mit Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck und anderen stritt er im Deutschen Reichstag für die sozialen Interessen der Arbeitenden und gegen die drohende faschistische Gefahr. Der öffentliche Disput des Berliner Kommunistenchefs Ulbricht mit dem Berliner Nazigauleiter Goebbels im Berliner Saalbau Friedrichshain bewies den Mut des gebürtigen Leipzigers im antifaschistischen Kampf. Als die Nazis im März 1933 den 81 Reichstagsabgeordneten der KPD, darunter Walter Ulbricht, das Mandat entzogen, erklärte in Köln Adenauers Zentrumsfraktion zu jenem Ermächtigungsgesetz: »Die vom Herrn Reichspräsidenten berufene, durch den erfolgreichen Verlauf der nationalen Revolution bestätigte Regierung darf nicht gefährdet werden, da sonst die Folgen unabsehbar sind. […] Wir begrüßen die Vernichtung des Kommunismus und die Bekämpfung des Marxismus.« Als Ulbricht schon von Hitlers Schergen steckbrieflich gesucht wurde, schrieb Adenauer am 10. August 1934 an den preußischen Innenminister einen zehnseitigen Brief. Darin reklamierte er für sich, die NSDAP »immer durchaus korrekt behandelt« zu haben. Er habe sich einer Anordnung des preußischen Staatsministeriums widersetzt, nationalsozialistische Beamte »zwecks Disziplinierung« namhaft zu machen, da er eine solche Maßregelung »für unberechtigt und für ungerecht hielt«. Er habe bereits 1932 erklärt, dass »eine so große Partei wie die NSDAP unbedingt führend in der Regierung vertreten sein müsse«. Auch wenn Adenauer später einige Male kurzzeitig interniert wurde und die Nazis ihn als Kölner Oberbürgermeister absetzten, Not litt er nicht. Ulbricht hingegen musste ins Exil und kämpfte um seine Existenz. Vor allem jedoch gegen die Nazidiktatur. An der Leningrader Blockade, der 1,1 Millionen Leningrader zum Opfer fielen, waren auch deutsche Offiziere beteiligt, die später in der Bundesrepublik Deutschland Spitzenämter bekleiden durften. Auch Ulbricht lag im Schützengraben. Vor Stalingrad und auf der Antikriegsseite. Unter Einsatz seines Lebens trug er dazu bei, das Leben deutscher Soldaten zu retten. Gemeinsam mit den Dichtern Erich Weinert und Willi Bredel rief er über Lautsprecher: »Ob ihr fallt oder durch Kapitulation euer Leben rettet, das ändert nichts mehr am Ausgang des Krieges. Euer Tod zerstört nur eure Familie und die Zukunft eurer Kinder. Unser Volk braucht nicht euren sinnlosen Tod, sondern euer Leben für die Arbeit im künftigen Deutschland!«[Anmerkung 7] Ulbricht gehörte zu jenen Deutschen, die mit ihrem Tun bewiesen, dass man nicht zwangsläufig mit den Nazis marschieren oder ihre Verbrechen billigend in Kauf nehmen musste. Gewiss, Mut gehörte dazu. Ulbricht hatte ihn. Aus der sowjetischen Emigration kehrte er mit einer Gruppe deutscher Kommunisten am 30. April 1945 zurück. Die Schlacht um die deutsche Hauptstadt tobte noch. Ihm war wichtig, dass das Leben im verwüsteten Berlin so schnell wie möglich wieder in Gang kam. Dazu suchte er vorurteilsfrei Kontakt zu Persönlichkeiten auch aus dem bürgerlichen Lager, etwa zu dem Schauspieler Heinz Rühmann oder dem Mediziner Ferdinand Sauerbruch. Erster Oberbürgermeister von Berlin wurde der Parteilose Arthur Werner. In einem Aufruf der KPD an das deutsche Volk, der mit Stalin abgestimmt war, wurden vier Wochen nach dem Ende der Nazidiktatur und des Krieges Ziele für ganz Deutschland gesetzt. Die Spaltung des Landes war darin nicht vorgesehen. Die Kommunisten wollten mit allen den »Weg der Aufrichtung eines antifaschistischen, demokratischen Regimes, einer parlamentarischen Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk«, beschreiten. Mit Moskau waren sie sich einig, dass es falsch wäre, »Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen«.[Anmerkung 8] Ulbricht und seine Genossen setzten sich für eine konsequente Bestrafung der Nazi- und Kriegsverbrecher ein. Den Mitläufern des Systems gaben sie eine Chance zum Neubeginn. Undenkbar jedoch, dass Leute wie Globke, Filbinger und viele andere belastete Nazis in der DDR ein Amt hätten bekleiden dürfen. Der Mitautor und Kommentator der Nürnberger Rassengesetze, Globke, wurde in der DDR zu lebenslanger Haft verurteilt, während er in der Bundesrepublik der mächtigste Mann hinter Adenauer wurde. Die ablehnende Haltung der Westmächte, besonders der Bundesrepublik, gegenüber den sowjetischen Deutschlandnoten von 1952 verbaute für Jahrzehnte den Weg zur deutschen Einheit. Der Rheinische Merkur zitierte am 20. Juli 1952 Adenauer mit der erhellenden Aussage: »Was östlich von Werra und Elbe liegt, sind Deutschlands unerlöste Provinzen. Daher heißt die Aufgabe nicht Wiedervereinigung, sondern Befreiung. Das Wort Wiedervereinigung soll endlich verschwinden. Es hat schon zu viel Unheil gebracht. Befreiung sei die Parole.« In der Folge wurde der Kalte Krieg de facto zum Dritten Weltkrieg. Ein Kalter zwar, aber immer am Rande eines möglichen Atomkrieges. Walter Ulbricht kam das Verdienst zu, in äußerst komplizierter Zeit starke Nerven bewiesen zu haben. 1968 erreichte er, dass sich die Nationale Volksarmee der DDR nicht an den militärischen Maßnahmen der Warschauer Vertragsstaaten in der Tschechoslowakei beteiligte. Die Nationale Volksarmee der DDR bleibt bisher die einzige deutsche Armee, die weder Kriege führte noch an Militäraktionen gegen andere Völker teilnahm. Dass die DDR von ihren Gegnern gemeinhin eine Diktatur genannt wird, sei ihnen nachgesehen. Sie wollen nicht wahrhaben, dass jeder Staat ein Machtinstrument der jeweils herrschenden Klasse ist. In der Verfassung von 1968, die unter Ulbrichts Vorsitz ausgearbeitet wurde, ist das so formuliert: »Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat der Arbeiter und Bauern.« Unverschämt jedoch ist, die DDR als »zweite deutsche Diktatur« zu bezeichnen, womit sie in eine Reihe mit der Nazidiktatur gestellt wird. Das verharmlost nicht nur den Faschismus. Es beleidigt jene Menschen, die sich aus antifaschistischer Gesinnung für die DDR entschieden. Es ist zugleich Verfälschung historischer Tatsachen. Von den 300.000 Parteimitgliedern, die die KPD 1933 hatte, wurden von den Nazis 150.000 verfolgt, eingekerkert oder ermordet. Ein bitteres Zeugnis des opferreichen Kampfes der KPD gegen Faschismus und Krieg, der im heutigen Deutschland kaum gewürdigt wird. Seit es die DDR nicht mehr gibt, wiederholen Politiker und Medien gebetsmühlenartig ein unvollständiges Zitat Ulbrichts von einer Pressekonferenz am 15. Juni 1961. »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten«, geht der halbe Satz. Ulbricht fügte aber an: »Wir sind für vertragliche Beziehungen zwischen Westberlin und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik.« Dass er eine vertragliche Lösung favorisierte, wird absichtlich verschwiegen. Schließlich soll mit der Zitatenverstümmelung nachgewiesen werden, dass Ulbricht ein Lügner war. Die politische Logik wird völlig ausgeblendet: Wenn der Stratege Ulbricht zwei Monate vor dem 13. August 1961 eine »Mauer« geplant oder bereits deren Bau beschlossen hätte, wäre er wohl nicht so töricht gewesen, dies auf einer internationalen Pressekonferenz auch noch zu bestreiten. So etwas widersprach seinem Charakter. In jener Zeit gingen Moskau und Berlin noch von einem Friedensvertrag aus, den Chruschtschow anderthalb Wochen zuvor bei seinem Gipfeltreffen mit Kennedy in Wien mit der DDR abzuschließen angekündigt hatte – für den Fall, dass keiner mit »Gesamtdeutschland« zustande käme. Die Auseinandersetzungen zwischen den USA und der UdSSR spitzten sich in der Folgezeit dramatisch zu. Die Achillesferse war die offene Grenze zwischen NATO und Warschauer Vertrag in Berlin. Es ging um die Lebensfrage: Krieg oder Frieden.[1] Die Staats- und Parteichefs der Warschauer Vertragsstaaten beschlossen erst auf ihrer Zusammenkunft vom 3. bis 5. August 1961 in Moskau jene Maßnahmen, die dann am 13. August 1961 verwirklicht wurden. Gern wird Ulbricht mit Etiketten versehen. Für die einen ist er ein Dogmatiker, für die anderen ein Reformer. Beides wird ihm nicht wirklich gerecht. Zweifellos war auch er nicht frei von dogmatischen Ansichten, die es unter Stalins Einfluss in der kommunistischen Weltbewegung gab. Das hat auch in der DDR zu Fehleinschätzungen und falschen Entscheidungen beigetragen. Doch er war ein schöpferischer Mensch. Stellte stets die Frage, was besser zu machen sei. So kam in den 60er Jahren ein umfassendes sozialistisches Reformprogramm zustande. Vom Jugendkommuniqué bis zu grundlegenden Staats- und Rechtsfragen. Ob die DDR damit besser vorangekommen wäre, lässt sich nachträglich insofern schwer beurteilen, weil beispielsweise wichtige Dinge, wie das Neue Ökonomische System der Leitung und Planung, praktisch nicht richtig in Gang kamen. Ulbricht war ein überzeugter Freund der Sowjetunion. Gerade wegen seiner internationalistischen Haltung setzte er sich für die nationalen Interessen der Deutschen ein. Ob bei Stalin, Chruschtschow oder Breshnew – er war kein Speichellecker. Er sprach auch heikle Themen an. Er war ihnen kein bequemer, immer aber ein aufrichtiger Partner. Nachdem Gorbatschow, seine Neben und Hintermänner fast 20 Jahre nach Ulbrichts Tod die UdSSR von oben zerstört und zuvor die DDR auf dem Silbertablett an Helmut Kohl übergeben hatten, bewegte viele die Frage (und sie tut es noch): War unser großer Bruder immer ehrlich zu uns? Wie souverän war die DDR eigentlich? Ich trenne beide Fragen nicht vom 8. Mai 1945. Auch nicht von der Last, die die Sowjetunion weltweit für die Erhaltung des Friedens trug. Die DDR war gegenüber der UdSSR nicht mehr und nicht weniger souverän als die Bundesrepublik gegenüber ihren Besatzungsmächten auch. Beide waren Mitglied des jeweiligen Militärbündnisses. Mir ist in Erinnerung, wie Leonid Breshnew im Juli 1970 Erich Honecker mahnte: »Die DDR ist das Ergebnis des Zweiten Weltkrieges, unsere Errungenschaft, die mit dem Blut des Sowjetvolkes erzielt wurde. […] Wir haben doch Truppen bei euch. Erich, ich sage dir offen, vergiss das nie: Die DDR kann ohne uns, ohne die Sowjetunion, ihre Macht und Stärke nicht existieren. Ohne uns gibt es keine DDR.«[Anmerkung 9] Niemand aus der DDR-Führung stellte diesen Grundsatz jemals infrage. Er gehörte zu unseren politischen Lebensregeln. Er wurde auf schicksalhafte Art und in diametral gegensätzlicher Bedeutung sogar von Gorbatschow bestätigt. Als nämlich die Stärke und die Macht der Sowjetunion verspielt waren, traf dies auch ihren kleinen Bruder, die DDR. Sie bezahlte es mit ihrem Untergang. Das darf aber kein Grund sein, zu vergessen, was die Völker der Sowjetunion für den gesellschaftlichen Fortschritt geleistet haben. Es gäbe heute keine einigermaßen normalen Beziehungen zwischen Deutschen und Russen, wenn die UdSSR und die DDR dafür nicht den Grundstein gelegt hätten. Ich wünsche mir in der heutigen Bundesrepublik mehr Respekt gegenüber Russland, seinen Menschen und vor allem den Millionen Opfern deutscher Grausamkeit im Zweiten Weltkrieg. Zu den Defiziten des gewesenen Sozialismus gehörte, dass es keine festen Regeln für die Ablösung des ersten Mannes in Partei und Staat gab. Das wirkte sich negativ aus, als Ulbricht ein Alter erreicht hatte, das einen Rückzug aus der aktuellen Politik nahegelegt hätte. Als er seinen Rücktritt Ende der 60er Jahre anbot, riet Breshnew ab. Gomulka in Polen säße nicht mehr fest im Sattel und Husák in der CSSR noch nicht sicher genug. In dieser politischen Situation, so Breshnew, sei ein Rückzug Ulbrichts ein falsches politisches Signal. Ulbricht zeigte Disziplin und blieb. Allerdings wurde er zunehmend eigensinniger. In Moskau war man darüber besorgt wie auch über Meinungsverschiedenheiten im SED Politbüro bezüglich der Konzeption Ulbrichts zur Unterstützung der Ostpolitik der SPD. Am 28. Juli 1970 sprachen Breshnew und Honecker miteinander über Ulbricht und hinter dessen Rücken. Der KPdSU Generalsekretär beklagte eine »gewisse Überheblichkeit« gegenüber der Sowjetunion. Ihm missfiel, dass Ulbricht angeblich so tue, als habe die DDR das »beste Modell des Sozialismus«. Er tadelte auch Ulbrichts Absicht, der Brandt-Regierung entgegenzukommen. Breshnew meinte, vor Illusionen über Brandt warnen zu müssen. Es dürfe zu »keinem Prozess der Annäherung zwischen der BRD und der DDR kommen«. Einen solchen Prozess würden nämlich Brandt und Strauß wollen. In dieser Beziehung gebe es zwischen beiden keinen Unterschied. Westdeutschland, so Breshnew, sei im Verhältnis zur DDR wie jeder andere Staat Ausland. Über Ulbricht sagte der KPdSU-Chef: Er habe seine Verdienste, man könne ihn nicht einfach zur Seite schieben. Aber er sei alt. Selbst der Gegner würde damit rechnen, dass Honecker die Partei leite und »Walter als Vorsitzender des Staatsrates wirkt«. Damit wurde der Prozess eingeleitet, der Anfang Mai 1971 schließlich dazu führte, dass Ulbricht die Funktion als Erster Sekretär des ZK der SED verlor. Zur Vorbereitung dieses Buches traf ich mich mit noch lebenden Weggefährten Ulbrichts. Viele von ihnen kamen nach dem Krieg aus der Gefangenschaft. Ihnen war bis 1945 nicht vergönnt, eine hohe Schule zu besuchen. Das Bildungsprivileg der bis dahin Herrschenden hatte sie davon ausgeschlossen. Ulbricht und seine Genossen brachen mit dieser Tradition. Sie schufen die Arbeiter-und-Bauern Fakultäten. Hermann Kant hat in seinem DDR-Bestseller »Die Aula« das Schicksal dieser Generation eindrucksvoll geschildert. Aus den untersten sozialen Schichten der Gesellschaft wuchs ein großer Teil der DDR-Intelligenz heran. 1989 arbeiteten viele aus dieser Generation an den Schaltstellen von Politik und Wirtschaft, Bildung und Technik, Kultur und Sport, im Gesundheits- und Sozialwesen. Diese einmalige kulturpolitische Leistung der DDR wurde 1990 durch die Bundesrepublik Deutschland aus politischen Gründen zerstört. In diesem Buch kommen siebzig Weggefährten Ulbrichts zu Wort. Die Begegnungen mit ihnen, von denen manche zehn, fünfzehn oder gar fast zwanzig Jahre älter sind als ich, gingen mir sehr nahe. Manche sind seit Jahren bettlägerig. Aber ungebrochen. Ihre Lebensbedingungen sind bescheiden. Ihre Strafrente reicht oft nicht, um den Platz im Pflege- oder Seniorenheim zu bezahlen. Sie denken viel nach über sich, die DDR und unsere Niederlage, bewerten ihr eigenes Tun differenziert, sind aber vor allem sich und der Sache, die sie vertreten haben, treu geblieben. Ich höre schon den Einwand: Alles subjektiv! Ja, wie das eben mit Erinnerungen so ist. Sichtweisen können verschieden sein. Fakten sollten aber Fakten bleiben. Manche Erinnerungen verblassen. Manche erhalten nachträglich ein stärkeres Gewicht. Andere werden erst aus heutiger Sicht wieder lebendig. Darf man sie deshalb denunzieren? Sie gehören genau wie die Akteure der alten Bundesrepublik in das Geschichtsbuch der Deutschen. Von Konrad Adenauer ist eine bemerkenswerte Einsicht überliefert: »Die Errichtung eines neuen Regierungssystems darf […] in keinem Teil Deutschlands zu einer politischen Verfolgung der Anhänger des alten Systems führen. Aus diesem Grunde sollte nach Auffassung der Bundesregierung dafür Sorge getragen werden, dass nach der Wiedervereinigung Deutschlands niemand wegen seiner politischen Gesinnung oder nur, weil er in Behörden oder politischen Organisationen eines Teils Deutschlands tätig gewesen ist, verfolgt wird.«[Anmerkung 10] Das passt so gar nicht zu dem, was heutzutage immer wieder zu hören ist: »Wer in der DDR mitmachte, muss sich Fragen gefallen lassen.« Warum eigentlich nur, wer in der DDR mitmachte? Es wird höchste Zeit, dass alle Deutschen die tatsächliche und nicht nur die geschönte Geschichte auch der alten Bundesrepublik kennenlernen. Ich bin Herausgeber dieses Buches, nicht Autor der nachfolgenden Beiträge. Die Auskünfte der Verfasser und meiner Interviewpartner sind die ihren. Nicht jede Darstellung entspricht meinen Intentionen. Einiges ist mir anders erinnerlich, was aber durchaus nicht bedeuten muss, dass sich der andere täuscht. In den originären Erinnerungen vieler und in ihrer Mannigfaltigkeit liegt für mich der Wert dieses Buches. Aus vielen einzelnen Elementen entsteht ein lebendiges Bild einer historischen Persönlichkeit. So vielfältig die Sichten im Einzelnen auch sein mögen, in einem Punkt treffen sich alle: Walter Ulbricht war ein anerkannter Arbeiterführer. Ein weitsichtiger Politiker. Ein Arbeiter, der zum Staatsmann von Format wurde. Mögen die Zeitzeugen und Zeugnisse dieses Bandes dazu beitragen, den Dialog über die Nachkrieggeschichte beider deutscher Staaten zu befördern. So wie sie war und nicht, wie bestimmte Leute sie gern gehabt hätten.
Egon Krenz, Dierhagen im Mai 2013
Herbert Graf: Zwanzig Jahre an Ulbrichts Seite
Herbert Graf, Jahrgang 1930, Mitglied des antifaschistischen Jugendausschusses in Egeln 1945, Lehre und Geselle im Fleischerhandwerk. Besuch der Landesjugendschule der FDJ, Studium an der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät in Halle. Von 1950 bis 1954 Studium der Volkswirtschaftslehre in Berlin. Seit 1954 Mitarbeiter Walter Ulbrichts, zunächst in der Regierung, von 1961 bis 1973 im Staatsrat der DDR. 1969 juristische Promotion. 1978 Berufung zum ordentlichen Professor für Staatsrecht. Lehr-, Forschungs- und Beratertätigkeit in Entwicklungsländern Afrikas, Asiens und in Lateinamerika. Von 1990 bis 2000 Justiziar in Berliner Kabelbetrieben. Seit 2000 im Ruhestand. Du hast 20 Jahre an der Seite Walter Ulbrichts gearbeitet. Wann bist du ihm das erste Mal begegnet? Im September 1948 auf einer Landesjugendkonferenz der FDJ im Volkspark in Halle. Delegierte aus allen Kreisen tauschten Erfahrungen in der Jugendarbeit aus und berieten über künftige Projekte. Der damals 55-jährige Ulbricht nahm aktiv an den Beratungen teil. Er belebte und vertiefte die Debatte durch Zwischenfragen und ermunterte uns, Überlegungen, Probleme und Schwierigkeiten unverblümt vorzutragen. Es war heiß an jenem Spätsommerwochenende und der Saal überfüllt. Wie wir hatte auch er sein Jackett ausgezogen und die Hemdsärmel aufgekrempelt. Wir spürten, dass er sich wohlfühlte. Auch in den Beratungspausen suchte er das Gespräch mit uns jungen Leuten. Hartnäckig fragte er immer wieder nach. Er konnte aber auch geduldig zuhören. Schon wenige Jahre später unmittelbar nach deinem Hochschulstudium – wurde Ulbricht dein Chef. Erinnerst du dich an das erste Gespräch mit ihm? Das erste Gespräch fand 1955 im Amtssitz des Ministerrates der DDR statt, das war damals das Gebäude des ehemaligen Preußischen Landtages. Otto Gotsche, Leiter des Sekretariats, stellte mich dem Chef mit der lakonischen Bemerkung vor: »Das ist der Genosse Herbert Graf, über den wir gesprochen haben.« Beim Händedruck fielen mir Ulbrichts große, ausgearbeitete Hände auf. Die Begrüßung war freundlich. Für mich unerwartet erkundigte er sich, ob wir an der Hochschule für Ökonomie auch Lenins Schrift »Lieber weniger, aber besser« gründlich studiert und ausgewertet hätten. »Gelesen ja«, antwortete ich, »aber nicht durchgearbeitet«. Meine Bemerkung, dass 1953 und auch 1954 Stalins Schrift »Ökonomische Probleme des Sozialismus« im Zentrum der ökonomischen Vorlesungen und Seminare gestanden habe, quittierte er mit einem Lächeln und der Bemerkung, dass ich dann ja noch eine ganze Menge dazulernen müsse. Ich solle mich in meiner Arbeit hier immer von Lenins Prinzip leiten lassen: »Kein Wort auf Treu und Glauben hinnehmen, kein Wort gegen das Gewissen sagen, nie scheuen, jede Schwierigkeit einzugestehen, und vor keinem Kampf zur Erreichung eines ernsthaft gesteckten Zieles zurückschrecken.«[2] Nach dieser lehrreichen Begrüßung kam er gleich auf die nächste Arbeit zu sprechen. Es ging um Beiträge zur Vorbereitung eines Referates, das er zur Eröffnung der ersten Baukonferenz der DDR im April 1955 halten wollte. Du hast deine Erinnerungen an Walter Ulbricht veröffentlicht.[3] Nicht nur Historiker streiten über den Menschen und den Politiker Ulbricht. Deren Urteile sind mitunter recht widersprüchlich. Welche Erklärung hast du dafür? Wie wohl für alle starken Persönlichkeiten gilt auch für Walter Ulbricht das Schillerwort: »Von der Parteien Gunst und Hass verwirrt, schwankt sein Charakterbild in der Geschichte.« Diejenigen, die sich im 20. Jahrhundert für eine ausbeutungsfreie, gerechte und friedliebende Gesellschaftsordnung einsetzten, urteilen über das Wirken von Walter Ulbricht grundlegend anders als die Vertreter der kapitalistischen Welt. Den prokapitalistischen Kräften passte der politische Kurs im Osten Deutschlands seit 1945 nicht. Sie waren gegen die antifaschistisch-demokratischen Reformen, gegen die Verwirklichung der Beschlüsse der Potsdamer Konferenz in Wirtschaft, Verwaltung, Volksbildung und Justiz und darum auf eine Teilung Deutschlands aus. Wie schon in der Weimarer Republik behandelten die bürgerlichen Politiker im Westen deutsche Kommunisten – besonders deren Repräsentanten – als Feinde, die es auszuschalten galt. Es gab nicht nur den Klassenfeind … Innerparteiliche Kritiker Ulbrichts hatten im Wesentlichen drei Gründe. Erstes gab es »hausgemachte« Fehler, Missverständnisse und Kommunikationsprobleme, die zur Kritik an der Arbeitsweise von Walter Ulbricht führten. Dazu gab es interne und auch öffentliche Auseinandersetzungen mit ihm. Ging es um grundsätzliche Fragen, wurden sie in den Gremien erörtert und erforderlichenfalls nach dem Mehrheitsprinzip entschieden. Zweitens ist zu bedenken: Im ersten Nachkriegsjahrzehnt wurde entsprechend internationaler Festlegungen – »die oberste politische Macht« durch »die Oberkommandierenden der Streitkräfte in seiner Besatzungszone nach den Weisungen seiner entsprechenden Regierung«[4] ausgeübt. Es wurde nicht zu Markte getragen, dass deren Anordnungen zu innenpolitischen Angelegenheiten (z. B. die Erhöhung von Normen, Preisen und Steuern 1952/53) kritische Reaktionen der Öffentlichkeit gegenüber Repräsentanten der DDR hervorriefen, obwohl sie nicht von diesen, sondern von der sowjetischen Militäradministration (SMAD) verfügt waren. Drittens ist (wie u. a. der Briefwechsel zwischen Rudolf Herrnstadt und dem sowjetischen Hohen Kommissar Wladimir S. Semjonow erkennen lässt)[5] bei manch grundsätzlichem Disput – vor allen in den 50er Jahren – zu berücksichtigen, dass sowjetische Politiker Einfluss auf innerparteiliche Auseinandersetzungen in der SED nahmen und wie dies geschah. Die unterschiedliche Interessenlage und das Geschichtsverständnis nicht weniger Kritiker der Politik Ulbrichts führen zu sehr unterschiedliche Urteilen. Am Beginn der 70er Jahre wurde ihm Zurückhaltung gegenüber Moskauer Orientierungen vorgehalten. Die Verlagerung von Entscheidungen aus Parteigremien in den Staatsrat kreidete man ihm als Abweichung vom sowjetischen Sozialismusmodell an.[6] Dem gegenüber stehen die Verdikte, die Ulbricht als angeblich hörigen Vollstrecker sowjetischer Politik und als Stalinisten bezeichnen. Festzustellen ist auch, dass die gleichen Historiker, die ihn in früheren Publikationen des Dogmatismus bezichtigten, nunmehr vor allem seine Politik in den 60er Jahren als unorthodox und erfolgreich bewerten.[7] In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die Öffnung wichtiger Archive etwas Licht in bislang verborgene Hintergründe der Nachkriegspolitik gebracht. Das hat auch zu Objektivierung und Revidierung manch kritischer Urteile über Denken und Handeln von Walter Ulbricht beigetragen. Es hat sich– wenn auch nicht bei allen politischen Kräften – ein merklich gerechteres Urteil über sein Schaffen und seine Verdienste beim Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung herausgebildet. Der bekannte konservative Historiker und Publizist Sebastian Haffner bezeichnete schon 1966 Ulbricht als erfolgreichsten deutschen Politiker nach Bismarck und neben Adenauer. Worauf gründete er dieses Urteil? Haffner hat auch geschrieben: »Man wird noch sehr lange an Ulbrichts Erfolgsgeheimnis herumrätseln, und ganz enträtseln wird man es wahrscheinlich nie.«[8] Nach meiner Erfahrung gründet Ulbrichts Lebensleistung auf sein Verhältnis zu den Wurzeln der deutschen Arbeiterbewegung und deren Ideale. Sie fußt auf dem Reichtum seiner nationalen und internationalen Erfahrungen und in seinen starken Charaktereigenschaften. Unermüdlicher Fleiß, Sachlichkeit, ein ausgeprägtes Organisationsvermögen und strategisches Denken sowie taktische Beweglichkeit werden ihm selbst von bürgerlichen Biografen bescheinigt. Erfolge und Niederlagen im Kampf der deutschen Arbeiterklasse, die Ulbricht im Laufe seines sechs Jahrzehnte umfassenden politischen Wirkens erlebte, haben ihn zu einer starken Persönlichkeit mit klaren Konturen werden lassen. Der Schriftsteller Gerhard Zwerenz, der in nicht wenigen Fragen Ulbrichts Politik kritisch bewertete, schrieb einmal: »Walter Ulbricht stellt in seiner Person und als Exponent seiner Partei die Kontinuität der deutschen revolutionären Tradition dar; und indem er einen Staat schuf, vereitelte er alle westdeutschen Bestrebungen, die Tradition der Linken in Deutschland zu eliminieren.«[9] Erinnert sei in diesem Zusammenhang an Ulbrichts signifikanten Beitrag in der Illegalität, im Exil und an der Stalingrader Front beim Kampf gegen den deutschen Faschismus. Sein politisches Vermögen und sein Organisationstalent erwiesen sich bei der Überwindung der Kriegsfolgen im zerstörten Berlin. Zwei Wochen nach Ankunft der Gruppe Ulbricht waren in den meisten Berliner Bezirken arbeitsfähige Verwaltungen gebildet, fuhren die ersten Omnibusse auf von Trümmern beräumten Straßen, rollte die U-Bahn auf einigen Abschnitten wieder und fand das erste Konzert in der Oper statt. Schon in dieser rauen Anfangszeit orientierte Ulbricht auf die Gewinnung von Menschen aus allen gesellschaftlichen Kreisen und Schichten. »Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben.« So beschreibt Wolfgang Leonhard die Arbeitsweise Ulbrichts in den ersten Nachkriegswochen. Ja. Noch flimmert dieser Satz immer wieder – von Leonhard in seiner theatralischen Diktion zelebriert – wie ein Gottesurteil über die bundesdeutschen Fernsehschirme. Dies, obwohl Leonhard vor Jahren in einer Schrift eingeräumt hat: »Ulbricht ging es an diesem Abend (an dem der von Leonhard verbreitete Satz gefallen sein soll – H. G.) darum, die Diskussion zu beenden. Wir sollten die Leute für unsere Arbeit gewinnen, möglichst viele und aus möglichst unterschiedlichen politischen Lagern. Wichtig war ihm, dass wir darüber unseren Einfluss nicht verloren.«[10] Das klingt schon anders als die nach wie vor verbreitete alte denunziatorische Formel Leonhards. Walter Ulbricht gehörte nicht zu den Sprücheklopfern, die ihre Positionen auf einen Satz reduzieren. Sein Anliegen war es, eine ausbeutungsfreie, sozialistische Gesellschaft unter den speziellen Bedingungen der deutschen Nachkriegssituation zu errichten. Im Rahmen seiner Handlungsspielräume suchte er unter den Bedingungen des Kalten Krieges erfolgreich nach geeigneten Lösungen für den sozialistischen Fortschritt an der Nahtstelle der Systeme in Europa. Besonderes Augenmerk richtete er dabei auf eine organische Verbindung der Erfordernisse der wissenschaftlich technischen Revolution (und deren Möglichkeiten) mit der demokratischen Entwicklung des politischen Systems des Sozialismus in der DDR. Als Ulbricht 1971 als Erster Sekretär des Zentralkomitees der SED zurücktrat, standen seine Partei und der Staat auf soliden Fundamenten, der Staatshaushalt war ausgeglichen und die Höhe der Auslandsverbindlichkeiten des Landes war – im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, das bei uns Nationaleinkommen hieß – minimal. Sprechen wir darüber, wie du ihn in der Arbeit erlebt hast. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Walter Ulbricht war ein Vollblutpolitiker mit starker Urteilskraft. Seine politische Überzeugung und seine in Jahrzehnten gesammelten Erfahrungen verbanden sich mit einem sicheren Gespür für taktisch notwendige Schritte. Beliebigkeit war ihm fremd. Er vermochte es, in großen Dimensionen, also strategisch, zu denken und dabei zugleich – vor allem im ökonomischen Bereich – Details nicht außer Acht zu lassen. Die Zahlungsbilanz der DDR und die Hauptkennziffern der volkswirtschaftlichen Entwicklung waren ihm zu jeder Zeit bewusst. Ulbricht gehörte nicht zur Zunft der sogenannten Silberzungen, zu jenen charismatischen Verführern, die allein durch die Ausstrahlung und mit ihrer Rhetorik Einfluss auf andere nehmen. Sein rhetorisches Talent hielt sich in Grenzen. Er überzeugte durch sein strategisches Vermögen, durch seine soziale Kompetenz, durch seine emotionale Intelligenz, durch seine historischen Kenntnisse und die ausgeprägte Fähigkeit, unter komplizierten Bedingungen den Handlungsspielraum auszuloten. Mit Ulbrichts Rhetorik, so erfuhr ich im Gespräch mit Manfred Wekwerth, hatte etwa Brecht überhaupt keine Probleme. Im Gegenteil. Er meinte, dadurch sei der Redner gezwungen, sich stärker auf die Inhalte zu konzentrieren – und seine Zuhörer sollten dies auch tun, ermahnte Brecht seine jungen Mitarbeiter. Brecht hatte offensichtlich besser als manch anderer erkannt, dass Ulbricht eine ausgeprägte Lust verspürte, Neues zu suchen und für den gesellschaftlichen Fortschritt zu verwerten, wobei er dabei nicht so tat, als habe er den Stein der Weisen gefunden. Im Urteil über die eigene Leistung blieb er bescheiden und zurückhaltend. Doch zugegeben: Sein ausgeprägtes und durch manch bittere Erfahrung geformtes Selbstbewusstsein, auch die Fülle und Brisanz der zu lösenden Aufgaben, reduzierten den Raum für Selbstzweifel. Sagen wir es so: In schwierigen Zeiten erwies sich Walter Ulbricht als ein Mann, der Stürmen zu trotzen vermochte. Laues war ihm suspekt. Die Umstände seines Werdens, die langjährige Gefährdung seines Lebens und seiner Freiheit, die Anklagen im kapitalistischen Deutschland, die Bedingungen der Illegalität in der Zeit des Faschismus, die Emigration und nicht zuletzt das Erleben der Willkür und der Verbrechen Stalins hatten Walter Ulbricht zu einem erfahrenen, unerschrockenen und mutigen Politiker werden lassen. All diese Erfahrungen hinterließen Spuren. Aber sie führten zu keinem Realitätsverlust. So wie ich ihn aus der Nähe erlebte, besaß er sowohl prinzipientreues, taktisches Vermögen als auch Augenmaß für Handlungsspielräume bei den Mächtigen. In allen Phasen seines politischen Wirkens lautete seine Maxime: Alles mit dem Volk, alles für das Volk. Die Losung: »Plane mit, arbeite mit, regiere mit!« entsprach seinem Verständnis von Demokratie. Ein Mann ohne Fehl und Tadel? Ulbricht war kein unfehlbarer Heiliger. Auch er war nicht frei von Irrtümern und machte Fehler, Enttäuschungen blieben ihm nicht erspart. Allgemeinen Fehlerdiskussionen war er nicht zugeneigt. Führte diese Abneigung nicht letztlich dazu, dass Fehlentwicklungen nicht beizeiten gestoppt wurden und Kritikwürdiges unter den Teppich gelangte? Das ist nicht auszuschließen. Darüber wurde übrigens auch im Zentralkomitee der SED diskutiert. In der Debatte zitierte ein Genosse den Vers: »Du sollst nicht verschwätzen die köstliche Zeit. / Du sollst dich nicht freuen am müßigen Streit. / Denn der Pflug und das Rind und die keimende Saat, / brauchen wenig Worte, sie brauchen die Tat.« Dem stimmte Ulbricht zu. Ihm ging es vorrangig darum, Ursachen und Folgen von Fehlentscheidungen zeitnah und gründlich zu analysieren und entstandene Probleme »im Vorwärtsschreiten« rasch aus der Welt zu schaffen. Er war aber durchaus bereit, sich erforderlichenfalls öffentlich zu korrigieren. Auch Ulbricht konnte mit allem Recht für sich reklamieren: Nur derjenige bleibt von Fehlern frei, der nichts tut und nichts zu entscheiden hat. Er trug, noch einmal, in schwieriger Zeit eine große Verantwortung. Das entschuldigt nichts, erklärt aber vieles. Deshalb greift es zu kurz, ist m. E. Ausdruck von Unkenntnis und Ignoranz der Fakten oder aber der Bereitschaft, sich dem »Urteil« der notorischen DDR-Gegner anzupassen, wenn Walter Ulbricht als »Stalins Vollstrecker in der DDR«[11] wird. bezeichnet Bei solchen Verdikten über die von Ulbricht geprägte Politik im ersten Nachkriegsjahrzehnt werden die politischen Machtverhältnisse, besonders die Rolle der sowjetischen Militäradministration in Deutschland (SMAD), ausgeblendet. Die SMAD hatte mehr als 80.000 Mitarbeiter, ihre Befugnisse, Weisungen und Empfehlungen bestimmten lange Zeit auch den Handlungsspielraum der Führung der SED. Die Personen an der Spitze der Partei trugen jedoch – bei begründeten wie bei problematischen Entscheidungen der sowjetischen Seite die Hauptverantwortung bei der Durchführung und für deren Folgen. Wer gerecht über Ereignisse und Entscheidungen aus jener Zeit urteilen will, darf die Mühe nicht scheuen, nachzuprüfen, von wem und aus wessen Interessenlage gehandelt wurde. Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und vor allem Walter Ulbricht wird besonders hinsichtlich der Entwicklung in den Jahren 1952/53 manches angelastet, was nicht von ihnen entschieden und verursacht worden ist. Die in letzter Zeit erschlossenen Archivalien erhellen, dass Walter Ulbricht sich mutig und konsequent für die Interessen der deutschen Sozialisten und des deutschen Volkes eingesetzt hat. »Die Beziehungen zwischen der DDR und den Russen waren komplizierter, als wir das damals möglicherweise annahmen«,[12] resümiert der amerikanischer Historiker Fritz Stern. Und Julij A. Kwizinskij, Diplomat an der Botschaft der UdSSR in Berlin und später Botschafter in Bonn, beschreibt das Verhältnis seines Landes zur DDR als »in mancher Hinsicht schizophren«.[13] Ich habe Margot Honecker gefragt, wie Sie diese Aussage Kwizinskijs bewerte, worauf sie meinte, das komplizierte und komplexe Verhältnis zwischen der DDR und der UdSSR, zwischen der SED und der KPdSU ließe sich nicht auf einen solchen Satz reduzieren. Wie siehst du das? Das Dominierende in der Beziehung zwischen der UdSSR und der DDR waren die gemeinsamen Grundlagen und Ziele der gesellschaftlichen Entwicklung. Eindeutige Übereinstimmung gab es hinsichtlich der sozialen Wesensmerkmale als Staaten der arbeitenden Klasse, in ihrer Berufung auf den Marxismus Leninismus, hinsichtlich ihrer Entwicklungsziele und in ihrer Solidarität mit den um Befreiung kämpfenden Völkern und Bewegungen und ihrer Auseinandersetzung mit der Strategie und Politik des Kapitalismus. Der opferreiche, große Beitrag am Sieg der Antihitlerkolation über das faschistische Deutschland und ihre Stellung als erster sozialistischer Staat der Geschichte verliehen der Sowjetunion ein besonderes Gewicht im internationalen Bereich. Das hatte unübersehbare Auswirkungen auf die poltische Entwicklung in der von der Roten Armee besetzten Zone und in der Deutschen Demokratischen Republik. Entgegen den Erwartung der deutschen Sozialisten gestalteten sich die Beziehungen zwischen den beiden Staaten – trotz Übereinstimmung in den genannten Grundfragen – nicht in jedem Fall konfliktfrei, die Gespräche zwischen den Führungspersönlichkeiten erfolgten nicht auf gleicher Augenhöhe. Als die Auslandsleitung der Kommunistischen Partei Deutschlands ihren Sitz in Moskau hatte, gab es zwischen Stalin und den in Moskau lebenden Persönlichkeiten der KPD nicht eine Begegnung, es gab kein Gespräch. Die im sowjetischen Exil lebenden deutschen Kommunisten ertrugen stattdessen, dass viele Genossen unter oft haltlosen Anschuldigungen verhaftet, verurteilt und mitunter erschossen wurden. Selbst Mitglieder der KPD-Führung wie Pieck, Ulbricht und Florin blieben vor hanebüchenen Beschuldigungen nicht verschont. Im Zentralarchiv des KGB (jetzt FSB) findet sich das Dokument »Über die konterrevolutionäre bucharinistisch-trotzkistische Organisation Pieck-Ulbricht«.[14] Georgi Dimitroffs Tagebuch enthält am 13. April 1939 den Eintrag: »Ulbricht aus dem NKWD kam angeblich die Weisung, über ihn zu informieren (also fragwürdiges Element).«[15] Trotz ihrer eigenen Bedrohung setzten sich, wie inzwischen erschlossene Dokumente und Aussagen von Zeitzeugen – darunter Herbert Wehner – zweifelsfrei beweisen, Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht mutig für verhaftete und für aus NKWD-Haft entlassene Genossen ein.[16] In gleicher Weise stemmten sich später Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht und Otto Grotewohl energisch und zumeist erfolgreich dagegen, dass die vom sowjetischen Geheimdienstchef Lawrenti P. Berija in Ungarn, Bulgarien und in der Tschechoslowakei inszenierte Prozesswelle gegen aufrechte Kommunisten die DDR erreicht. Es konnte jedoch nicht verhindert werden, dass Franz Dahlem, Paul Merker und andere verdienstvolle Genossen unter dem Einfluss Berijas ungerechtfertigten Anschuldigungen ausgesetzt waren. Wer Derartiges erlebt und sich den Auseinandersetzungen dazu gestellt hat, dem waren derartige Herrschaftsgebaren Stalinscher Provenienz zutiefst suspekt. Nach jenen schweren Zeiten im Moskauer Exil kannte Walter Ulbricht wie kaum ein anderer die Regeln und Fallen des politischen Handelns im sowjetischen Einflussbereich. Seine aus den Idealen der Arbeiterbewegung abgeleitete politische Strategie und die ständige Analyse des Möglichen verbanden sich in seinem Handeln zu einer organischen Einheit. Aber: Weder die bitteren Erlebnisse in der Moskauer Emigration noch seine Differenzen mit der politischen und militärischen Führung der UdSSR beschädigten die herzliche Verbundenheit von Walter Ulbricht mit dem Lande Lenins. In den vierzig Jahren der Existenz der DDR wurden derartige Probleme nicht offenbart. Das galt insbesondere für die offensichtlichen Differenzen mit Lawrenti Berija. Dieser misstraute der Führung der SED und der DDR. Seit dem Ende des Jahres 1952 bahnte er geheime Vorbereitungen für einen »Verkauf der DDR« an. Die erheblichen Vorbehalte gegenüber dem Vorgehen des Hohen Kommissars der UdSSR in der DDR, Wladimir Semjonow, wurden gleichfalls nur intern verarbeitet. In den kritischen Juni-Tagen 1953 verhandelte Moskaus Vertreter in Berlin ungeniert mit dem LDPD Politiker Hermann Moritz Kastner einem später als Spitzenagenten entlarvten BRD-Mitarbeiter – über Veränderungen in der Politik und in der Zusammensetzung der Regierung der DDR. Diese Verhandlungen führten Semjonow und Kastner derart ungeniert, dass der Spiegel darüber schon am 15. Juni 1953 berichten konnte.[Anmerkung 11] Doch in der DDR wurden weder der damit verbundene Ärger noch die Bemühungen, solche Probleme auszuräumen, öffentlich gemacht. Nicht selten deckte man anschließend mit gegenseitigen Bekundungen bündnistreuer Zusammenarbeit die schlichte Tatsache, dass Differenzen bereinigt wurden. Wenn die deutschen Partner gegenüber sowjetischen Vorgaben korrigierend wirkten, erfolgte das – wie Otto Grotewohl nach dem XX. Parteitag der KPdSU vor dem Plenum des ZK der SED berichtete – meist »still, selbstlos und erfolgreich«.[17] Von Werner Eberlein, der Walter Ulbricht sehr nahe stand, weiß ich, dass Ulbricht nie mit ihm über seinen Vater, der zu den Opfern Stalinscher Willkür gehörte, gesprochen hat. Er selbst hat ihm auch nie eine solche Frage gestellt. Gleichwohl war das Thema in der Partei präsent. 1988 hieß es in einem Grundsatzdokument des ZK der SED: »Auch deutsche Kommunisten waren in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre von ungesetzlichen und ungerechtfertigten Repressionen in der Sowjetunion betroffen. Die KPD verlor durch diese dem Wesen des Sozialismus zutiefst widersprechenden Vorgänge bewährte, der Arbeiterklasse und der Partei treu ergebene Mitglieder und Funktionäre, unter ihnen Hugo Eberlein, Leo Flieg, Felix Halle, Werner Hirsch, Hans Kippenberg, Willy Leow, Heinz Neumann, Hermann Remmele, Hermann Schubert und Fritz Schulte. Nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 und dem Bekanntwerden aller Umstände stellte die SED die Parteimitgliedschaft und die Parteiehre der von Repressionen betroffenen deutschen Kommunisten wieder her.«[18] Hat sich Walter Ulbricht jemals zu diesen tragischen Vorgängen geäußert? Das habe ich nie erlebt. Werner Eberlein nennt in seinen Erinnerungen[19] die Gründe, auch in einem Beitrag im Neuen Deutschland ging er darauf ein. »Wir haben verdrängt, was in der Sowjetunion geschah – auch aus der Scham heraus, dass so etwas in unserer Sowjetunion passierte.«[20] Beschweigen erwies sich als eine Form stummer Kommunikation. Die eigene Verletzung sollte nicht offenbart, das sozialistische Ideal beschützt und nicht beschädigt werden. Das war offensichtlich das Hauptmotiv für eine solche Haltung. Verdrängung war ein Mittel der Bewältigung des Unerklärbaren. Ulbrichts Verhalten aber entsprach dem eines Menschen, der kundig war, der diese Vorgänge kannte. Er hat dazu soweit mir bekannt ist – aber nichts Schriftliches hinterlassen. Jede Antwort Unbeteiligter bleibt somit Hypothese. Bekannt und durch Dokumente belegt ist, ich erwähnte es bereits, dass Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und Walter Ulbricht sich intensiv für die Freilassung inhaftierter und verbannter Genossen und um deren Übersiedlung in die DDR eingesetzt haben. Ihre Bemühungen erfolgten aber über interne Kanäle, nicht selten auch in zähen und oft langwierigen Auseinandersetzungen mit sowjetischen Behörden. Allein das Beispiel Werner Eberleins – er schildert in den Memoiren die Komplikationen seiner Rückkehr aus sowjetischer Verbannung macht bewusst, welche Hürden dabei oft zu bewältigen waren. Historiker und Publizisten streiten noch immer über Ereignisse und Entscheidungen 1956. Auch du hast darüber geschrieben. Ohne Zweifel war jenes Jahr von besonderer Brisanz. Trotz zahlreicher Publikationen sind noch immer wichtige Fragen unbeantwortet. Im Kontext mit der Behandlung des XX. Parteitages der KPdSU erfolgt eine undifferenzierte Stalinismus-Debatte, die m. E. zu einer verengten Geschichtsbetrachtung führt. Mit einem daraus abgeleiteten Generalverdacht gegenüber allem, was in der DDR politisch geschah, werden wichtige historische Tatsachen einer sachgerechten Prüfung und damit objektiver Wertung entzogen. Nicht selten werden auch die realen Chancen der 1956 diskutierten Ideen und Projekte Oppositioneller überbewertet und die geheimdienstliche Verstrickung einiger Akteure bagatellisiert oder gar ausgeblendet. Und es überzeugt nicht, wenn die Politik der DDR nach dem XX. Parteitag der KPdSU vorrangig aus der Sicht jener Kräfte beurteilt werden soll, die in den politischen Auseinandersetzungen keine Mehrheit für sich und ihre Positionen hatten finden können. Wer damals nicht dabei war, kann sich kaum vorstellen, wie kompliziert die Situation in der zweiten Hälfte des Jahres 1956 war. Der Kalte Krieg spitzte sich dramatisch zu. In Ägypten intervenierten Frankreich und Großbritannien militärisch, in Polen und Ungarn gab es bewaffnete Unruhen, in der Bundesrepublik wurden die KPD und andere Organisationen verboten sowie über 100.000 Ermittlungsverfahren gegen Mitglieder und Sympathisanten der Partei eingeleitet und Urteile gefällt. Die NATO wertete ihre Erfahrungen in der 1955 abgelaufenen Übung DECO II aus, die sich mit der Besetzung des Territoriums der DDR bis an die Oder Neiße-Linie befasste.[21] Ein Spionagetunnel, der von amerikanischen und britischen Geheimdienstlern von Westberlin aus aufs Territorium der DDR vorgetrieben worden war, um Telefonverbindungen der sowjetischen Truppen anzuzapfen, flog auf. Politische Gremien der Bundesrepublik, bekannt als Forschungsbeirat für Fragen der Wiedervereinigung, hatten zwischen 1954 und 1956 auf 298 Tagungen mit Hochdruck Möglichkeiten der Rückführung der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse der DDR erarbeitet.[22] Kurz: Die internationale und nationale politische Atmosphäre war in jenen Monaten außerordentlich angespannt, die Lage äußerst gefährlich. Was folgte daraus für die DDR, für deren politische Führung? Welche Konsequenzen ergaben sich für Ulbricht? Unter solchen Bedingungen hat die Sicherung der Macht Vorrang vor nicht genügend ausgereiften Experimenten. Aus dieser Maxime resultiert eine erkennbare Zurückhaltung der Führung der SED und der DDR gegenüber Ideen aus unterschiedlichen Richtungen, selbst gegenüber eigenen Projekten. Die SED Spitze hatte beispielsweise in einem kleinen Kreis von Rechtsexperten Vorschläge für eine Verfassungsänderung erarbeitet. Angesichts der eruptiven Ereignisse des Jahres 1956 verzichtete man jedoch darauf, dieses Vorhaben in die öffentliche Debatte und in die Realisierungsphase zu überführen. Unter den gegebenen Bedingungen waren andere Aufgaben einfach dringlicher. Politik ist gerade unter Spannungsverhältnissen eine höchst sensible Kunst des Machbaren und Möglichen. Was stand im Zentrum der Debatte über den XX. Parteitag der KPdSU? Woran erinnerst du dich besonders? Wenn heutzutage von diesem Parteitag die Rede ist, wird nicht nur in bürgerlichen Medien der Eindruck vermittelt, dass das Wichtigste die am Abend des letzten Beratungstages gemachten Ausführungen Chruschtschows über den Personenkult und die Untaten Stalins gewesen sind. Damit wird ausgeblendet, was auf diesem fast zwei Wochen dauernden Parteitag erörtert und beschlossen wurde, nämlich Richtungsentscheidungen für die UdSSR und die sozialistische Weltbewegung. Die Zeit der Vorbereitung war dafür genutzt worden, strategische Fehler in der Vergangenheit zu korrigieren und neue Lösungsansätze für die Stärkung der Bewegung zu finden. Dazu gehörten insbesondere das Abrücken von Stalins These, dass sich mit dem Fortschreiten des Sozialismus der Klassenkampf weiter verschärfe. Der Parteitag forderte die Stärkung der Gesetzlichkeit und den spürbaren Ausbau der sozialistischen Demokratie. Seit 1953 war dieser Kurs mit Entlassung und Rehabilitierung unschuldig Verurteilter erkennbar geworden. Zum ersten Mal schätzte Moskau ein, dass der Sozialismus über den früheren Rahmen eines Landes hinauswachsen und sich zu einem sozialistischen Weltsystem entwickeln könnte. Damit wuchs Hoffnung auf die Stärkung des eigenen Lagers und auf eine größere Schwungmasse in der internationalen Systemauseinandersetzung. Aus der über lange Zeit verdrängten Feststellung der ökonomischen Überlegenheit des kapitalistischen Weltsystems wurde die Zielstellung abgeleitet, die eigenen Potenzen so auszubauen, dass künftig die entwickelten kapitalistischen Länder in der Produktion pro Kopf der Bevölkerung überholt werden würden. Man setzte also mehr auf Quantität als auf Qualität und war davon überzeugt, dass nicht Mangel und Askese Wegbegleiter des gesellschaftlichen Fortschritts sein würden. Der Sozialismus sollte künftig den Menschen auch materiell mehr bieten als frühere Gesellschaftsordnungen. Schließlich kehrte der XX. Parteitag zu Lenins These zurück, dass die Nationen in Abhängigkeit von den realen Entwicklungsbedingungen und den Traditionen des jeweiligen Landes auf verschiedenen Wegen zum Sozialismus gelangen werden. Bekanntlich war diese vernünftige Position in der Auseinandersetzung mit den jugoslawischen Kommunisten aufgegeben worden. Gelegentlich wird kolportiert, Ulbricht habe die Auswertung des XX. Parteitages in der SED eher gebremst als gefördert. Die unter einigen Historikern erörterten Zweifel an der Haltung von Walter Ulbricht zu den Entscheidungen des XX. Parteitages stützen sich fast ausschließlich auf Karl Schirdewan, der sich darüber 1994 in einem Buch geäußert hatte.[Anmerkung 12] Seinen kritischen Aussagen zur Haltung von Walter Ulbricht stehen allerdings Tatsachen gegenüber. Sie wurden ignoriert oder, vielleicht unter dem Eindruck der aufkommenden Stalinismusdebatte, übersehen. Historiker, die sich in ihren Analysen der Politik der SED nach dem XX. Parteitag auf derart ungeprüfte individuelle Aussagen stützen, bewegen sich nach meiner Überzeugung auf recht dünnem Eis. Laut Schirdewan wurde eine Auswertung des XX. Parteitages, »die verbunden war mit eigenständigen Schlussfolgerungen für die SED […] hinausgezögert«.[23] Dem steht entgegen, dass Walter Ulbricht schon wenige Tage nach der Rückkehr der SED-Delegation aus Moskau in einem grundlegenden Beitrag im Neuen Deutschland Stellung zu den Ergebnissen des XX. Parteitages nahm. Seine Distanz zu allen in den dreißig Jahren unter Stalin abgehaltenen Parteikongressen wurde schon am Beginn dieses Artikels deutlich, indem er feststellte: »Dieser XX. Parteitag der KPdSU war der bedeutendste Parteitag der KPdSU seit dem Ableben Lenins.« Nach seiner Darstellung der Hauptergebnisse der Beratungen zog Walter Ulbricht erste praktische Schlussfolgerungen. An vorderer Stelle stand dabei seine Offerte an die Sozialdemokratie für eine vorbehaltlose Zusammenarbeit im Interesse der Sicherung des Friedens. Eingehend behandelte er im Weiteren das Bekenntnis des KPdSU-Parteitages zu den unterschiedlichen Wegen und Formen des Übergangs zum Sozialismus. Bekanntlich hatte es in dieser Frage seit 1948 erhebliche Differenzen gegeben, in deren Ergebnis die SED ihre ursprüngliche Linie eines besonderen deutschen Weges zum Sozialismus aufgeben musste. Mit der Entscheidung des XX. Parteitages schien der Weg für ein realitätsbezogenes und flexibles Herangehen an die Gestaltung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung wieder frei. Das Neue Ökonomische System und die in den 60er Jahren vorgenommenen Änderungen im politischen System der DDR gehören zu den fundamentalen Konsequenzen, die von der SED und der DDR unter Ulbrichts Leitung aus dem XX. Parteitag gezogen wurden.[Anmerkung 13] Es gab innerhalb und außerhalb der Partei nach dem XX. Parteitag hitzige und kontroverse Diskussionen. Wie hat Walter Ulbricht darauf reagiert? Auch in diesen Debatten war er ein Mann der klaren Worte. Sowohl mit Parteimitgliedern als auch mit Arbeitern in den Betrieben, mit Bauern, Wissenschaftlern und Künstlern suchte er den Gedankenaustausch. In den Gesprächsrunden zeigte sich, dass er geduldig und aufmerksam zuhören, aber auch argumentativ überzeugen konnte. Bedingt durch die Last seiner Verantwortung befand er sich dabei nie in der komfortablen Situation, die die meisten seiner Kritiker damals wie heute hatten: Sie polemisieren zumeist aus einer Distanz zur Macht und ohne den damit verbundenen Druck der Verantwortung für das Morgen und Übermorgen. Walter Ulbricht musste täglich handeln und entscheiden, er hatte seine Position bei Wahrnehmung staatsmännischer Verpflichtungen zu entwickeln und herauszuarbeiten. Der Wissenschaftler Professor Peter Adolf Thiessen beobachtete das sehr aufmerksam und fasste zusammen, was viele Teilnehmer von Beratungen mit Ulbricht empfanden. »Walter Ulbricht reagiert sehr empfindlich und wird überaus deutlich, wenn unverkennbar ist, dass durch eine verzierte Fassade Unzulänglichkeiten der Funktion oder dürftiges Inventar verdeckt werden soll. Bei allen Begegnungen verlangt er, durch Tatsachen und saubere logische Argumentation überzeugt zu werden. Ist er überzeugt, verleiht er seiner Anerkennung einen Ausdruck, der nicht zum Stillsitzen veranlasst, sondern zu gesteigerter Leistung.«[24] Wie ging Ulbricht mit eigenen Unzulänglichkeiten um? Wenn es sich als notwendig erwies, war er zur öffentlichen Selbstkritik bereit. Ich möchte das an einem charakteristischen Beispiel aus den ersten Wochen nach dem XX. Parteitag schildern. Für Mitte März 1956 war die Bezirksdelegiertenkonferenz der SED Berlin einberufen worden. Zu jenem Zeitpunkt wusste niemand in der SED Führung, dass die westliche Presse am Morgen des Tages, an dem dort Ulbricht sprechen würde, mit der geheimgehaltenen Rede Chruschtschows aufmachen würde. Er war dadurch in keiner beneidenswerten Situation. Sollte er sich auf die in Moskau vereinbarte Verschwiegenheit berufen oder entgegen den verbindlichen Absprachen– prinzipiell und angemessen über die kritisierten Verfehlungen und Verbrechen Stalins sprechen? Wie so oft scheute Walter Ulbricht auch in dieser schwierigen Situation weder politische noch persönliche Risiken. Weitgehend aus dem Stegreif (ein autorisierter Text der Chruschtschow-Rede lag ihm noch immer nicht vor) referierte er zwei Drittel seiner Redezeit über den wesentlichen Inhalt von Chruschtschows Ausführungen. Dieses nicht vereinbarte Vorgehen bedurfte einer Erklärung gegenüber den Repräsentanten der KPdSU, denen er umgehend telegrafierte: »Es ist uns nicht angenehm, dass wir zu Fragen der KPdSU öffentlich Stellung nehmen, bevor das in der Prawda geschehen ist. Es blieb uns jedoch in dieser Situation kein anderer Weg. Ich schlage vor, dass in einem Leitartikel der Prawda zu einigen Fragen Stellung genommen wird.«[25] Ulbrichts Rede, die tags darauf in der DDR-Presse zu lesen war, bewegte die Partei und große Teile der Bevölkerung. Auf eine Passage wurde besonders kritisch reagiert. »Wir verstehen, dass es eine große Zahl junger Genossen bei uns gibt, die nach 1945 in die Arbeiterbewegung gekommen sind, die nicht wie wir mehr als 45 Jahre Parteikampf und innerparteilichen Kampf mitgemacht haben, sondern im Parteilehrjahr bestimmte Dogmen auswendig gelernt haben und nun erleben, dass die Dogmen nicht mehr in das Leben passen. Aber jetzt sagen manche nicht etwa, der Dogmatismus ist nicht richtig, sondern da stimmt etwas im Leben nicht. (Heiterkeit) Das scheint mir verkehrt zu sein.«[26] Auf der zwei Wochen später tagenden.[27] Parteikonferenz monierte besonders Willi Bredel diese Bemerkung. »Wenn die jungen Genossen Stalin Seite für Seite, Wort für Wort in sich aufgenommen haben, ist das ihre und zwar ihre alleinige Schuld? Ist das nicht auch unsere Schuld?«[28] Ulbricht akzeptierte die Kritik. Aus eigenem Erleben weiß ich, wie nahe ihm diese verunglückte Passage ging. Auf einer Jugendkonferenz in Rostock im Sommer 1956 gab es dazu Nachfragen. Seine im Konferenzprotokoll festgehaltene Antwort offenbart, wie sehr ihn dieses Thema noch immer beschäftigte. »Einer der Jugendfreunde sprach davon, dass auf der Berliner Delegiertenkonferenz die Frage stand, dass die Jugend im Sinne des Dogmatismus, der Buchstabengelehrtheit beeinflusst wurde. Ich muss sagen, so, wie das dort in der Presse stand, konnte der Bericht über meine Rede zu Missverständnissen führen. Und dort ist auch einiges etwas vereinfacht. Dort wird zum Beispiel gesagt, dass Heiterkeit war bei dieser Frage, und jemand hat gesagt, die Jugend wurde ausgelacht. Das stimmt nicht. Selbstverständlich, über diesen Vergleich hat ein Teil der Delegierten gelacht. Aber das bezog sich auf diese Formulierung, die nicht exakt war. Ihr habt recht, diese Frage zu stellen. Wie kann man also richtig das Studium der Jugend fördern und das Verständnis für die großen politischen und wirtschaftlichen Fragen wecken? Ein Jugendfreund stellte die Frage, wie ist das mit dem Dogmatismus? Ich sage euch ganz offen, selbstverständlich sind wir allein die Hauptschuldigen. Warum? Weil der Marxismus-Leninismus in diesen Jahren vereinfacht gelehrt wurde. Aber der Marxismus-Leninismus ist viel reicher, viel vielfältiger, viel interessanter als das, was an Schulen – ob Berufs- oder Fachschulen – im gesellschaftlichen Unterricht gelehrt wird.«[29] Seine Reaktion in Rostock entsprach Ulbrichts Haltung zu Kritik und Selbstkritik. Unter der Leitung von Walter Ulbricht erfolgten wesentliche Veränderungen des politischen Systems der DDR, was stand dabei im Mittelpunkt? Die Änderungen im politischen System der DDR erfolgten nach dem XX. Parteitag der KPdSU und dem darauf folgenden V. Parteitag der SED im Juli 1958. Das Gesamtkonzept ruhte vor allem auf drei Säulen. Erstens: Schaffung eines Neuen Ökonomischen Systems, das es ermöglichte, die Erkenntnisse von Wissenschaft und Technik effektiv mit den Erfordernissen sozialistischen Wirtschaftens zu verbinden. Dabei sollte das – von Stalin weithin ignorierte Wertgesetz beachtet, die Eigenverantwortlichkeit der Betriebe gestärkt, das Leistungsprinzip gefördert und damit eine – nicht mehr vorrangig administrative – Art der Beziehungen zwischen der Zentrale und den Wirtschaftseinheiten geschaffen werden. Zweitens: Veränderung der Arbeit der Parteiorgane durch Verzicht auf die Regelung vieler Detailangelegenheiten und Konzentration auf Grundfragen der gesellschaftlichen Entwicklung. Orientiert wurde auf eine stärkere Einbeziehung der Mitglieder und der Grundorganisationen und ebenso parteiloser Fachleute in die Vorbereitung wichtiger Beschlüsse. Zu Tagungen des Zentralkomitees der DDR wurden erfahrungsreiche parteilose Experten (u. a. Professoren wie Manfred von Ardenne, Peter A. Thiessen und Max Steenbeck) eingeladen, sie hatten dort Rederecht. Drittens: Stärkung der Rolle des Staates und des Rechts. Besonders nach der Bildung des Staatsrates im September 1960 wurden in den nachfolgenden Jahren grundlegende Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung im Plenum und in den Ausschüssen der Volkskammer, im Staatsrat und im Ministerrat beraten und entschieden. Ebenso erlebten die örtlichen Volksvertretungen in jener Zeit eine Periode der Belebung, des Ausbaus ihrer Vollmachten und einer engen Verbindung von Wählern und Gewählten. Die Beziehungen zwischen den Partei und Staatsorganen gehörten zweifellos zu den kompliziertesten Fragen der Führung gesellschaftlicher Prozesse bei der Errichtung einer sozialistischen Gesellschaftsordnung. Lenin hatte die Problematik früh erkannt und in seinem letzten Werk »Lieber weniger, aber besser« dargelegt, dass ein Nebeneinander von Partei- und Staatsorganen kein Idealfall sei. Seinen Lesern stellte Lenin die Frage: »Bildet denn die elastische Vereinigung von Sowjet- und Parteidingen nicht eine Quelle außerordentlicher Kraft unserer Politik.«[30] An anderer Stelle hob er hervor: »Ich glaube, eine solche Vereinigung bildet die einzige Gewähr für die erfolgreiche Arbeit.«[31] Mit den nach dem XX. Parteitag der KPdSU geplanten Veränderungen erfand Ulbricht keinesfalls das Rad neu. Er suchte den Weg zu weiteren Fortschritten bei Lenin. Julij Kwizinskij berichtete in seinen Memoiren über einen Disput zwischen Walter Ulbricht und einem Mitglied der Parteiführung der KPdSU. Ulbricht habe diesen Mann offensichtlich mit der Frage überrascht, »ob das Politbüro des ZK der KPdSU sich nicht Gedanken darüber mache, dass man auf diese Weise den Staat nicht weiter führen könne. Die Partei werde so allmählich an Macht einbüßen. Wir glauben«, so hielt Ulbricht seinem Gegenüber vor, »dass wir der Gesellschaft die Entwicklungsgesetze diktieren könnten, und handeln nach dem Schema: Das Politbüro beschließt, das etwas aufgebaut, abgeschafft oder verboten werden muss, der Rest ist eine Frage der organisatorischen Arbeit der Partei. Wenn der Beschluss nicht erfüllt wird, war seine Durchsetzung schlecht organisiert, das heißt, man muss jemanden bei den Ohren nehmen und bestrafen. Aber wir zweifeln keinen Augenblick daran, dass unsere Beschlüsse richtig und notwendig, gleichsam von ›Gott‹ sind.«[32] Aus Kwizinskijs Ausführungen wird deutlich, das Ulbricht sehr klar erkannt hatte, dass die Monopolisierung aller wesentlichen Entscheidungen in Führungsgremien der Partei für die Entwicklung der Gesellschaft ein ernsthaftes Problem für die weitere Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft bedeutete. Als Vorsitzender des 1960 gebildeten Staatsrates der DDR hat Ulbricht dessen Aufgaben und seine Arbeitsweise im besonderen Maße geprägt. Wie siehst du das? Der Staatsrat war am 12. September 1960 als ein Organ der Volkskammer gebildet worden. Dem Parlament war er auch rechenschaftspflichtig. Die Programmatische Erklärung ihres Vorsitzenden vom 4. Oktober 1960 machte deutlich, dass eine neue Qualität staatlichen Wirkens angestrebt wurde. Dabei ging es um eine grundlegende Veränderung im politischen System. Ulbrichts Credo dafür lautete: »Unter unseren Bedingungen ist die staatliche Leitung nicht die Ausübung von Kommandogewalt, sondern die Führung der Menschen auf dem Weg des bewussten Kampfes für den Sieg des Sozialismus.«[33] Vor der Volkskammer merkte er kritisch an, dass nicht selten Bürgern »mit seelenlosem bürokratischen Verhalten« begegnet werde. »Es wird zu sehr kommandiert, abgewiesen, anderen über den Mund gefahren, rechthaberisch aufgetreten, bevormundet. Viele Sympathien, gute Vorschläge und ehrliche Bereitwilligkeit gehen dabei verloren, wenn man Menschen so behandelt, wenn man ihre Gefühle verletzt, sie kränkt.«[34] »Menschen zu überzeugen«, so seine Haltung, »ist eine schwierige, aber schöne und dankbare Aufgabe, sie erfordert viel Zeit und Mühe, viel Takt, Fingerspitzengefühl und menschliche Größe.«[35] Zu den ersten Bereichen, denen sich der Staatsrat nach der Programmatischen Erklärung annahm, gehörte die Rechtspflege in der DDR. Ja. Im Januar 1961 und im Mai 1962 analysierte der Staatsrat kritisch die Situation und verurteilte die besonders in der Strafrechtswissenschaft erkennbaren dogmatischen Auffassungen. Eine Kommission wurde berufen und beauftragt, Maßnahmen zur Vervollkommnung der sozialistischen Rechtspflege zu erarbeiten. Im Dezember 1964 lag das Ergebnis in Form eines Erlasses und grundlegender gesetzlicher Änderungen vor. Diese wurden beraten und als Entwürfe über ein Jahr zur öffentlichen Diskussion gestellt. Nie zuvor und danach nie wieder gab es eine derart umfassende Beratung über das Recht und seine volksverbundene Anwendung. Mehr als zwei Millionen Bürger der DDR beteiligten sich an den Beratungen und lieferten zahlreiche Vorschläge und Anregungen. Etwa 600 dieser Vorschläge wurden in der Endfassung des Rechtspflegeerlasses berücksichtigt. Nach dieser wahrhaft demokratischen Vorbereitung überwies der Staatsrat die Entwürfe für ein neues Gerichtsverfassungsgesetz, für ein Staatsanwaltsgesetz und für ein Gesetz über die Änderung verfahrensrechtlicher Bestimmungen an die Volkskammer zu Beratung, Prüfung und Beschlussfassung. Der volksverbundene Kurs der sozialistischen Rechtspflege wurde durch Entscheidungen des Staatsrates über die Bildung und die Tätigkeit von Konfliktkommissionen (in Betrieben und Einrichtungen mit mehr als 50 Beschäftigten) und von Schiedskommissionen (in Städten und Gemeinden) wirkungsvoll weiter verstärkt. Die Konfliktkommissionen entschieden über geringfügige Straftaten, wenn die Schuld gering und der Sachverhalt aufgeklärt und einfach war.[36] In ähnlicher Weise machte man sich 1961 an die Neuregelung und Erweiterung der Rechte und der Verantwortung der örtlichen Volksvertretungen, wenn ich das richtig sehe. Walter Ulbricht hatte sich vor allem vor Ort mit Abgeordneten und Bürgermeistern in mehreren Kreisen eingehend mit der Materie beschäftigt. Bei Beratungen im Kreis Forst ging es ihm vor allem um die Festlegung eindeutiger Kompetenzen. »Eines der wesentlichen Probleme der weiteren Qualifizierung der staatlichen Leitungstätigkeit«, meinte er, »ist die Festlegung und Einhaltung klarer Verantwortlichkeit für die einzelnen Organe und ihre Mitarbeiter. In der Praxis wird heute die Verantwortung der staatlichen Organe dadurch gemindert, dass für die gleiche Sache mehrere Organe bzw. Mitarbeiter verantwortlich gemacht werden, ohne klarzustellen, wer für was verantwortlich ist.« Kritisch merkte er dazu an: »Die Tatsache, dass Detailfragen zentral entschieden wurden, dass Parteiorgane Einzelprobleme der staatlichen Leitungstätigkeit an sich zogen und entschieden, drückte ungenügende Berücksichtigung der Realitäten, unbegründete Ungeduld und mangelndes Vertrauen in die Bereitschaft und die Fähigkeit der verantwortlichen staatlichen Organe, ihrer Mitarbeiter und der Werktätigen für die Lösung dieser Aufgaben aus.«[37] Eine Kommission des Staatsrates erarbeitete daraufhin mit Praktikern aus Gemeinden, Städten, Kreisen, Bezirken und den Ministerien sowie mit Wissenschaftlern Entwürfe für »Ordnungen über die Aufgaben und die Arbeitsweise der örtlichen Volksvertretungen«. Der Staatsrat beriet die Materialien und stellte sie über Monate zur öffentlichen Diskussion. Der Ausbau der Vollmachten und der Verantwortung der gewählten Volksvertretungen von den Gemeindevertretungen bis zur Volkskammer war Walter Ulbricht offensichtlich ein wichtiges Anliegen bei Entwicklung der sozialistischen Demokratie? Das war unübersehbar. Die Intensivierung der Tätigkeit der Volksvertretungen gehörte zu den politischen Schlussfolgerungen, die in Auswertung der Beschlüsse des XX. Parteitages der KPdSU gezogen wurden. Schon im Januar 1957 beriet und beschloss die Volkskammer Gesetze über die örtlichen Organe der Staatsmacht und über die Rechte und Pflichten der Volkskammer gegenüber den örtlichen Volksvertretungen. Der damit eingeschlagene Kurs wurde insbesondere nach der Bildung des Staatsrates 1960 konsequent weitergeführt. Markante Beispiele dafür waren insbesondere die Ausweitung der Rechte und Verantwortung der örtlichen Vertretungsorgane, die Aktivierung der Tätigkeit der Ausschüsse der Volkskammer, der Ausbau der Rechtpflege. Dabei wurde, ebenso wie beim neuen ökonomischen System, oftmals Neuland beschritten. Die Ergebnisse dieser Entwicklung fanden schließlich Eingang in die 1968 durch Volksentscheid beschlossene Verfassung. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, was in dieser Zeit zur Weiterentwicklung des Wahlsystems der DDR unternommen wurde. Ab 1963 wurde die Leitung der Wahlen, die vorher traditionell dem Innenministerium oblag, auf allen Ebenen – von der Volkskammerwahl bis zu der Wahl der Gemeindevertretungen – demokratisch gewählten Wahlkommissionen anvertraut. Im Interesse einer engeren Beziehung von Wählern und Gewählten wurden schrittweise die Wahlkreise verkleinert. Ab 1965 wurde der Grundsatz der einheitlichen Liste der in der Nationalen Front vereinten Parteien und Massenorganisationen in der Weise erweitert, dass auf allen Ebenen den Wählern mehr Kandidaten zur Auswahl gestellt wurden, als Mandate zu vergeben waren. Der Einsatz elektronischer Rechentechnik bei der Ermittlung und Übermittlung der Wahlergebnisse machte es ab 1967 möglich, das vorläufige Wahlergebnis – wie in anderen Industriestaaten auch – noch am Wahlabend zu verkünden. Die erste Hälfte der 60er Jahre erwies sich als eine Periode eines unübersehbaren und auch international anerkannten gesellschaftlichen Fortschritts in der DDR. Mit der 1967 und 1968 erfolgten umfassenden Diskussion über den unter Ulbrichts Leitung erarbeiteten Verfassungsentwurf und mit der am 6. April 1968 erfolgten Volksabstimmung über diese Verfassung wurde ein Höhepunkt bei der Herausbildung der sozialistischen Demokratie in der DDR erreicht. In mehr als 750.000 Veranstaltungen hatte in der etwa halbjährigen öffentlichen Diskussion die Bevölkerung den Verfassungsentwurf geprüft und seine Meinung und seine Zustimmung zu diesem grundlegenden Dokument zum Ausdruck gebracht. Der Kommission zur Ausarbeitung der Verfassung der DDR wurden 12.454 Vorschläge unterbreitet. Sie wurden in der Verfassungskommission ernsthaft beraten und führten gegenüber dem ursprünglichen Entwurf zu 118 Änderungen, die sich auf 55 Artikel der Verfassung bezogen. Erstmals trug in Deutschland eine Verfassung die Handschrift des Volkes. Buchstaben und Geist der Verfassung war das Ergebnis ihres Wollens und ihres staatsbürgerlichen Engagements. Die in den 70er Jahren vorgenommenen Veränderungen der Verfassung und anderer Elemente des politischen Systems der DDR führten später zu wachsender Differenz zwischen Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit und zur Reduzierung der Möglichkeit und der Bereitschaft zur Mitwirkung bei der Lösung gesellschaftlicher und staatlicher Aufgaben. Du hast dem Strategischen Arbeitskreis angehört, der in den 60er Jahren auf Initiative Ulbrichts beim Politbüro der SED gebildet worden war. Wer war dort drin, was hatte er für eine Funktion? Zu meiner Zeit gab es ihn nicht mehr. Der »Strategische Arbeitskreis zur Planung der Strategie der Partei auf den Gebieten der Politik, der Wissenschaft und der Kultur« wurde im Jahr 1966 geschaffen. Ihm gehörten neben 15 Mitgliedern des Politbüros etwa 50 Personen aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens – darunter 15 Universitäts- und Hochschulprofessoren– an. Zu den ersten Aufgaben dieses Gremiums gehörte die gründliche Erörterung essenzieller Entwicklungsprobleme der DDR in Vorbereitung des VII. Parteitages der SED, der im April 1967 stattfinden sollte. Diese Diskussion erfolgte in Arbeitskreisen. Ulbricht verlangte, Probleme und Lösungen offen und schonungslos zu erörtern, und erklärte bestimmt: »Wir brauchen in den Arbeitsgruppen die Mitwirkung der Wissenschaftler und Fachleute, die ausgehend von den realen Tatsachen ihres Gebietes klar und unmissverständlich ihren Standpunkt darlegen, unabhängig davon, ob dieser Standpunkt den Leitern dieses oder jenes staatlichen Organs, die gegebenenfalls der gleichen Arbeitsgruppe angehören, gefällt oder nicht gefällt.«[38] Für den Fall, dass in den Arbeitsgruppen keine Einigung erreicht werden sollte, forderte er, die verschiedenen Varianten dem Plenum zur Beratung zuzuweisen. Dieses Herangehen reflektierte den Arbeitsstil von Walter Ulbricht bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben an der Spitze der Partei und als Vorsitzender des Staatsrates. In der ersten Hälfte des Jahres 1971 wurde der Strategische Arbeitskreis ersatzlos aufgelöst. Das war ein Bestandteil der veränderten Strategie, die auf dem VII. Parteitag der SED beschlossen wurde. Ursachen und Hintergründe dieser Veränderung werden von Beteiligten und Historikern unterschiedlich interpretiert. Meine Erinnerungen verweisen darauf: In Moskau hatte sich mit dem Wechsel von Chruschtschow zu Breshnew im Oktober 1964 der Wind ganz offensichtlich gedreht. Die frühere Auffassung, dass Systemänderungen zu riskant wären und darum am Bestehenden festgehalten werden müsse, gewann wieder an Bedeutung. Zunehmend drängte Moskau darauf, dass die politischen Strukturen aller sozialistischen Länder identisch sein müssten mit denen des politischen und ökonomischen Systems der UdSSR. Die Leninsche Konzeption der unterschiedlichen nationalen Wege und Methoden beim Aufbau des Sozialismus, die der XX. Parteitag neuerlich postuliert hatte, wurde in Zweifel gezogen und praktisch revidiert. Auf diese Weise wurde das Wesen der in der Ära Breshnew um sich greifenden Stagnation in die anderen Staaten des RGW übertragen. Fehlentscheidungen der nationalen Führungen der sozialistischen Länder Europas verstärkten die erkennbar wachsenden Defizite bei der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Gegner des Sozialismus erkannten ihre Chance und nutzten sie mit aller Konsequenz und allen ihnen zu Gebote stehenden politischen, medialen und militärischen Mitteln. Verrat war mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im Spiel. Wir erinnern uns des bitteren Endes!
Alfred Kosing: Der bedeutendste Staatsmann der DDR
Alfred Kosing, Jahrgang 1928, gelernter Maurer, Eintritt in die SED 1946. Studium der Geschichte und der Philosophie in Halle und Berlin, 1960 Promotion (»Über das Wesen der marxistisch-leninistischen Erkenntnistheorie«) und 1964 Habilitation (»Die Theorie der Nation und die nationale Frage in Deutschland«). Von 1951 bis 1964 Dozent und Professor am Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, 1964 Professor an der Karl Marx-Universität Leipzig, von 1969 bis 1971 Lehrstuhlleiter am Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, danach – bis 1990 – dort Bereichsleiter für Dialektischen Materialismus des Institutes für marxistisch-leninistische Philosophie. Kosing lebt in der Türkei und ist publizistisch tätig. Meine Erinnerungen an Walter Ulbricht umfassen den Zeitraum von 1946 bis zu seinem Ableben; sie sind teils direkter, teils indirekter Art und in ihrem Inhalt mitunter auch recht widersprüchlich. Das hängt mit verschiedenen Ursachen zusammen, wie mit der Entwicklung meiner eigenen politischen und theoretischen Erfahrungen und Kenntnisse, mit veränderten geschichtlichen Umständen, aber auch mit wesentlichen Veränderungen in den Auffassungen und dem Wirken Walter Ulbrichts selbst im Verlaufe der Zeit. Da man eine Persönlichkeit und ihr Wirken nur im Kontext der Geschichte verstehen kann, ist in meinen Erinnerungen die Person Walter Ulbricht so untrennbar mit den Zeitumständen und seinem Wirken darin verwoben, dass es mir kaum möglich ist, ein Erinnerungsbild unabhängig von diesen geschichtlichen Bedingungen zu geben. Am 1. April 1944 mit 15 Jahren von der Schulbank als Marinehelfer zum Wehrdienst einberufen und durch die Kriegsereignisse sehr schnell in direkte Kampfhandlungen an der Front geraten, glaubte ich noch, das Vaterland verteidigen zu müssen, bis allmählich die Einsicht reifte, dass dieser Krieg ein sinnloses und verbrecherisches Unternehmen war, das für uns mit einer Katastrophe enden musste. Glücklicherweise überlebend, gelang es mir im April 1945 zu desertieren und ins Zivilleben unterzutauchen. Deprimiert und orientierungslos suchte ich zu begreifen, was die Ursachen dieser verhängnisvollen Entwicklung waren, und wie wir in Deutschland aus dieser Misere herauskommen können. Da an eine Fortsetzung der Schulbildung nicht zu denken war, entschied ich mich, eine Maurerlehre zu beginnen, denn der Aufbau der zerstörten Städte müsste ja in jedem Fall früher oder später erfolgen. In meinem Baubetrieb wurde ich bei der ersten Wahl eines Betriebsrates in dieses Gremium gewählt und geriet so nolens volens in das Feld der politischen Tätigkeit. Da ich als Folge der jahrelangen faschistischen Propaganda – auch in der Schule – voller Vorurteile war und zahlreiche Relikte der ständigen Beeinflussung noch lebendig waren, geriet ich sehr schnell in politische Diskussionen und Auseinandersetzungen mit älteren Gewerkschaftern und auch Mitgliedern der KPD und der SPD. Ich musste dabei erkennen, wie wenig ich über die deutsche Geschichte wusste, und vor allem, dass ich keinerlei Kenntnisse über die Geschichte der Arbeiterbewegung und ihren Kampf gegen den Faschismus besaß. Im Verlauf dieser Diskussionen begegnete mir der Name Walter Ulbricht zum ersten Mal, und ich erfuhr, dass er einer der wichtigsten Funktionäre der KPD war, der auch ein Buch (»Die Legende vom deutschen Sozialismus«) geschrieben hatte. Aus diesem Buch lernte ich, was der sogenannte Nationalsozialismus wirklich war, was die wichtigsten Ursachen und die sozialen Grundlagen seiner Entstehung waren und was für eine reaktionäre, nationalistische und rassistische Ideologie und Zielsetzung er vertrat. Walter Ulbricht entlarvte darin die Demagogie des Faschismus überzeugend und wies nach, dass da von Sozialismus überhaupt keine Rede sein konnte. Aus den Gesprächen und Diskussionen mit meinen Arbeitskollegen gewann ich so meine ersten Kenntnisse über die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Wenn sie auch noch sehr bescheiden waren, verstand ich doch bald, dass der Wiederaufbau eines neuen, friedlichen Deutschlands nur gelingen könne, wenn die bisher in KPD und SPD gespaltene Arbeiterbewegung wieder vereinigt würde und sie zusammen mit allen demokratischen Kräften die Gesellschaft gestaltete. Mein Platz für politisches Wirken konnte daher nur die aus der Vereinigung von KPD und SPD hervorgegangene Sozialistische Einheitspartei Deutschlands sein, der ich nach ihrer Gründung beitrat und bis zum Ende der DDR angehörte. Damit war Walter Ulbricht in einem gewissen Sinne ständiger Begleiter meines bewussten Lebens geworden, denn sein politisches Wirken als Generalsekretär oder Erster Sekretär der Partei übte darauf einen ganz erheblichen Einfluss aus. Nun begann ich mit dem intensiven Studium des Marxismus und wurde zu einem aktiven Mitstreiter für die Ideale des Sozialismus. Dabei war ich nicht immer einer Meinung mit Walter Ulbricht und hatte deshalb auch manche Konflikte und Auseinandersetzungen zu bestehen. Die indirekte Bekanntschaft mit Walter Ulbricht wurde nach Studium und dem Beginn meiner Tätigkeit an dem 1951 in Berlin gegründeten Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED auch zu einer direkten. Zwar nahm er an der offiziellen Eröffnung des Instituts wegen anderer Verpflichtungen nicht teil, bekundete aber sein lebhaftes Interesse an der Arbeit und Entwicklung dieser Einrichtung, indem er sie mehrmals besuchte und mit den Mitarbeitern zusammenkam. Ich hatte inzwischen verschiedene Mitglieder der Parteiführung kennengelernt, so die beiden Vorsitzenden Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl, auch Fred Oelßner, Paul Wandel und Kurt Hager. Jeder von ihnen hatte seinen besonderen Charakter, seine Sprache, seine Attitüde und Wirkung. Wie wirkte Walter Ulbricht bei der ersten Begegnung auf mich, den jungen, noch unerfahrenen angehenden Wissenschaftler? Das liegt nun über 60 Jahre zurück, und in meiner Erinnerung ist geblieben, dass er erstens sehr normal wirkte und sich mit uns wie mit Gleichen unterhielt, ohne den über uns stehenden Parteiführer irgendwie spüren zu lassen. Zweitens, dass im Gespräch über unsere Aufgaben im Institut wie auch über aktuelle Fragen seine immense politische Erfahrung und sein theoretisches Wissen deutlich wurden, und drittens, dass er kein hervorragender Redner war wie etwa Otto Grotewohl, der seinen eigenen Stil hatte. Doch seine oft völlig frei gehaltenen Reden, die ich im Lauf der Zeit hörte, waren inhaltlich immer sehr klar, gut argumentierend und von logischer Stringenz, und das war letztlich wichtiger als die dialektgefärbte Aussprache. Persönlich hatte ich mit Ulbricht im Laufe der Zeit mehrmals direkt zu tun, und zwar aus verschiedenen Anlässen. Der eine hing mit seinem Interesse an dem Buch »Weltall – Erde – Mensch« zusammen, das Anfang der 60er Jahre von einer größeren Zahl von Wissenschaftlern speziell für die Teilnehmer der Jugendweihe geschrieben wurde, welche es als Geschenk erhielten. Die Jugendweihe war eine alte Tradition der deutschen Arbeiterbewegung, die auch Walter Ulbricht aus seiner sozialdemokratischen Jugendzeit kannte. Daher interessierte er sich für das Manuskript des Buches und machte Vorschläge zu seiner Verbesserung, weil er fand, dass die sehr guten einzelnen Beiträge zu isoliert aufeinander folgten, ohne die Erkenntnisse und Ergebnisse der verschiedenen Wissenschaften zu einem philosophisch verallgemeinernden Weltbild zusammenzuführen. Er beauftragte Kurt Hager,[Anmerkung 14] einen Autor für ein solches Einleitungskapitel zu finden, um das Buch gewissermaßen abzurunden. Hager rief mich in sein Büro, erklärte mir Ulbrichts Idee und bat mich, dieses Kapitel möglichst schnell zu schreiben. Nach einer Woche lieferte ich das Manuskript ab, und wenige Tage später sollte ich erneut zu ihm kommen. Hager gab mir mein Manuskript, das mit zahlreichen handschriftlichen Bemerkungen versehen war, und sagte, dass Walter Ulbricht es gut finde, aber noch einige Vorschläge habe. Ich solle mir seine Notizen auf dem Manuskript ansehen und dann überlegen, was ich davon noch berücksichtigen könne. Bei der Überarbeitung und Endfassung des Textes konnte ich manche Anregung Ulbrichts durchaus verwenden. Jedenfalls fand ich es bemerkenswert, dass sich der Erste Sekretär des ZK mit einem solchen Buch beschäftigte und dazu noch nützliche Vorschläge machte. Eine weitere Gelegenheit zu einer persönlichen Begegnung ergab sich zu seinem 70. Geburtstag 1963. Da wir am Institut für Gesellschaftswissenschaften wussten, dass Ulbricht sich in letzter Zeit sehr viel mit der Frage beschäftigte, welche Rolle die wissenschaftlich technische Revolution beim weiteren Aufbau der sozialistischen Gesellschaft spielen müsse und welche Konsequenzen sich daraus sowohl für das theoretische Verständnis des Sozialismus als auch für die praktische Politik in der DDR ergeben, waren wir auf die Idee gekommen, zu diesem Thema eine wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, die unter dem Titel »Sozialismus – Wissenschaft Produktivkraft« einige philosophische, ökonomische, und soziale Probleme dieses großen Komplexes untersuchte. Die drei verantwortlichen Redakteure des Buches – Otto Reinhold, Günter Heyden und ich – besuchten den Jubilar am Geburtstag und überreichten ihm die Arbeit. Ansonsten beziehen sich meine Erinnerungen an Walter Ulbricht in erster Linie darauf, wie ich seine Tätigkeit als Erster Sekretär des ZK der SED persönlich erlebte, welche Auswirkungen seine in Reden und Veröffentlichungen dargestellten Auffassungen und die entsprechenden Orientierungen, Aufgabenstellungen und Bewertungen des Entwicklungsstandes der DDR auf mein Denken und Handeln hatten. Diese stießen durchaus nicht immer auf kritiklose Zustimmung, und es gab Zeiträume, in denen ich – bei aller Anerkennung seiner Leistungen – in einer Reihe von Fragen heftige Kritik an seiner Bewertung mancher Ereignisse und an Beschlüssen und Entscheidungen für angebracht hielt. In dem Maße, wie bei mir Erfahrungen und Erkenntnisse wuchsen, begann ich, Auffassungen und Entscheidungen kritisch zu hinterfragen und ihre praktischen Auswirkungen stärker zu beachten, und daraus entstanden mitunter auch erhebliche Konflikte mit Folgen für mich. Wenn ich mich an derartige Situationen und Auseinandersetzungen aus der heutigen Sicht eines 85-Jährigen erinnere, muss ich allerdings zugeben, dass manche meiner im Prinzip berechtigten Kritik insofern einseitig und damit übertrieben war, als sie die seinerzeit vorhandenen objektiven Bedingungen unserer Politik insgesamt, vor allem aber die jeweilige konkrete Situation und die möglichen Handlungsspielräume Walter Ulbrichts in seiner Funktion ungenügend berücksichtigte. Erst später ist mir klar geworden, dass es für eine objektive Beurteilung seiner Haltung und seines Wirkens wichtig ist, nicht nur diese objektiven Bedingungen, sondern auch seinen politischen Werdegang, die bestimmenden Einflüsse und Erfahrungen in seiner langjährigen Tätigkeit und andere subjektive Momente zu beachten. Walter Ulbricht kam wie die meisten Funktionäre der Kommunistischen Partei aus der Sozialdemokratie, in der er bereits aktiv tätig war. Was es für einen jungen revolutionären Sozialisten bedeutete, dass diese Partei August Bebels im August 1914 alle ihre Prinzipien und Beschlüsse mit fadenscheinigen Begründungen einfach verriet, sich auf die Seite der kaiserlich imperialistischen Kriegstreiber stellte und deren Eroberungskrieg als angebliche Vaterlandsverteidigung mitmachte, kann man heute kaum noch nachvollziehen. Und als die Führung der Sozialdemokratie in der revolutionären Krise 1918, in der die Möglichkeit bestanden hätte, die Novemberrevolution zu einer sozialistischen Revolution weiterzuführen, sich dafür entschied, die erlangte politische Macht zu nutzen, um das kapitalistische Gesellschaftssystem zu retten, statt für das über Jahrzehnte verkündete Ziel der sozialistischen Gesellschaft zu kämpfen, war der Verrat dieser Partei an den Idealen des Sozialismus komplett. Den revolutionären sozialistischen Kräften der Sozialdemokratie blieb nur die Möglichkeit, sich von dieser Partei zu trennen und sich selbständig in der Kommunistischen Partei zu organisieren. Doch können wir uns heute vorstellen, was das für das Verhältnis der Mitglieder und Funktionäre dieser beiden Parteien zueinander bedeutete, die so lange in einer gemeinsamen Partei gearbeitet hatten und sich nun, trotz vieler Gemeinsamkeiten in entscheidenden Fragen, als Gegner betrachten mussten? Wie viel Enttäuschung, Verbitterung und manchmal auch Hass musste bei denen entstehen, die sich verraten und betrogen fühlten? Und wie reagierten die »Verräter am Sozialismus« in der Führung einer sich sozialistisch nennenden Partei auf diese Situation? Trieb ihr schlechtes Gewissen sie nicht oft genug dazu, die »Abtrünnigen« zu verdächtigen, herabzusetzen und zu diskriminieren? Mussten sie nicht, um ihr Gesicht auch gegenüber der Masse der Mitglieder der Sozialdemokratie zu wahren, in Worten weiterhin für den Sozialismus eintreten und damit auch ihre eigenen Mitglieder täuschen und betrügen? Warum schufen sie denn eine »Sozialisierungskommission« und verkündeten, dass die »Sozialisierung marschiert«, während sie gleichzeitig alles taten, um den Kapitalismus zu erhalten? Was wusste ein ganz junger Sozialist im Jahre 1946 davon? Und wie sollte er verstehen, weshalb Stalin, der ab 1925 in der Kommunistischen Internationale eine größere Rolle zu spielen begann, zu der Auffassung gelangte, dass die Sozialdemokratie der Hauptfeind der kommunistischen Partei sei und später sogar die absurde These vom »Sozialfaschismus« vertrat und die Sozialdemokratie als eine Art Zwillingsbruder des Faschismus diffamierte? Es war und ist nicht schwer zu begreifen, dass deutsche Kommunisten, die aus der Sozialdemokratie kamen, angesichts des Verhaltens dieser Partei dafür anfällig sein konnten, diese falschen und politisch schädlichen Auffassungen mehr oder weniger anzunehmen und ihnen zeitweilig zu folgen. Diese Geschichte darf man nicht vergessen, wenn man beurteilen will, was es für kommunistische Funktionäre wie Wilhelm Pieck, Franz Dahlem, Anton Ackermann, Hermann Matern und natürlich auch für Walter Ulbricht 1945 bedeutete, den notwendigen Weg für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Kommunisten und Sozialdemokraten zu ebnen, eine Annäherung zu ermöglichen und die Vereinigung zu einer einheitlichen sozialistischen Partei zu erreichen. Das verlangte die kritische und selbstkritische Prüfung und Überwindung auch der eigenen Fehler und die Bereitschaft, Vorurteile und einseitige Bewertungen aufzugeben und auch eine Verständigung über die vergangene Geschichte zu suchen. Dafür waren durch die Erfahrung des Faschismus und die Befreiung Deutschlands günstige Bedingungen entstanden, die es von beiden Seiten zu nutzen galt. Ulbricht hatte zweifellos einen entscheidenden Anteil daran, dass es gelang, diese Chance zu nutzen und gemeinsam mit zahlreichen sozialdemokratischen Funktionären, die aus der Geschichte die richtigen Lehren gezogen hatten, etwa Otto Grotewohl, Otto Buchwitz, Max Fechner und Erich Mückenberger, das Fundament für die Gründung der SED zu legen. Diesen komplizierten Prozess konnte ich 1945/46 im Bereich des kleinen Kreises Blankenburg/Harz mit großer Aufmerksamkeit und auch in Kontakt und Diskussion mit Funktionären beider Parteien verfolgen. Dabei lernte ich viele Aspekte unterschiedlicher Auffassungen aus der früheren Geschichte der Parteien kennen und gewann so einen sehr lebendigen Eindruck von der großen Begeisterung, die viele erfasst hatte, von dem ehrlichen Bestreben, die Fehler der Vergangenheit auszumerzen, aber auch von manchen Schwierigkeiten der Verständigung, weil es erklärlicherweise noch ideologische und psychologische Relikte der früheren Geschichte gab. Daher konnte ich mir eine ungefähre Vorstellung davon machen, was sich auf den höheren Ebenen bis hin zu den Führungen beider Parteien in den Diskussionen über die Vereinigung und über die Formulierung der »Grundsätze und Ziele der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands« abspielen musste. Ulbricht wurde auf dem Gründungsparteitag der SED in die Führung gewählt, und das war offenbar einerseits die Anerkennung für seinen enormen Beitrag zu diesem Vereinigungswerk und anderseits auch ein Ausdruck der Erwartung, dass er die Politik der Partei in entscheidender Weise mitbestimmen werde. Wenn ich heute über diese Periode unserer Geschichte nachdenke, sehe ich das Wirken und die Verdienste Walter Ulbrichts klarer als in der Vergangenheit, da auch meine Urteile oft zu stark von einer bestimmten Situation abhängig waren. In unserer insgesamt sehr schwierigen Geschichte gab es einige Perioden und Ereignisse von ganz besonderer Bedeutung, sei es, dass sehr kritische Situationen entstanden waren wie 1953 und 1956, oder dass ein Wendepunkt erreicht war, an dem grundsätzliche Entscheidungen und Weichenstellungen erforderlich wurden wie etwa 1962/63. Das waren Zeiten, in denen ich mich besonders intensiv darum bemühte, die Politik der Partei und die entsprechenden Beschlüsse der Führung theoretisch zu hinterfragen, sie nicht einfach hinzunehmen, sondern ihre Begründung zu verstehen, zu prüfen, ob sie wirklich mit den Prinzipien und Erkenntnissen des Marxismus und den vorhandenen Erfahrungen in Einklang standen. Da Walter Ulbricht als Erster Sekretär des ZK die politische Linie der Partei offiziell vertrat, bedeutete dies, dass ich mich vor allem mit seinen Reden, seinen Veröffentlichungen und Bewertungen befasste und öfter auch kritisch auseinandersetzte, wobei ich mitunter nicht nur in Verständnisschwierigkeiten, sondern auch in Konflikte geriet. Im Oktober 1952 hatte in Moskau der XIX. Parteitag der KPdSU getagt, der erste Parteitag nach 1939 und der letzte unter Stalin. Die Führung der SED hatte auf der 2. Parteikonferenz im Juli 1952 beschlossen, in der DDR mit dem Aufbau der Grundlagen des Sozialismus zu beginnen, nachdem durch die vorangegangene ökonomische, soziale und politische Entwicklung die Voraussetzungen entstanden waren, in die Übergangsperiode zum Sozialismus einzutreten. Natürlich war klar, dass eine solche Entscheidung nicht ohne Zustimmung der Führung der KPdSU, und das bedeutet auch Stalins, erfolgen konnte, denn die DDR war noch lange kein souveräner Staat, es gab noch die Sowjetische Kontrollkommision und den Hohen Kommissar für Deutschland, Instanzen, welche eine übergeordnete Entscheidungskompetenz besaßen. Wie wir heute aus den entsprechenden Dokumenten wissen, war Stalin längere Zeit an der Entwicklung einer sozialistischen DDR interessiert, denn er hielt noch lange an der Option fest, welche die Alliierten 1945 in Potsdam beschlossen hatten. Danach sollte Deutschland vollständig entmilitarisiert werden und sich dann als einheitlicher friedlicher und demokratischer Staat entwickeln, in dem alle Grundlagen und Überreste des Faschismus beseitigt sind und dessen Mitgliedschaft in Militärbündnissen ausgeschlossen war. Doch diese gemeinsame Festlegung der Alliierten war von Churchill faktisch durch seine antisowjetische Brandrede in Fulton im Februar 1946 aufgekündigt worden, in der er die USA aufforderte, gemeinsam mit den anderen imperialistischen Staaten eine Politik des containments gegen die Sowjetunion und ihren Einfluss in Europa zu beginnen. Er wurde so zum Initiator des Kalten Krieges und plante von Beginn an, die westlichen Besatzungszonen Deutschlands mit ihrem ökonomischen und später auch militärischen Potenzial in diese neue antisowjetische Koalition einzubeziehen. Die sowjetische Außenpolitik unter Stalin war seit diesem Zeitpunkt vor allem darauf gerichtet, die in Potsdam beschlossene Friedensordnung durchzusetzen, und dabei stand ihr Sicherheitsinteresse verständlicherweise an erster Stelle. Obwohl der von Churchill inspirierte und vom amerikanischen Präsidenten Truman organisierte Kalte Krieg bereits voll entbrannt war und durch die Einführung einer separaten Währung in den Westzonen und die Gründung eines westdeutschen Separatstaates die Spaltung Deutschlands faktisch vollzogen war, versuchte Stalin bis zuletzt, diesen Prozess aufzuhalten und schlug daher in der Note vom März 1952 sowohl den Westmächten als auch der Regierung der BRD vor, die europäische Friedensordnung in einem formellen Friedensvertrag zu verankern und dabei die Einheit Deutschlands durch gesamtdeutsche freie Wahlen wiederherzustellen. Dieser Vorschlag wurde von den Westmächten und ganz besonders heftig von Adenauer abgelehnt, obwohl damit zweifellos die Chance für die Wiederherstellung eines einheitlichen deutschen Staates auf kapitalistischer Grundlage verbunden war. So war endgültig klar geworden, dass die Westmächte mit dem inzwischen in ihren Kalten Krieg integrierten westdeutschen Staat nicht gewillt waren, die Potsdamer Beschlüsse einzuhalten und zu verwirklichen, dass sie statt der vereinbarten Friedensordnung die Konfrontation des Kalten Krieges mit der Gefahr der Entstehung einer militärischen Auseinandersetzung zur Grundlinie ihrer Politik erklärten. Dies hatte erhebliche Konsequenzen nicht nur für die internationalen Beziehungen, sondern auch für die Entwicklung in Deutschland. Nach der Ablehnung der Vorschläge Stalins über den Friedensvertrag stand damit auch die Frage auf der Tagesordnung, wie die weitere Entwicklung der DDR verlaufen solle, denn ein Schwebezustand zwischen Kapitalismus und Sozialismus, wie er sich in den letzten Jahren herausgebildet hatte, war nicht auf unbegrenzte Zeit möglich. Daher war nun der Punkt erreicht, an dem eine Entscheidung über die weitere ökonomische, soziale und politische Entwicklung der DDR erforderlich wurde. Die Frage, ob dieser Schritt von der Führung der SED vorgeschlagen wurde oder von der Moskauer Führung ausging, war mir damals nicht klar, und ich weiß es auch heute nicht. Doch vermute ich, dass die Initiative dazu von Walter Ulbricht ausging, der sich in der Führung der SED stets am intensivsten mit allen Aspekten dieser komplexen Problematik beschäftigte. Seine Ausführungen auf der 2. Parteikonferenz der SED waren m. E. durchaus begründet und überzeugend, und die danach eingeleitete Politik des Übergangs zum Aufbau der Grundlagen des Sozialismus verlief zunächst insgesamt in relativ ruhigen Bahnen, zumal es auch gelungen war, die Unterstützung der entscheidenden Kräfte der anderen Parteien der DDR zu gewinnen. Eine merkliche Veränderung setzte aber nach dem IXX. Parteitag der KPdSU ein, und diese führte zu erheblichen Verschlechterungen der Lebenslage vieler Schichten der Bevölkerung. Es erfolgte eine starke Konzentration der ökonomischen und finanziellen Ressourcen auf die beschleunigte Entwicklung der Schwerindustrie, was zur Beeinträchtigung der für die Versorgung mit Konsumgütern und Lebensmitteln wichtigen Leichtindustrie und der Landwirtschaft führen musste. Der Versuch, die dadurch entstehenden Engpässe durch restriktive Maßnahmen gegenüber ganzen Bevölkerungsschichten zu überwinden, musste scheitern und führte in der Konsequenz zu einer zunehmenden Unzufriedenheit. Diese bildete wiederum einen günstigen Boden für die von westlichen Geheimdiensten und anderen Organisationen aktiv betriebenen Aktionen, die darauf gerichtet waren, die DDR zu destabilisieren und Bedingungen für einen politischen Umsturz zu schaffen, oder, wie es seitens der Regierung der BRD hieß: die »sowjetische Zone zu befreien«. In der ersten Hälfte des Jahres 1953 zeichnete sich als Folge dieser negativen Entwicklung immer mehr eine kritische Situation ab. Ich konnte mir die Frage nach den Ursachen der Entscheidungen, die zu derart negativen Konsequenzen führten, damals nicht erklären, und noch weniger die passive Haltung der Führung. Als dann am 9. Juni 1953 im Neuen Deutschland ein Kommuniqué des Politbüros der SED veröffentlicht wurde, welches in dürren Worten mitteilte, dass die Parteiführung in letzter Zeit schwerwiegende Fehler begangen habe, die nun korrigiert werden, führte das nicht nur zu einer starken Irritation innerhalb der Partei, sondern gab den Organisatoren von Demonstrationen und Unruhen wohl auch das Signal zum Losschlagen. So kam es zu den Ereignissen des 17. Juni 1953, über deren Charakter seither sehr verschiedene Versionen im Umlauf sind– von Volksaufstand bis faschistischer Putsch, was m. E. beides unbegründet ist. Die Parteiführung war auf die Ereignisse offensichtlich nicht vorbereitet und wurde davon nicht nur überrascht, sondern erwies sich auch weitgehend als handlungsunfähig. Mir war das damals völlig unverständlich, und ich war der Meinung, dass sie in dieser bedrohlichen Situation versagt habe. Zu einer Diskussion dieser Frage ist es innerhalb der Partei aber niemals gekommen, und welche Auseinandersetzungen in der Führung darüber stattgefunden haben, wurde niemals publik. Daher konnte ich mir auch kein Bild davon machen, welche Haltung Walter Ulbricht in jenen Tagen hatte und welche Rolle er dabei spielte. Die Tatsache, dass auf der nächsten Tagung des ZK der Minister für Staatssicherheit Wilhelm Zaisser und der Chefredakteur des Neuen Deutschland Rudolf Herrnstadt aus dem Politbüro sowie weitere Funktionäre aus dem ZK ausgeschlossen wurden, zeigte allerdings, dass es große Auseinandersetzungen gegeben haben musste. Viele Hintergründe aber blieben unbekannt und kamen erst nach dem Ende der DDR ans Tageslicht, erst da wurden mir bislang unverständliche Vorgänge und auch die damalige Haltung Ulbrichts verständlicher. Hatten Stalin und die sowjetische Führung schon seit längerem die Befürchtung, dass die imperialistischen Mächte mit den USA an der Spitze einen militärischen Angriff auf die Sowjetunion vorbereiten, so folgerte Stalin wohl nach der Ablehnung seines Vorschlags zum Abschluss eines Friedensvertrages, dass ein Angriff bereits in nächster Zeit zu erwarten sei. Deshalb wurde auf dem IXX. Parteitag der KPdSU die gesamte Politik darauf orientiert, sich auf die Verteidigung vorzubereiten. Entsprechende Forderungen wurden auch an die verbündeten Länder der im Entstehen begriffenen sozialistischen Staatengemeinschaft gestellt, die infolgedessen gezwungen waren, vor allem ihre ökonomische Politik diesem Ziel unterzuordnen. Dies führte in der DDR Ende 1952, Anfang 1953 zu großen Schwierigkeiten, was eine innenpolitische Destabilisierung zur Folge hatte. Hinzu kam: Anfang März 1953 war Stalin verstorben und im Politbüro der KPdSU ein erbitterter Machtkampf zwischen rivalisierenden Gruppen entbrannt. Wie es schien, hatte Berija zunächst die größten Aussichten, die Nachfolge Stalins anzutreten. Abgesehen davon, dass er wohl das größte Vertrauen Stalins besessen hatte, da er seit 1938 der Exekutor aller gesetzwidrigen und verbrecherischen Anordnungen Stalins war, häufig auch deren Initiator, verfügte er als Innenminister auch über eine reale Macht in Gestalt der Truppen des Innenministeriums. In der ersten Zeit nach Stalins Tod muss Berija wohl zusammen mit Malenkow, der damals Regierungschef war, die entscheidende Rolle im Politbüro gespielt haben, denn es gelang ihm, den Beschluss durchzusetzen, dass der Aufbau des Sozialismus in der DDR sofort zu beenden und Kurs auf eine Politik der Wiedervereinigung zu nehmen sei. Offenbar war er gewillt, die DDR zu opfern, um damit eventuell die Gefahr des militärischen Angriffs seitens der imperialistischen Mächte zu bannen. Walter Ulbricht, Fred Oelßner und Otto Grotewohl wurden Anfang Juni 1953 nach Moskau beordert und gezwungen, dieser Lösung zuzustimmen und entsprechende Anweisungen sofort telegrafisch an Hermann Axen nach Berlin zu übermitteln, der in Ulbrichts Abwesenheit das Sekretariat des ZK leitete. Vor dem Hintergrund dieser Vorgänge wird verständlich, in welcher Lage sich damals die Führung der SED befand, weshalb es in ihr keine einheitliche Meinung gab und sie infolgedessen auch weitgehend handlungsunfähig war. Inzwischen war im Machtkampf innerhalb des Politbüros der KPdSU eine Entscheidung gefallen, welche die Situation wieder veränderte. Berija war entmachtet und verhaftet und Chruschtschow zum Ersten Sekretär des ZK gewählt worden. Der Beschluss über die DDR wurde aufgehoben, und so konnte die auf der 2. Parteikonferenz der SED beschlossene Linie, mit dem Aufbau der Grundlagen des Sozialismus zu beginnen, fortgeführt werden. Auf der danach abgehaltenen Tagung des ZK der SED wurde Generalsekretär Walter Ulbricht zum Ersten Sekretär gewählt. Er begründete in seiner Rede die Politik des »Neuen Kurses«, der eine Korrektur der zuvor offenbar unter sowjetischem Druck erfolgten Maßnahmen vorsah und darüber hinaus zahlreiche konstruktive Schritte, die zur Normalisierung der Lage führten. Wenn auch die Hintergründe der kritischen Ereignisse nicht öffentlich diskutiert werden konnten – was angesichts der Lage in der sowjetischen Führung ausgeschlossen war –, so zeigten die konstruktiven Vorschläge Walter Ulbrichts, die dann auch auf dem IV. Parteitag im Frühjahr 1954 bestätigt wurden, dass er sich in dieser äußerst schwierigen Situation als der fähigste und stärkste Politiker in der Führung der SED erwies. Auch deshalb, weil er in der Lage war, die erforderlichen Konsequenzen aus den begangenen Fehlern zu ziehen. Wenn ich damals auch nicht damit zufrieden war, dass die Ursachen der zeitweiligen negativen Entwicklung übergangen wurden, hielt ich den mit dem »Neuen Kurs« eingeschlagenen Weg für richtig, und meine Haltung gegenüber Walter Ulbricht war in erster Linie davon bestimmt – und nicht von der Kritik an der fehlenden Aufklärung. Nach den Kenntnissen, die wir heute über die Vorgänge besitzen, ist mir natürlich klar, weshalb es damals wenig Nutzen gehabt hätte, eine umfangreiche öffentliche Ursachendiskussion zu führen. Eine weitere kritische Phase in der Entwicklung der DDR entstand im Jahre 1956 nach dem XX. Parteitag der KPdSU. Chruschtschow war es nach der Entmachtung und Verhaftung Berijas der ganz in der Manier der Stalinschen Terrorprozesse in einem Verfahren als »Agent des Imperialismus« verurteilt und erschossen worden war – gelungen, seine Machtposition zu festigen, auch wenn sie bald wieder durch eine Mehrheit im Politbüro, die von Molotow, Kaganowitsch und Malenkow angeführt wurde, ernsthaft bedroht wurde. Diese drei gehörten einst zu den engsten Mitarbeitern Stalins und waren in erheblichem Maße auch an seinen gesetzwidrigen und verbrecherischen Aktionen beteiligt. Da sie die Aufdeckung ihrer Mitschuld befürchteten, hatten sie mit ihrer Mehrheit im Politbüro bereits beschlossen, Chruschtschow wieder abzulösen. Doch das von diesem eilig zusammengerufene Zentralkomitee verhinderte diese Absicht, und nun wurde diese Gruppe ihrerseits als eine »parteifeindliche Fraktion« ausgeschlossen. Aber Chruschtschow stieß mit seiner Politik der vorsichtigen Entstalinisierung in Funktionärskreisen trotzdem auf großen Widerstand, denn die Freilassung vieler unschuldig Verurteilter, die Rehabilitierung ausgeschlossener und verurteilter Partei- und Staatsfunktionäre, die Auflösung von Straflagern und andere Maßnahmen führten mehr und mehr zu öffentlichen Diskussionen auch in der Bevölkerung. Daher sah er sich zu einem größeren Befreiungsschlag genötigt, um den Widerstand der orthodox stalinistischen Kräfte in der Partei, im Staat und in der Gesellschaft zu brechen. Das erfolgte in der »Geheimrede«, die von ihm in einer geschlossenen Sitzung des XX. Parteitages gehalten wurde. Darin deckte er für alle völlig überraschend in einer wenig durchdachten Weise die zahlreichen Willkürakte, Terrorkampagnen und verbrecherischen Handlungen Stalins und seiner Helfershelfer Jagoda, Jeshow und Berija auf. Er erklärte, dass diese nur möglich gewesen seien, weil Stalin sich im Laufe der Zeit eine absolute diktatorische Macht angeeignet hatte und alle wichtigen Entscheidungen selbstherrlich traf, wobei die gewählten Organe wie das Zentralkomitee und auch das Politbüro und seine Mitglieder zu lediglich ausführenden Organen degradiert wurden. Chruschtschow bezeichnete diesen unerträglichen Zustand, der zu schwerwiegenden Folgen für die Partei, den Staat und die sozialistische Gesellschaft geführt hatte, als »Personenkult«, den er scharf als unmarxistisch verurteilte und für diese Entartungserscheinungen verantwortlich machte. Die Delegierten des Parteitages und auch die Delegationen ausländischer Parteien, die an der Tagung teilnahmen, darunter auch eine Abordnung der SED mit Walter Ulbricht, waren von der Wucht und der Schärfe dieser Anklagen regelrecht erschüttert und mussten um Fassung ringen. Eine Diskussion fand nicht statt, und der volle Wortlaut der Rede Chruschtschows wurde nicht veröffentlicht. In den Parteiorganisationen der SED wurde später darüber informiert, indem der Inhalt lediglich zusammenfassend referiert wurde. Im Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED wurde der Lehrkörper durch die Direktorin Lene Berg informiert, allerdings berichtete sie über die Willkürakte und Verbrechen Stalins in einer sehr oberflächlichen und häufig entschuldigenden und beschönigenden Weise. Es war ihr anzumerken, wie betroffen und ratlos sie angesichts dieser brutalen Enthüllungen war. Eine Diskussion fand nicht statt, aber ich hatte danach ein Gespräch unter vier Augen mit ihr, in dem ich ihr Vorgehen kritisierte und ihr vorwarf, dass sie uns wie kleine Kinder behandele, denen man unangenehme und belastende Dinge vorenthalten müsse. Das sei nicht nur überflüssig, sondern auch schädlich, da wir die Wahrheit früher oder später ohnehin erfahren würden. Diese Gelegenheit ergab sich nach einiger Zeit auch, denn in der westlichen Presse wurde die Rede Chruschtschows sehr bald veröffentlicht. Wahrscheinlich ist der Text aus Polen übermittelt worden und gelangte auf diesem Weg in die Medien. So konnte ich bald eine deutsche und auch eine englische Übersetzung der Rede lesen, und kam entgegen der bei uns längere Zeit verbreiteten Version, dass es sich dabei um eine »imperialistische Fälschung« handele –, zu der Auffassung, dass der Text authentisch sei. Die Rede Chruschtschows war in der Tat aufwühlend, wenn ich auch nicht mehr ganz unvorbereitet war, denn in verschiedenen sowjetischen Veröffentlichungen, die ich sehr aufmerksam verfolgte, kündigte sich die Entstalinisierung bereits an. So bemerkte ich schon in den Thesen »Fünfzig Jahre KPdSU« vom Herbst 1953 eine gewisse Distanzierung von Stalin und dem Personenkult um ihn. Aber das Ausmaß der Verbrechen Stalins und seiner Helfer war wirklich erschreckend und warf sofort die Frage auf, ob das alles lediglich durch negative Charaktereigenschaften Stalins und den Kult um ihn erklärt werden könne. Eine solche Erklärung führt doch– wie ich dachte – direkt zu einer idealistischen Geschichtsauffassung, die mit dem Marxismus unvereinbar war. Auf welchen sozialen Grundlagen und Strukturen und mittels welcher Funktionsmechanismen der Partei und des Staates konnten derartige Deformationen und Entar tungserscheinungen in einer sozialistischen Gesellschaft entstehen? Die Anprangerung und die Verurteilung verbrecherischer Handlungen einer einzelnen Führungsperson konnten eine historisch-materialistische Analyse der objektiven gesellschaftlichen, politischen und ideologischen Bedingungen, auf deren Boden derartige Auswüchse möglich wurden, nicht ersetzen, ganz abgesehen davon, dass zur Ausführung aller inkriminierten Taten immer eine große Zahl von Mitwirkenden und von exekutiven Apparaten erforderlich war. Ich sah daher in der Rede Chruschtschows und in der Theorie vom Personenkult einerseits einen Versuch, sich von Stalin und dem stalinistischen System in einem gewissen Umfang zu distanzieren, zugleich aber auch eine weitgehende Rechtfertigung und Verharmlosung, womit ich mich absolut nicht einverstanden erklären konnte. Wenngleich ich mit meiner Auffassung im Institut auch ziemlich allein stand, gab es innerhalb der Partei und vor allem unter Intellektuellen doch leidenschaftliche Diskussionen über diese Probleme, und viele Auffassungen gingen in die gleiche Richtung. In meiner Haltung wurde ich durch ein Interview Palmiro Togliattis bestärkt, der die sowjetische Führung sehr nachdrücklich aufforderte, im Sinne eines marxistischen Herangehens die objektiven gesellschaftlichen und politischen Grundlagen dieser Entartungen des Sozialismus zu analysieren und daraus die erforderlichen Konsequenzen zu ziehen. Da der Text der Rede Chruschtschows nicht veröffentlicht wurde, gab das ZK der KPdSU einen Beschluss »Über den Personenkult und seine Folgen« heraus, in dem – ohne Einzelheiten anzuführen im Prinzip die Grundauffassung des Referates wiederholt und die gesamte Verantwortung auf Stalin abgeschoben wurde. Das ZK der SED bezog danach ebenfalls Stellung, indem es die Position der KPdSU übernahm und außerdem erklärte, dass eine Fehlerdiskussion unangebracht sei, weil »Fehler im Vorwärtsschreiten« überwunden werden müssten. Da in der Partei eine beträchtliche Unruhe entstanden war, nahm Walter Ulbricht in einer Rede zu einigen Fragen Stellung, verschärfte aber damit die Situation noch mehr. Denn er versuchte ebenfalls, die Tragweite der Probleme herunterzuspielen und beging die Ungeschicklichkeit, die »jungen Genossen, die Stalin für einen Klassiker des Marxismus-Leninismus gehalten hatten«, zu belehren, dass sie sich damit geirrt hätten und ihre Auffassung ändern müssten. Ich kann nicht verhehlen, dass mich diese kaltschnäuzige Art empörte und ich die Frage stellte, wer denn den jungen Genossen beigebracht habe, dass Stalin ein »Klassiker« sei? Sich auf eine derartige Weise aus der Affäre zu ziehen, hielt nicht nur ich für unmöglich, und es gab deshalb ziemlich starke Proteste. Diese zeitigten ihre Wirkung, denn Walter Ulbricht schrieb diese Passage seiner Rede, die so im Neuen Deutschland gestanden hatte, für eine Buchveröffentlichung um und korrigierte sich damit. Ich glaubte nicht, dass einem so erfahrenen Politiker ein derartiger Fauxpas einfach nachgesehen werden könne, aber später habe ich verstanden, dass dieser sehr wahrscheinlich einer großen Verunsicherung und auch einer gewissen Ratlosigkeit entsprang, wie mit der prekären Situation umzugehen sei. Denn es war ja nicht nur eine interne Angelegenheit der kommunistischen und sozialistischen Parteien, sondern hatte auch enorme internationale Auswirkungen. Für alle Gegner des Sozialismus waren die Enthüllungen Chruschtschows ein gefundenes Fressen, eine willkommene Gelegenheit, den ideologischen und psychologischen Kampf gegen den Sozialismus mit aller Kraft zu verstärken und die unvermeidlich entstehende Instabilität in einigen sozialistischen Ländern zu nutzen, um nach Möglichkeit konterrevolutionäre Bestrebungen zu unterstützen und zu organisieren. Außerordentlich schwierige Situationen entstanden im Sommer und Herbst 1956 in Polen und Ungarn, deren Beurteilung nicht einfach war. Die polnische Partei befand sich aus mehreren Gründen in einer äußerst misslichen Lage, denn sie hatte unter dem Stalinschen Terror sehr stark zu leiden gehabt. Die gesamte Führung der Kommunistischen Partei Polens war 1938 als angeblich trotzkistisch verseucht liquidiert worden, das zweifelhafte Schicksal der 1939 in Katyn ermordeten Offiziere der polnischen Armee lastete ebenfalls schwer auf dem Verhältnis zur Sowjetunion. Hinzu kam die aus der früheren Geschichte stammende traditionell antirussische Stimmung in weiten Bevölkerungskreisen, die durch die spürbare Abhängigkeit des neuen Polens von der Sowjetunion ebenfalls gestärkt wurde. Als ich 1955 in Warschau weilte, berichteten mir einige Genossen erschüttert, dass sie die Wahrheit über den Tod der führenden Funktionäre der Kommunistischen Partei erst jetzt erfahren hatten. Die im Sommer und Herbst 1956 entstandene äußerst kritische Situation war von der Führung der PVAP unter Edward Ochab kaum zu meistern. Das ZK der Partei beschloss nach einer gründlichen Beratung, den früheren Generalsekretär der Partei, Wladislaw Gomulka, zum Ersten Sekretär zu wählen, nachdem dieser fünf Jahre zuvor wegen angeblich nationalistischer Abweichungen auf sowjetischen Druck ausgeschlossen und inhaftiert worden war. Dies war m. E. eine mutige und vernünftige Entscheidung, da Gomulka seinerzeit die größte politische und moralische Autorität in Polen besaß. Im Licht der weiteren Entwicklung von 1956 bis zum Ende der DDR und auch meiner eigenen politischen Erfahrungen muss ich allerdings sagen, dass meine Kritik an Ulbrichts Umgang mit dem XX. Parteitag der KPdSU und seinen Folgen zwar richtigen theoretischen Erwägungen entsprang und auch in politischer Hinsicht berechtigt war, weil dadurch Unsicherheit und Verwirrung in der Partei nicht vermieden, sondern vergrößert wurde. Es hätte sicher besser durchdachte Möglichkeiten der Aufklärung über Chruschtschows Rede gegeben, ohne großen Schaden anzurichten. Das hätte aber vorausgesetzt, zumindest in bestimmten Gremien eine offene und ehrliche Diskussion zu führen, um die Linie und die entsprechenden Maßnahmen festzulegen. Doch war die Führung dazu damals nicht in der Lage, weil sie von den Ereignissen einfach überrollt wurde, keine einheitliche Auffassung besaß und in Anbetracht durchaus realer Gefahren mitunter auch hektisch reagierte. Andererseits ist mir später auch klar geworden, dass Ulbricht angesichts der Abhängigkeit von der Sowjetunion und der Erfahrungen von 1953 im Umgang der Führung der KPdSU mit der DDR gar keine andere Möglichkeit hatte, als dem Beschluss des ZK der KPdSU über den Personenkult und seine Folgen offiziell zuzustimmen. Die SED war damals gewiss die letzte Partei, die es wagen konnte, der KPdSU entgegenzutreten und Forderungen an sie zu richten – ganz unabhängig davon, was Ulbricht persönlich über diesen Beschluss und auch das Referat Chruschtschows gedacht haben mag. Eine große öffentliche Diskussion über alle damit verbundenen Fragen hätte abgesehen von den möglichen Folgen für die innere Stabilität der DDR unvermeidlich zu einer Konfrontation mit der KPdSU unter Chruschtschow führen müssen. Die SED und die DDR aber brauchten zu jener Zeit nichts dringender als die Unterstützung durch Chruschtschow und die Sowjetunion. Bei der Abwägung, was für den Erhalt der DDR lebenswichtiger war, konnte aus sehr ernsten Gründen nur entschieden werden, die unangenehme Unterdrückung einer breiten Diskussion und aller Bestrebungen, welche die innere Stabilität und Sicherheit der DDR gefährdeten, als kleineres Übel in Kauf zu nehmen. Doch rechtfertigt das m. E. nicht die übertriebene Strafverfolgung einer Reihe von Intellektuellen, die in der Partei häufig die Wortführer kritischer Auffassungen waren und angeblicher konterrevolutionärer Bestrebungen beschuldigt wurden. Ich hielt eine Verurteilung nur in solchen Fällen für berechtigt, in denen eindeutig gegen geltendes Recht und Gesetz verstoßen wurde, und das war meines Wissens nur bei Wolfgang Harich der Fall, der sich dazu verleiten ließ, mit dem Ostbüro der SPD und anderen westdeutschen Institutionen, deren erklärtes Ziel die Beseitigung der DDR war, zu konspirieren und über eine neue Regierung zu verhandeln. (Dies war ihm, nebenbei bemerkt, später durchaus klar, und er erkannte es auch an.) Vergleicht man die Entwicklung der sozialistischen Länder in den Jahren nach dem XX. Parteitag der KPdSU, dann muss man m. E. anerkennen, dass es der Führung der SED unter Walter Ulbricht insgesamt weit besser gelang, die kritische Periode zu überstehen und den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus fortzusetzen und zu vollenden, als solchen Ländern wie Polen und Ungarn. Die DDR befand sich stets in einer komplizierten Lage, die an die politische Führung hohe Anforderungen stellte. Sie war einerseits in sehr starkem Maße von der Sowjetunion abhängig, andererseits war sie ständig mit dem anderen deutschen Staat BRD konfrontiert, dessen erklärtes Staatsziel die Beseitigung der DDR war. Trotzdem bestanden vielfältige Beziehungen, Verflechtungen und Kontakte zwischen den beiden deutschen Staaten und ihren Bürgern, die aus der gemeinsamen Geschichte stammten, weshalb die nationale Problematik stets berücksichtigt werden musste. Ich halte es für einen Beweis der politischen und staatsmännischen Qualitäten Walter Ulbrichts, dass er fähig war, die DDR durch die mit dieser Lage verbundenen Fährnisse zu bringen und dabei zielstrebig die ökonomischen, sozialen, politischen und ideologischen Aufgaben im Blick zu behalten, die in der Übergangsperiode zum Sozialismus zu lösen waren. So gelang es trotz mancher Schwierigkeiten, in der DDR die Grundlagen des Sozialismus zu schaffen, und zu Beginn der 60er Jahre entstand nun die Frage, wie die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft weiter verlaufen sollte. Entsprechend der von Stalin geprägten Sozialismustheorie wäre nach dem Abschluss der Übergangsperiode und dem damit erreichten »Sieg des Sozialismus« der Übergang zum Aufbau des Kommunismus, also der höheren Phase der neuen Gesellschaftformation, als nächste strategische Aufgabe zu stellen. Das hatte Stalin seit dem XVIII. Parteitag 1935 in mehreren Reden ebenso wie auf dem XVIII. Parteitag der KPdSU 1939 erklärt, und dies blieb auch im neuen Parteiprogramm der KPdSU von 1961 unter Chruschtschow die strategische Grundlinie. Denn dort wurde als Aufgabe formuliert, im Verlauf der nächsten zwanzig Jahre die höhere Entwicklungsphase der neuen Gesellschaftsformation, den Kommunismus, im Wesentlichen zu errichten. Dieser Auffassung vom Sozialismus und Kommunismus lag die Annahme zugrunde, dass der Sozialismus lediglich eine kurze Übergangsphase zwischen Kapitalismus und Kommunismus bilde, die keine eigenständige sozialökonomische und politische Qualität aufweise, sondern mehr eine Mischung aus »Muttermalen des Kapitalismus« und »Keimen des Kommunismus« sei. Statt den Sozialismus als gesellschaftliches System in seiner Totalität zu entwickeln, es auf seinen eigenen Grundlagen und entsprechend seinen Gesetzmäßigkeiten weiter zu vervollkommnen, bis es den ökonomischen, sozialen und geistigen Reifegrad erreicht hat, welcher den Übergang in die höhere Phase des Kommunismus ermöglicht, sollte dieses sozialistische Zwischenstadium möglichst schnell durchlaufen werden, damit das große Ziel der kommunistischen Gesellschaft erreicht werde, in der die Klassenunterschiede aufgehoben seien, der Staat abstürbe, materieller Überfluss herrsche und alle Bedingungen für die freie Entfaltung der Individuen bestehen würden. Zweifellos enthielten diese illusorischen Vorstellungen und Zukunftserwartungen auch Elemente des Chiliasmus und der ideellen Flucht aus den Schwierigkeiten und Unzulänglichkeiten der noch unvollkommenen sozialistischen Gesellschaft. Da die Kritik am Personenkult um Stalin dessen theoretische Auffassungen aber noch weitgehend ausklammerte und diese weiter als konstitutive Bestandteile des Marxismus-Leninismus galten, kamen derartige Auffassungen über den bald möglichen Übergang zum Kommunismus in der SED ebenso auf wie in anderen sozialistischen Ländern. Es spricht für den Realitätssinn Walter Ulbrichts, dass er sich auf illusorische Vorhaben nicht einließ, sondern eine gründliche Bestandsaufnahme und objektive Bewertung des bisher erreichten Entwicklungsstandes der Gesellschaft, ihrer Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse, der Arbeitsproduktivität und der ökonomischen Leistungsfähigkeit wie auch des gesellschaftlichen Bewusstseins der Menschen zur Grundlage der weiteren Aufgabenstellung machte. Auch widerstand er – im Unterschied zu Chruschtschow – der Versuchung des Ehrgeizes, seine Person und seinen Namen mit dem Erreichen des kommunistischen Zieles zu verbinden, und zeigte damit, dass es ihm um die Sache und nicht um persönlichen Ruhm ging. Aus den Erfahrungen der bisherigen Entwicklung der DDR war ihm klar geworden, dass die einfachen Formeln Stalins nicht geeignet waren, derart komplizierte und langwierige gesellschaftliche Umgestaltungsprozesse zu verstehen, und noch weniger, sie bewusst zu planen und zu leiten. Dies umso mehr, als in den entwickelten kapitalistischen Ländern die wissenschaftlich-technische Revolution zu einem erneuten Aufschwung der Produktivkräfte und damit auch zu einer bedeutenden Erhöhung der Arbeitsproduktivität führte – ganz im Gegensatz zu Stalins Behauptungen in seiner letzten Arbeit »Ökonomische Probleme des Sozialismus«. In der unmittelbaren täglichen Konfrontation mit der industriell hoch entwickelten kapitalistischen BRD wurde deutlich, welche Anstrengungen noch erforderlich waren, um auch den materiellen Lebensstandard auf ein Niveau zu heben, das den Ansprüchen des Sozialismus genügte und ihn als überzeugende Alternative zum Kapitalismus erscheinen ließ. Es kam also darauf an, die ökonomische Leistungskraft der Gesellschaft in erheblichem Maße zu steigern, und das war nur möglich durch die Entfaltung des wissenschaftlich technischen Fortschritts und die umfassende Nutzung seiner Resultate. Das schwerfällige bürokratische Planungs- und Leitungssystem der Wirtschaft, welches weitgehend aus der Sowjetunion übernommen worden war, erwies sich immer mehr als ungeeignet, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt zu stimulieren. Alle realistischen Überlegungen führten zu dem Schluss, dass die im Verlauf der Übergangsperiode entstandene sozialistische Gesellschaft keineswegs fertig und vollendet sei, sondern noch einer längeren allseitigen Entwicklung und Vervollkommnung bedürfe, ehe sie den ökonomischen Reifegrad erreichte, der die unerlässliche Bedingung für den Übergang in die höhere Entwicklungsstufe des Kommunismus bildete. Walter Ulbricht scheute sich nicht, diese Schlussfolgerung auf dem VI. Parteitag der SED 1963 klar und eindeutig zu formulieren, indem er erklärte, dass nun, nach der Vollendung der Übergangsperiode, der »umfassende Aufbau des Sozialismus« das strategische Ziel sei. Damit erteilte er allen kommunistischen Illusionen eine Absage. Wenn diese neue Formel auch in theoretischer Hinsicht noch nicht genügend begründet und in praktischer Hinsicht noch nicht ausreichend mit konkretem Inhalt erfüllt war, bedeutete sie doch einen entscheidenden Fortschritt in der Auffassung des Sozialismus, der als Grundlage für die weitere Abkehr von der primitiv vereinfachten Stalinschen Konzeption und für die Ausarbeitung umfassender Reformpläne diente. Nun ging es darum, alle Konsequenzen aus diesem Ansatz zu ziehen, um die konkreten Wege der weiteren Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft zu bestimmen. An diesem wichtigen Wendepunkt zeigte sich, dass Walter Ulbricht nicht nur ein Realpolitiker war, der von den jeweiligen Bedingungen ausgehend nach den nächsten praktischen Lösungen suchte, sondern auch ein theoretischer Kopf, der eine wissenschaftlich begründete Konzeption für eine langfristige Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft suchte. Dazu wurde nicht nur die Theorie des Marxismus benötigt, sondern – vom Fundament ihrer Erkenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung ausgehend – war es auch erforderlich, sich dabei auf eine Reihe von Naturwissenschaften, Gesellschaftswissenschaften und Technikwissenschaften zu stützen. Von dieser Einsicht wurde sein positives und enges Verhältnis zu den Wissenschaften bestimmt. Die weitere Vervollkommnung der sozialistischen Gesellschaft konnte nur in enger Verbindung mit der wissenschaftlich technischen Revolution erfolgen, weil nur so der erforderliche Entwicklungsstand der Produktivkräfte zu erreichen war. Da die DDR kaum über nennenswerte Rohstoffe verfügte, musste ihre Produktion besonders stark auf »intelligenzintensive« und möglichst exportfähige Erzeugnisse orientiert werden, weshalb die Entwicklung und Förderung der modernen Technikwissenschaften von besonderer Bedeutung war. Es zeugte von Walter Ulbrichts Weitsicht, dass er die moderne Wissenschaft als eine entscheidende Produktivkraft der Gesellschaft erkannte und konsequent darauf hinwirkte, sie immer umfassender für den Sozialismus zu nutzen. Durch die Bildung des Forschungsrates der DDR wurde ein Organ geschaffen, um die Entwicklung der wissenschaftlichen Forschung zu planen und zu koordinieren, und es wurden erhebliche Mittel für die weitere Entwicklung und Diversifizierung wissenschaftlicher Forschungs- und Ausbildungseinrichtungen bereitgestellt. Zahlreiche neue Hochschulen, besonders im technikwissenschaftlichen Bereich, entstanden in jener Zeit als Investitionen in die Zukunft. Zugleich wurden am Beginn dieser neuen Entwicklungsetappe der sozialistischen Gesellschaft eine Reihe von zeitweiligen Forschungsgruppen und Kommissionen gebildet, die sich mit der Analyse der verschiedenen Bereiche der Gesellschaft und der Ausarbeitung von Vorschlägen und Prognosen als Grundlage für künftige politische Entscheidungen beschäftigten. Dabei entstand eine Atmosphäre offener Diskussion, es sollte keine Tabus geben, alle Probleme konnten freimütig erörtert werden, um die besten Lösungen zu finden. Das war die Zeit, in der es auch möglich war, den Stalinschen Dogmatismus öffentlich zu kritisieren und sich mit seinen Auffassungen detailliert auseinanderzusetzen. Damals konnte auch das Buch »Marxistische Philosophie« geschrieben und veröffentlicht werden, in dem der primitive Schematismus konsequent beseitigt wurde, der seit dem Erscheinen der Schrift »Über dialektischen und historischen Materialismus«, die angeblich von Stalin verfasst worden war, in der marxistischen Philosophie seit Jahrzehnten herrschte. Von grundlegender Bedeutung für die Reformvorhaben war die Ausarbeitung des Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft (NÖSPL), das auf Initiative Walter Ulbrichts begonnen und nach vorbereitenden Experimenten eingeführt wurde. Es war darauf gerichtet, den Betrieben eine größere Selbständigkeit zu geben, um damit auch ihre Interessen besser zur Geltung zu bringen, die zentrale Planung auf die wichtigsten Kennziffern zu beschränken und die Produktion vor allem auf qualitative Kriterien zu orientieren. Einen besonderen Stellenwert erhielten dabei das Wertgesetz, die Rentabilität und der Gewinn sowie die Orientierung auf die Intensivierung der Produktion und die Beschleunigung des wissenschaftlich technischen Fortschritts. Dieses neue Planungs- und Leitungssystem bewährte sich praktisch und führte in relativ kurzer Zeit zu einer Beschleunigung und Intensivierung der ökonomischen Entwicklung, was auch eine spürbare Erhöhung des Lebensstandards ermöglichte. Theoretisch bedeutete es die Abkehr von dem aus der Zeit extensiver Wirtschaftsentwicklung stammenden sowjetischen Planungssystem mit seinen überdimensionierten bürokratischen Mechanismen und zentral vorgegebenen Kennziffern, das zu immer mehr Bürokratie tendierte und daher zunehmend ineffektiver wurde. Aber die Entfernung vom Stalinschen Sozialismusmodell beschränkte sich nicht auf den ökonomischen Bereich. Auch in sozialer und politischer Hinsicht gab es bedeutende Unterschiede, und die Differenzen wurden zunehmend größer. Stalin hatte die These vertreten, dass sich angeblich in der Zeit des Sozialismus der Klassenkampf verschärfen und härtere Formen annehmen würde, je weiter die sozialistische Gesellschaft in ihrer Entwicklung vorankomme, weil der Widerstand der noch vorhandenen Überreste der früher herrschenden Klassen wachsen werde. Dies bildete die Begründung für die exzessive Anwendung gewaltsamer Mittel und Methoden bis hin zu Terroraktionen und zugleich auch für den überdimensionierten Sicherheitsapparat. Auch in der DDR kam es in der Übergangsperiode zeitweilig zu schärferen Auseinandersetzungen, doch war die Führung der SED unter Ulbricht sehr intensiv bemüht, den Kampf nicht eskalieren zu lassen und Verständigung zu suchen. Das zeigte sich darin, dass nach der Überführung der Konzerne und Großbetriebe in Volkseigentum (teilweise durch Volksentscheide) mittlere und kleinere private Betriebe, Geschäfte und Handelsunternehmen weiter bestehen bleiben konnten. Sie wurden in die geplante Produktion und Zirkulation mit einbezogen und sicherten dadurch ihre Existenz. Auch in der neuen Periode der weiteren Entwicklung und Vervollkommnung des Sozialismus hielt Ulbricht an dieser Linie fest. Er erklärte wiederholt, dass in der sozialistischen Gesellschaft alle Menschen gebraucht und eine Perspektive haben würden. In den anderen sozialistischen Ländern mit Ausnahme Jugoslawiens und später Ungarns – waren faktisch alle Betriebe, unabhängig von ihrer Größe, nach dem sowjetischen Muster enteignet und in gesellschaftliches, d. h. Staatseigentum überführt worden. Das andere Herangehen Ulbrichts verzichtete nach Möglichkeit auf gewaltsame Methoden und beachtete dagegen viel mehr die verschiedenen ökonomischen, sozialen und politischen Aspekte in den Beziehungen der Klassen und Schichten. In ökonomischer Hinsicht war dies für die ganze Bevölkerung von Vorteil, weil die kleinen und mittleren Betriebe einen beträchtlichen Anteil an der Produktion von Konsumgütern hatten und so einen wichtigen Beitrag für die Versorgung leisteten. In sozialer Hinsicht war es viel effektiver, die Fähigkeiten und die Arbeit dieser Schichten zu erhalten, als sie durch eine schnelle und vollständige Überführung ihrer Produktionsmittel in gesellschaftliches Eigentum zu entwurzeln und in eine ungewisse soziale Situation zu bringen. In politischer Hinsicht war es zweifellos für die ganze Gesellschaft vorteilhafter, politische Konflikte zu vermeiden und allen Kräften die Möglichkeiten zu geben, sich aktiv am Wiederaufbau zu beteiligen und dabei auch ihre Interessen zur Geltung zu bringen. In gemeinsamen Beratungen der Parteien wurden dabei Wege und Methoden gesucht, alle aufbauwilligen Kräfte in die langfristige Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft einzubinden, ihren Interessen Rechnung zu tragen und ihnen eine Perspektive zu bieten. Walter Ulbricht ging dabei sogar so weit, bereits von einer »sozialistischen Menschengemeinschaft« zu sprechen. Wenn das in mancher Hinsicht auch noch mehr eine Zielvorstellung als eine gesellschaftliche Realität war, denn erhebliche Interessenunterschiede existierten in dieser Gemeinschaft unverändert, so drückte es doch den Wunsch und das Bestreben der herrschenden Klassenkräfte der neuen Gesellschaft der DDR aus, die Interessen aller Bevölkerungsschichten zu berücksichtigen und Konsens zu suchen. Das widersprach sehr entschieden der These Stalins von der Verschärfung des Klassenkampfes im Sozialismus, aber es entsprach völlig der These von Marx, dass der aus Interessengegensätzen resultierende Klassenkampf zwar nicht völlig vermieden werden könne, die Zeit der Umgestaltung der Gesellschaft zum Sozialismus aber ein rationelles Zwischenstadium sei, in dem dieser Klassenkampf in den humansten Formen geführt werden könne und solle, so dass gesellschaftliche Verluste minimiert werden. Das war ein völlig anderes Herangehen auch an das Problem der Anwendung von Gewalt und gewaltsamer Methoden in der Übergangsperiode und im Sozialismus, als es seinerzeit von Stalin praktiziert wurde, der Gewalt und gewaltsame Methoden für effektiver hielt als Überzeugung und Zusammenarbeit, was in der Praxis aber zu großen gesellschaftlichen Verlusten führte. Auch im Hinblick auf das politische System und die Verfassung der sozialistischen Gesellschaft ging Walter Ulbricht zunehmend einen eigenen Weg, der sich von dem des sowjetischen Systems unterschied, welches die meisten sozialistischen Länder mit gewissen Modifikationen übernommen hatten. Unmittelbar nach der Befreiung vom Faschismus hatte die Sowjetische Militäradministration die Bildung antifaschistisch-demokratischer Parteien zugelassen. So entstanden die Kommunistische Partei und die Sozialdemokratische Partei wieder, die sich 1946 zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vereinigten, und die Christlich-Demokratische Union sowie die Liberaldemokratische Partei. Dank den intensiven Bemühungen Wilhelm Piecks, Walter Ulbrichts und auch Otto Grotewohls waren diese Parteien übereingekommen, beim Aufbau einer antifaschistisch demokratischen Ordnung eng zusammenzuarbeiten und alle an der Verantwortung zu beteiligen. Im Herbst 1946 fanden die ersten freien demokratischen Wahlen zu den Landtagen statt, wobei die Parteien mit ihren konkurrierenden Listen gegeneinander antraten. Die vereinigte Arbeiterpartei besaß im Ergebnis dieser Wahl das größte politische Gewicht, weil sie in allen Landtagen eine relative und teils auch absolute Mehrheit errang. Gemäß der getroffenen Vereinbarung wurden aber trotzdem alle Parteien an den Regierungen und Verwaltungen mit verantwortlichen Funktionen beteiligt. Es wurden also keine Bündnisse gebildet, welche zum Gegensatz von Regierung und Opposition führten, sondern Koalitionen, an denen alle Parteien beteiligt waren. Diese sogenannte Blockpolitik vereinigte alle politischen Kräfte in der gemeinsamen Verantwortung für den demokratischen Neuaufbau. Obwohl es später in verschiedenen Parteien zu Auseinandersetzungen über die Fortsetzung der Blockpolitik kam, setzten sich die Führungskräfte durch, welche an dieser vereinbarten Linie festhielten. Daher wurde sie auch nach der Gründung der DDR beibehalten. Dementsprechend wurden alle Parteien– inzwischen waren die Demokratische Bauernpartei und die National Demokratische Partei hinzugekommen an den Staatsorganen mit höchsten Funktionen beteiligt. Mit dem Eintritt in die Übergangsperiode zum Sozialismus 1952 war aber eine neue Lage entstanden, weil es nun nicht mehr um die Errichtung der antifaschistisch demokratischen Ordnung, sondern um den Aufbau der sozialistischen Gesellschaft ging. Unter diesen Bedingungen hätte das bisherige Bündnis der Parteien durchaus zerbrechen können. Doch es gelang der Führung der SED unter Walter Ulbricht, die anderen Parteien für die Unterstützung dieses Weges zu gewinnen. Das war sicherlich nur möglich, weil bereits der Grundstein für eine Politik der Einbeziehung der von den anderen Parteien politisch repräsentierten Klassen und Schichten in die sozialistische Entwicklung gelegt worden war. Gewaltsame Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse wurden vermieden und auch im ökonomischen Bereich Formen der Zusammenarbeit zwischen dem volkseigenen oder sozialistischen Sektor und den privaten Betrieben entwickelt, welche die Interessen der Privateigentümer wahrten und ihnen eine längerfristige Perspektive eröffneten. Das war eine entscheidende ökonomische Grundlage dafür, dass die politische Zusammenarbeit aller Parteien fortgesetzt werden konnte. Natürlich blieb es nicht aus, dass auch hier die vorhandenen Interessenunterschiede zu Reibungen und Konflikten führten, aber es gab immer eine Grundlage, um einen Ausgleich der Interessen und eine Verständigung zu erzielen, ohne in gewaltsame Methoden zu verfallen. Dennoch verliefen Entwicklung und Ausgestaltung des politischen Systems der DDR mit den entsprechenden staatlichen Machtorganen und Funktionsmechanismen nicht gradlinig und widerspruchsfrei. Der Staat besitzt das Gewaltmonopol, und in diesem Sinne hat jeder Staat eine diktatorische Komponente – unabhängig davon, in welcher Form er organisiert ist und ob er diese Diktatur mit moderaten oder mit gewaltsamen Mitteln und Methoden ausübt. Der sozialistische Staat ist seinem Klasseninhalt nach die politische Herrschaft der Arbeiterklasse und der mit ihr verbündeten Bauernklasse, was darin zum Ausdruck kam, dass deren Grundinteressen die Staatspolitik bestimmten, während die Interessen anderer Schichten der Gesellschaft durchaus Berücksichtigung fanden, sofern sie mit diesen Grundinteressen vereinbar waren. Da der sozialistische Staat die politische Herrschaft der Mehrheit über eine kleine Minderheit der Gesellschaft bedeutete, konnte er seiner Natur nach weit demokratischer agieren als jeder bürgerliche Staat. Was theoretisch einleuchtet, war jedoch in der realen Praxis weitaus komplizierter, denn nach dem Beginn der Übergangsperiode zum Sozialismus erfolgten bedeutende Umgestaltungen in der Struktur und Funktionsweise des Staates, die sich teilweise auch an den sowjetischen Erfahrungen orientierten. Im Sowjetstaat aber waren aus verschiedenen historischen Gründen die diktatorischen Elemente weit stärker ausgeprägt als die demokratischen. Wenn in der DDR auch weitgehend andere Verhältnisse herrschten, hinterließ das sowjetische Muster doch gewisse Spuren auch im Aufbau und in den Funktionsmechanismen des politischen Systems. Weiter musste natürlich beachtet werden, dass gegen die DDR durch zahlreiche westliche Geheimdienste eine sehr intensive subversive Tätigkeit organisiert wurde, was zur Folge hatte, dass sich ein Sicherheits- und Abwehrdenken entwickelte. Argwohn und Misstrauen nahmen zu. Da diese Organe in aller Welt mit Methoden und Mitteln arbeiten, die häufig mit Zwang und Gewalt verbunden sind, darf man ruhig konzedieren, dass auch in der DDR die Relationen zwischen demokratischen und diktatorischen Elementen nicht in jeder Hinsicht den Erfordernissen entsprachen. Die Erfahrungen der bisherigen Entwicklung machten also deutlich, dass die Vorzüge und positiven Aspekte des politischen Systems der DDR zugleich mit einer Reihe negativer Erscheinungen verbunden waren, die sich hemmend auf die demokratische Mitwirkung und Mitbestimmung der Parteien, der gewählten Repräsentativorgane und der Bevölkerung auswirkten. Wesentliche Reformen waren darum also nicht nur in der Wirtschaft erforderlich – es mussten auch entsprechende Veränderungen im politischen System erfolgen. Dafür gab es kein Vorbild, und angesichts der besonderen Lage der DDR – einerseits in starkem Maße von der Sowjetunion abhängig, andererseits ständig mit der ökonomisch weit stärkeren BRD konfrontiert – war das ein schwieriges und auch heikles Unterfangen. Wie sollte zum Beispiel der Widerspruch zwischen der erforderlichen Entwicklung und Vertiefung der Demokratie einerseits und den berechtigten oder vermeintlichen staatlichen Sicherheitsinteressen andererseits gelöst werden? Zwar gab es mehrere Kampagnen wie »Arbeite mit, plane mit, regiere mit«, um die Bevölkerung stärker in die Lösung staatlicher Aufgaben einzubeziehen, doch blieben diese m. E. ohne nachhaltige Wirkung. Um diesen Zustand zu ändern, wurde es notwendig, eine neue Grundlage für die engere Verbindung der Bevölkerung mit dem sozialistischen Staat zu schaffen. Die seit 1949 geltende Verfassung war inzwischen so weit von der politischen und gesellschaftlichen Realität entfernt, dass eine neue, den sozialistischen Verhältnissen entsprechende Verfassung ausgearbeitet, mit dem Volk beraten und durch eine Volksabstimmung beschlossen werden sollte. Diesen Vorschlag betrachtete Ulbricht offenbar als ersten großen Schritt auf dem Wege zur Überwindung demokratischer Defizite und für die weitere Demokratisierung des gesamten gesellschaftlichen Lebens. Denn die Teilnahme großer Teile der Bevölkerung an der Diskussion um den Verfassungsentwurf führte diese in direkter Weise an alle wichtigen Staatsprobleme heran. Zudem gab es ihnen die Möglichkeit, sich dazu zu äußern und darauf auch Einfluss zu nehmen. Walter Ulbricht hielt diesen Weg für unbedingt erforderlich und setzte selbst gegen Widerstände im Politbüro der SED durch, dass der Entwurf der neuen Verfassung in Tausenden von Versammlungen mit der Bevölkerung diskutiert und beraten wurden, dass alle kritischen Einwände und Vorschläge von der Verfassungskommission beachtet und ausgewertet wurden und die Verfassung schließlich dem Volk als Souverän in einer freien Abstimmung zur Annahme unterbreitet wurde. Gibt es in den bürgerlichen Demokratien eine Verfassung, die in dieser Weise vom Volkssouverän bestätigt wurde? Die Tatsache, dass die Verfassung mit großer Mehrheit angenommen wurde, zeigte, dass dieser Weg richtig war und zur Beseitigung von Demokratiedefiziten beitragen konnte. Der immer wieder erhobene Einwand, dass dies keine »freie Entscheidung« gewesen sei, entbehrt jeder Grundlage und zeugt lediglich von Unwissenheit oder Voreingenommenheit, denn der Stimmzettel enthielt die Alternative Ja oder Nein, Zustimmung oder Ablehnung. Da gab es keinerlei Manipulationsmöglichkeiten. Im Laufe der Entwicklung war Walter Ulbricht wohl auch klar geworden, dass das im Prinzip von der Sowjetunion übernommene Wahlsystem mit den von den Parteien vorher abgestimmten Kandidatenlisten unbefriedigend war und einer weiteren Demokratisierung des politischen Systems im Wege stand. Er plante daher, wie von seinen engeren Mitarbeitern berichtet wurde, diesen Prozess weiterzuführen und eine Reform der Wahlgesetze und der Wahlprozeduren vorzubereiten, damit die Bürger größere und effektivere Möglichkeiten erhielten, die Zusammensetzung der gewählten Repräsentativorgane zu bestimmen. Von großer Bedeutung für die weitere Demokratisierung der staatlichen Verwaltungarbeit war auch die auf Walter Ulbrichts Initiative geschaffene neue Kommunalverfassung, welche den Bezirken, Kreisen und Kommunen bedeutend größere Rechte und Entscheidungskompetenzen gewährte. In der gesamten Entwicklung der DDR spielte die nationale Problematik eine wichtige Rolle. Durch die von den Westmächten mit aktiver Unterstützung westdeutscher Kräfte bewusst herbeigeführte staatliche Spaltung waren zwei deutsche Staaten entstanden, aber die deutsche Nation zerfiel dadurch nicht sogleich in zwei Nationen. In einem viele Jahrhunderte währenden geschichtlichen Prozess war sie nach langen Kämpfen gegen die feudale Zersplitterung Deutschlands schließlich als eine große bürgerliche Nation geeint worden. Sie verband die deutsche Bevölkerung durch ein dichtes Netz ökonomischer Beziehungen, durch relativ gleichartige soziale Strukturen, durch ein allmählich sich festigendes Nationalbewusstsein, durch die gemeinsame Sprache und Kultur, durch die tradierten Sitten, Bräuche und Gewohnheiten zu einer relativ einheitlichen Gemeinschaft, die als geschichtliche Entwicklungsform der Gesellschaft wirkte. Grundlegende ökonomische, soziale und ideologische Bindungen der kapitalistischen Gesellschaft vereinigten sich mit den ethnischen Eigenarten der Menschen und integrierten sie zu einer Nation, die zwar eine relativ einheitliche Gemeinschaft gegenüber anderen Nationen bildete, in ihrem Inneren aber trotzdem durch scharfe Klassengegensätze und entsprechende Interessen charakterisiert und zerrissen war. Der faschistische deutsche Staat war im Ergebnis des Sieges der Antihitlerkoalition vernichtet worden, aber die deutsche Nation blieb weiter bestehen. Wären die Bestimmungen des Potsdamer Abkommens eingehalten worden, dann hätte auch ein einheitlicher deutscher Staat errichtet werden können. Allerdings musste er demilitarisiert bleiben und die ökonomischen und sozialen Grundlagen des Faschismus hätten beseitigt werden müssen. Dadurch wäre die kapitalistische Grundlage der Nation erhalten geblieben, aber die Macht der großen Konzerne und Banken gebrochen gewesen, und die weitere Entwicklung der deutschen Nation wäre in politischen Auseinandersetzungen durch das entstehende Kräfteverhältnis der demokratischen Parteien und ihre Massenbasis bestimmt worden. Auf längere Sicht konnte das auch die Perspektive des Übergangs ganz Deutschlands zur Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft einschließen, zumal auch in Westdeutschland damals nicht nur die SPD unter Schumacher, sondern selbst die CDU unter Adenauer öffentlich die Auffassung vertraten, dass der Kapitalismus versagt habe und eine neue sozialistische Gesellschaftsordnung geschaffen werden müsse. Die SED trat immer entschieden gegen die staatliche Spaltung Deutschlands auf, weil sie die Perspektive einer einheitlichen Entwicklung der ganzen deutschen Nation bewahren wollte. Gerade von Walter Ulbricht gingen in dieser Hinsicht immer wieder wichtige Initiativen und Vorschläge aus, während viele westdeutsche Politiker, welche die Spaltungspolitik aktiv betrieben oder unterstützten, nach dem Motto »Haltet den Dieb!« agierten, indem sie ausgerechnet Walter Ulbricht die Verantwortung für die Spaltung anlasten wollten. Doch konnte die Jahrzehnte währende gesellschaftliche Entwicklung in den beiden Staaten, die in der BRD zur kompletten Restauration des Imperialismus und in der DDR zur sozialistischen Gesellschaft führte, auf Dauer nicht ohne Auswirkungen auf die Nation bleiben. Während sich deren soziale Inhalte, das Netz der ökonomischen, sozialen, politischen und ideologischen Beziehungen in unterschiedlicher Richtung veränderten und damit auch die Grundlagen des nationalen Lebens umgestalteten, blieben die ethnischen Gemeinsamkeiten der Nation wie Sprache, verwandtschaftliche Bindungen, Sitten, Bräuche, Gewohnheiten, kulturelles Erbe und Traditionen weitgehend erhalten und veränderten sich nur sehr langsam. Man konnte diesen Zustand der deutschen Nation schließlich so charakterisieren, dass sie sich – ihren entscheidenden Grundlagen und Inhalten nach – auf verschiedenen Entwicklungsstufen befand, aber die ethnischen Grundlagen und Inhalte weiter große Gemeinsamkeiten aufwiesen. Die staatliche Trennung bedeutete nicht automatisch und in kurzer Zeit auch den Zerfall der Nation. Deren weiteres Schicksal würde vielmehr vom Verlauf der historischen Entwicklung abhängen. Es zeugt auch in dieser Frage vom Realitätssinn und der Weitsicht Walter Ulbrichts, dass er voreilige und endgültige Schlussfolgerungen vermied, obwohl er die Tendenz der möglichen Entstehung zweier verschiedener deutscher Nationen mit unterschiedlichen – entweder kapitalistischen oder sozialistischen Grundlagen und Inhalten natürlich auch erkannte. Aber da die Geschichte meist einen langen Atem hat, riet er zu Vorsicht und Zurückhaltung. Daher wurde in der neuen sozialistischen Verfassung der DDR die Formulierung gewählt: »Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation.« Nach seiner Meinung bestand offenbar noch keine Notwendigkeit, endgültige Urteile über das Schicksal der deutschen Nation in die neue Verfassung zu schreiben. Die Geschichte blieb damit für künftige Entwicklungen offen, und das ließ auch der praktischen Politik für längere Zeit einen größeren Spielraum. Da unter den entstandenen Bedingungen mit einer längeren Koexistenz der beiden deutschen Staaten zu rechnen war und zahlreiche nationale Bindungen noch stark wirkten, hielt er es für erforderlich, Wege eines friedlichen Miteinanders zu suchen. Er schlug eine vorsichtige Annäherung durch erste offizielle Kontakte auf der Ebene der Regierungschefs vor, um die Konfrontation abzubauen. Wie wir heute wissen, stieß dies auf erheblichen Widerstand in Teilen des Politbüros der SED, die der Meinung waren, dass eine Politik der strikten Abgrenzung gegenüber der BRD angebracht sei. Doch kann man als sicher annehmen, dass die von Ulbricht bevorzugte Linie der Bevölkerung der DDR weitaus besser vermittelbar war, weil sie den Entwicklungsstand des gesellschaftlichen Bewusstseins und der öffentlichen Meinung nicht überforderte und überflüssige Beunruhigungen vermied. Wenn wir die Gesamtheit aller Reformvorhaben und politischen Aktionen betrachten, die Walter Ulbricht initiiert, begonnen, durchgeführt und weiter geplant hatte, dann fügen sie sich wie Elemente eines Systems zusammen, in dessen Mittelpunkt der Gedanke stand, die sozialistische Gesellschaft in der DDR in einer Weise zu gestalten, dass sie einerseits den grundlegenden Erkenntnissen des Marxismus wie auch den bisherigen positiven und negativen Erfahrungen Rechnung trug, aber andererseits auch die modernen Bedingungen der wissenschaftlich technischen Revolution und die Erfordernisse des ökonomischen Wettstreits mit einer wesentlich gewandelten kapitalistischen Welt berücksichtigte. Die von Ulbricht vor allem im Zeitraum von 1963 bis 1970 eingeleiteten substanziellen Reformen bedeuteten objektiv auch eine Zurückdrängung und teilweise Überwindung des Stalinismus in der DDR, der auch hier seine Spuren in den Strukturen und Funktionsmechanismen der Partei und des Staates wie auch im gesellschaftlichen Bewusstsein hinterlassen hatte. Das mag paradox erscheinen, galt Ulbricht doch lange Zeit als ein treuer Gefolgsmann Stalins. Es spricht aber alles dafür, dass er – wenn auch mit einer gewissen Verspätung – ernsthafte und weitgehende Schlussfolgerungen aus dem XX. Parteitag und den bisherigen Erfahrungen des Sozialismus in der Sowjetunion und der DDR gezogen hatte und nun bestrebt war, die sozialistische Gesellschaft der DDR effektiver, attraktiver und auch demokratischer zu gestalten. Doch das führte unvermeidlich auch zu einer fortschreitenden Abkehr von dem vereinfachten und in vieler Hinsicht den grundlegenden Erkenntnissen des Marxismus nur ungenügend entsprechenden theoretischen Vorstellungen Stalins vom Sozialismus, an denen die sowjetische Führung auch unter Chruschtschow und noch mehr unter Breshnew weiter festhielt. Ulbricht vollzog diese Entwicklung jedoch nicht in polemischer Auseinandersetzung oder gar Konfrontation mit der Führung der KPdSU, sondern mit praktischen Reformen, die durch ihre Resultate überzeugen sollten. Das war nicht einfach der abhängigen Lage der DDR von der Sowjetunion geschuldet, die sicher auch eine Rolle spielte, sondern entsprach vor allem der internationalistischen Haltung grundsätzlicher Solidarität mit dem ersten Land des Sozialismus, an der Ulbricht unbeirrt festhielt. Die auf diesem Wege gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse bestärkten ihn in der Einsicht, dass die sozialistische Gesellschaft noch eine lange Zeit benötigen werde, um die ökonomische, soziale und geistige Reife zu erlangen, von der aus der Übergang in die höhere Phase des Kommunismus zu einer realen Aufgabe werden konnte. Alle Vorstellungen von einer raschen Entwicklung zur kommunistischen Gesellschaft, in der materieller Überfluss herrschen würde und alle Bedingungen für die allseitige Entwicklung der Individuen gegeben seien, beruhten theoretisch auf einer zu oberflächlichen Auffassung und Interpretation der hierauf bezüglichen Ausführungen von Marx über die zwei Entwicklungsphasen der neuen Gesellschaftsformation. Praktisch waren sie Ausdruck revolutionärer Ungeduld und damit verbundener illusionärer Zukunftserwartungen, die oft genug über die realen Schwierigkeiten der Anfangsetappe hinwegtäuschen sollten. Marx hatte für die mögliche Dauer der niederen Entwicklungsphase, die wir nach Lenins Vorschlag als Sozialismus bezeichneten, keine bestimmten Zeiträume genannt, sondern als entscheidendes Kriterium den ökonomischen Reifegrad der Gesellschaft bezeichnet, der erreicht sein müsse, damit der Übergang in die höhere Phase der kommunistischen Gesellschaft erfolgen könnte. Lenin hatte das durch die These konkretisiert, dass der Sozialismus eine höhere Arbeitsproduktivität erreichen müsse als der Kapitalismus. Es nützte gar nichts, den noch erheblich darunter liegenden Entwicklungsstand der Produktivkräfte, der Arbeitsproduktivität und des Lebensstandards schönzureden, solange die sozialistische Gesellschaft effektiv noch nicht einmal in der Lage war, die Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern, Ersatzteilen und Lebensmitteln kontinuierlich und zuverlässig auf einem den Zielen und Ansprüchen des Sozialismus entsprechenden Niveau zu sichern. Die Schlussfolgerung konnte nur sein, die sozialistische Gesellschaft in einer längerfristig geplanten Entwicklung als ein gesellschaftliches System in seiner Totalität zu entfalten, in dem alle Elemente auf der Grundlage seiner spezifischen Gesetzmäßigkeiten in reibungslosen Funktionskreisen miteinander zusammen wirkten und dabei stabile Triebkräfte des weiteren Fortschritts hervorbrachten. Dieses Gesellschaftssystem musste dafür auch eine eigenständige ökonomische, soziale und kulturelle Qualität erhalten, die weder aus einer Mischung von »Überresten des Kapitalismus« und »Keinem des Kommunismus« bestehen noch lediglich eine Nachahmung der Errungenschaften des Kapitalismus und der bürgerlichen Gesellschaft sein konnte. Walter Ulbricht prägte dafür die oft belächelte oder auch verspottete Formel vom »Überholen ohne einzuholen«, deren tiefer Sinn eben darin bestand, klarzumachen, dass es nicht darum gehe, den Kapitalismus nur mit sozialistischem Vorzeichen nachzumachen, sondern prinzipiell neue Wege zu suchen und dabei stets die erforderliche neue Qualität des Sozialismus als Ziel anzusteuern. Als Quintessenz aller theoretischen Überlegungen und praktischen Erfahrungen ergab sich der Schluss, dass die sozialistische Gesellschaft kein kurzfristiger Übergangszustand ist, sondern als eine relativ selbständige Gesellschaftsformation von langer Dauer anzusehen sei. Diese grundlegende Einsicht formulierte Walter Ulbricht 1967 in einem Vortrag zum 100. Jahrestag des Erscheinens des ersten Bandes von Marx’ Hauptwerk »Das Kapital«, in dem er die Bedeutung der Marxschen Theorie für die Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft herausstellte. Dies kann nicht hoch genug bewertet werden. Ich hielt das damals und halte es auch noch heute für den wichtigsten Beitrag zur Entwicklung der Theorie des Sozialismus seit Lenin. Damit war eine realistische, alle bisherigen Erfahrungen verallgemeinernde und zugleich von utopischen und illusionären Elementen befreite Konzeption gegeben, die ein solides Fundament für die Ausarbeitung der praktischen Politik zur weiteren Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft bilden konnte. Ich erinnere mich noch der Diskussion mit meinem Wiener Freund Walter Hollitscher, dem bekannten marxistischen Philosophen. Wir waren ganz unabhängig voneinander zu der gleichen Bewertung gekommen und stimmten darin völlig überein, wobei wir aus vielen Erwägungen zu der Auffassung gelangten, dass die sozialistische Gesellschaft durchaus noch einhundert bis einhundertfünfzig Jahre benötigen könnte, um diese große Aufgabe zu lösen. Aus verschiedenen Gründen stießen die Ausführungen Ulbrichts nicht überall auf Verständnis und Zustimmung, wurden damit doch einige »heilige Kühe« geschlachtet und lang gehegte Illusionen zerstört. Vor allem betraf das die von der KPdSU verbreitete Auffassung, wonach die Sowjetunion seit Stalins Erklärung auf dem XVIII. Parteitag 1939, dass die strategische Hauptaufgabe nun im Übergang zum Kommunismus bestehe, sich bereits im »Übergang zum Kommunismus« befinde. Die KPdSU versäumte es nach Stalins Tod, seine unbegründete und primitive Theorie vom Sozialismus und Kommunismus einer kritischen Analyse zu unterziehen und sich von dem damit verbundenen Voluntarismus und Illusionismus konsequent zu trennen. Stattdessen arbeitete sie auf diesem theoretischen Fundament das neue Parteiprogramm von 1961 aus und formulierte darin die Aufgabe, binnen zwanzig Jahren die kommunistische Gesellschaft zu errichten. Damit verstrickte sie sich immer tiefer in dem Netz illusionärer Vorstellungen und unrealistischer Erwartungen, aus dem sie auch später nicht mehr herauskam, denn für die Lösung dieser Aufgabe fehlten die entscheidenden objektiven Bedingungen. Der dadurch unvermeidlich entstehende tiefe Widerspruch zwischen der ständig verbreiteten Ideologie und der gesellschaftlichen Realität musste sich daher weiter verschärfen und negative Auswirkungen auf viele Bereiche des gesellschaftlichen Lebens haben. Aber eine Zustimmung zu den Auffassungen Walter Ulbrichts hätte zugleich das Eingeständnis bedeutet, dass die KPdSU im Hinblick auf ihr strategisches Ziel bislang eine nicht begründete und weiter nicht haltbare Linie verfolgt hatte. Damit wurde aber die Vorbildrolle der KPdSU in Frage gestellt, was zu einem erheblichen Autoritätsverlust in der internationalen kommunistischen Bewegung geführt hätte. Obwohl Walter Ulbricht in seinen Ausführungen dieses schwierige Problem völlig umging und sich jeder Polemik enthielt, waren die Implikationen natürlich klar. Trotz aller Bemühungen, das freundschaftliche Verhältnis zur Sowjetunion weiter zu festigen – und ich bin sicher, dass diese bei Ulbricht keineswegs nur Nützlichkeitserwägungen entsprangen, sondern in seiner ganzen Haltung zur Sowjetunion wurzelten –, blieb es nicht aus, dass eine größere Distanz im Verhältnis zueinander entstand, zumal Chruschtschow, der ein Freund und Förderer der DDR war, inzwischen durch Breshnew abgelöst worden war. Aber leider gab es auch in der Führung der SED Widerstand gegen diese Linie Ulbrichts. Eine Reihe von Mitgliedern des Politbüros war nicht imstande, die prinzipielle Bedeutung und den theoretischen Wert der Konzeption Ulbrichts zu erfassen. Daher formierte sich im Politbüro eine Fronde, die seinen Reformkurs im Grunde ablehnte und dagegen agierte, indem manche Maßnahmen verzögert, hintertrieben oder gar sabotiert wurden. Hinzu kam, dass Ulbricht inzwischen ein betagtes Alter erreicht hatte, so dass seine Ablösung durch einen Nachfolger in absehbarer Zeit ohnehin auf der Tagesordnung stand. Unter diesen Umständen waren es wohl nicht nur fehlende Einsicht in den Weitblick und die Richtigkeit der grundsätzlichen Überlegungen Ulbrichts, sondern auch andere Erwägungen, die den größeren Teil der Mitglieder des Politbüros veranlasste, sich von Ulbricht abzuwenden und sich nicht gegen den voraussichtlichen Nachfolger Erich Honecker zu stellen. So konnte sich Walter Ulbricht in dieser wichtigen Reformperiode meist nur auf eine schwankende Mehrheit im Politbüro stützen. Und in dem Maße wie der Zeitpunkt seines Rücktritts aus Altersgründen herannahte, schrumpfte sie auf wenige Stimmen zusammen. Diese Meinungsunterschiede und Differenzen im Politbüro drangen damals natürlich nicht an die Öffentlichkeit, doch unser Institut für Gesellschaftswissenschaften war strukturell eine Abteilung des ZK und durch zahlreiche Fäden mit dem Apparat verbunden. Wir hatten dadurch zumindest teilweise eine Vorstellung davon, was sich auf dieser Ebene abspielte. Eingeweihte wussten durchaus, dass Erich Honecker, der von Ulbricht lange Zeit als sein potenzieller Nachfolger betrachtet wurde, weshalb er ihn auch als Leiter des Sekretariats einsetzte, zusammen mit Paul Verner und anderen entschiedene Gegner der Reformvorhaben Ulbrichts waren. Das führte dazu, dass Ulbricht irgendwann zu der Überzeugung gelangte, Honecker sei für die Funktion des Ersten Sekretärs nicht geeignet, was diese früher oder später natürlich erfuhr und darum Gegenmaßnahmen traf. Da Ulbricht aus erklärlichen Gründen auch Breshnew durch seine unabhängigen Auffassungen und seine selbständige Politik, die Auswirkungen auf die internationale kommunistische Bewegung und vor allem auf die anderen sozialistischen Länder hatte, längst ein Dorn im Auge sein musste, war eine Konstellation der Interessenübereinstimmung zwischen Honecker und Breshnew entstanden, darauf gerichtet, den Wechsel an der Führungsspitze zu beschleunigen. Viele von uns registrierten die Unsicherheit und mitunter auch ein gewisses Machtvakuum an verschiedenen Anzeichen, ohne zu wissen, dass eine Mehrheit des Politbüros auf Initiative Honeckers inzwischen einen Brief an Breshnew gesandt hatte, in dem sie die Ablösung Ulbrichts vorschlug und die Zustimmung zu diesem Schritt erbat. Die Würfel waren bereits gefallen, als im Dezember 1970 eine ZK-Tagung stattfand, auf der Walter Ulbricht das Hauptreferat hielt, zugleich aber auch Honecker und Stoph auftraten und manches von den Ausführungen Ulbrichts konterkarierten. Diese Tagung bedeutete die faktische Entmachtung Ulbrichts, doch geschah dies in einer Weise, dass die ZK Mitglieder es überhaupt nicht begriffen. Mir wurde dies klar, als kurze Zeit später Kurt Hager eine große Auswertung im ZK mit allen verantwortlichen Leitern wissenschaftlicher und kultureller Institutionen vornahm, obwohl es einen sachlichen Grund für diese Veranstaltung nicht gab. Sein langes, unkonzentriertes Referat – für ihn sehr ungewöhnlich war mit zahlreichen Zitaten aus den Reden von Honecker und Stoph gespickt, und er kritisierte Ulbricht und dessen Auffassungen häufig, ohne dessen Namen auch nur einmal zu nennen. Das war für die meisten Anwesenden zwar etwas irritierend, aber sie ahnten nicht den Hintergrund, während Werner Kalweit, der neben mir saß, und ich sofort verstanden, dass die Ablösung Walter Ulbrichts bereits beschlossene Sache war. Denn ich wusste, dass Hager eine hohe Meinung von Walter Ulbricht hatte, wohingegen er Erich Honecker für weit weniger befähigt hielt, um mich hier vorsichtig auszudrücken. Hagers Auftritt diente also weniger dazu, uns über das ZK-Plenum zu informieren, als vielmehr dazu, Honecker seiner Loyalität zu versichern. Wie konspirativ der Vorgang eingefädelt worden war, konnte ich auch daraus ersehen, dass Lene Berg, die ZK Mitglied war und in jener Zeit in der Redaktion der internationalen Zeitschrift Für Frieden und Sozialismus eine wichtige Funktion bekleidete, zwar an der Tagung des ZK teilgenommen hatte, aber völlig ahnungslos war. Ich weilte im Januar 1971 zu einer Besprechung in der Redaktion der Zeitschrift in Prag und besuchte sie in ihrer Wohnung. Sie fiel aus allen Wolken, als ich ihr sagte, dass nun die Ära Walter Ulbricht leider vorbei sei und ich mit Skepsis unserer Zukunft unter dem kommenden Ersten Sekretär entgegensehe. Das sei ganz unmöglich, erwiderte sie erregt, denn davon war auf der ganzen Tagung des ZK überhaupt keine Rede. Auf ihre Frage, wie ich auf eine solche Idee käme, zählte ich ihr alle Indizien auf, die darauf hindeuteten, dass die Würfel bereits gefallen waren. Darauf wurde sie sehr nachdenklich und meinte, wenn sie es richtig bedenke, habe sie auch schon einige Zeitlang recht merkwürdige Verhaltensweisen im »Großen Haus« erlebt, sich darauf aber keinen Reim machen können. Ulbricht wehrte sich zwar, doch da die Mehrheit des Politbüros sich bereits den stärkeren Bataillonen angeschlossen hatte, blieb ihm keine Wahl, und er stimmte dem Rücktritt zu. So wurde Erich Honecker, den er lange Zeit als Nachfolger aufgebaut und favorisiert hatte, dann aber doch für ungeeignet hielt, das begonnene Reformwerk fortzusetzen, zum Ersten Sekretär gewählt. Damit war das gesamte von Ulbricht konzipierte Reformprogramm, das der sozialistischen Gesellschaft eine größere Entwicklungsfähigkeit verleihen konnte, beendet. Der Nachfolger kehrte sehr schnell – ganz im Einvernehmen mit Breshnew – zu den in der Sowjetunion bewährten Strukturen und Funktionsmechanismen zurück, erklärte alle grundlegenden Einsichten und konstruktiven Überlegungen Ulbrichts für falsch und versuchte, auf jede denkbare Weise dessen Leistungen herabzusetzen und zu diskreditieren. Das führte in der SED zu einer großen Verunsicherung, denn es war schwer zu verstehen, weshalb alles, was bisher als richtig gegolten hatte, plötzlich verkehrt sein sollte. Im Gegensatz zu der Auffassung, dass der Sozialismus eine relativ selbständige Gesellschaftsformation von langer Dauer sei, erklärte Honecker in mehreren öffentlichen Reden, dass wir uns dem Kommunismus bereits näherten und unsere Generation noch im Kommunismus leben würde. Überhaupt wurde im innerparteilichen Sprachgebrauch nun immer mehr »sozialistisch« durch »kommunistisch« ersetzt, als ob terminologische Regelungen etwas an der gesellschaftlichen Realität ändern würden. Im Gegensatz zu der Politik Ulbrichts, den kleinen und mittleren privaten Betrieben und Unternehmen sowie den gemischten halbstaatlichen Unternehmen eine lange Entwicklungsperspektive zu gewähren und die damit verbundenen Schichten immer mehr in die sozialistische Wirtschaft und Gesellschaft zu integrieren, beseitigte Honecker diese Betriebe vollständig und ließ sie in großen Kombinaten aufgehen, obwohl diese an deren Produktion überwiegend kein Interesse hatten. In Bezug auf die komplizierte und sensible nationale Problematik verließ Honecker ebenfalls die längerfristig angelegte vorsichtige Politik. Er erklärte, dass die Geschichte über die nationale Frage in Deutschland bereits endgültig entschieden habe, denn in der DDR existiere die sozialistische Nation, die mit der kapitalistischen Nation der BRD nichts verbinde. Alle abrupten Wendungen aufzuzählen, geht über mein Anliegen hinaus, deshalb mag das Obige genügen, um das völlig unterschiedliche Herangehen des Nachfolgers gegenüber seinem Vorgänger zu charakterisieren. Doch der hiermit verbundene Bruch macht auf ein ernsthaftes Versäumnis Walter Ulbrichts hinsichtlich seiner Personalpolitik aufmerksam. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er aus dem Politbüro einen Seniorenklub machen wollte, denn er sorgte bereits sehr früh dafür, dass sogar sehr junge Genossen ins Politbüro gewählt wurden. Ewald, Kleiber, Jarowinsky, Halbritter, Mittag waren zum Zeitpunkt ihrer Zuwahl meist noch nicht einmal vierzig Jahre alt, und sie waren Fachleute auf den Gebieten, die für die weitere Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft von großer Bedeutung waren. Aber er war – aus welchen Gründen auch immer – viel zu lange auf Erich Honecker als favorisiertem Nachfolger fixiert, obwohl ihm dessen begrenzte Fähigkeiten nicht verborgen geblieben waren. Honecker konnte den Parteiapparat dirigieren und die damit verbundenen Machtmittel sehr gut nutzen. Aber er war in theoretischer Hinsicht relativ schwach. Auch war seine Eitelkeit ein charakterliches Manko. Walter Ulbricht hatte es offenbar versäumt, rechtzeitig andere personelle Möglichkeiten in Betracht zu ziehen und eventuell mehrere potenzielle Nachfolger darauf vorzubereiten, den Reformkurs konsequent fortzusetzen. Als er sich endgültig zu der Einsicht durchgerungen hatte, dass Honecker dafür nicht in Betracht käme, war es bereits zu spät. Die Tatsache, dass er erwog, Alfred Neumann[Anmerkung 15] vorzuschlagen, der im Politbüro seinen Kurs konsequent unterstützte, bestätigt das. Neumann selbst hat später gesagt, dass diese Aufgabe für ihn eine Nummer zu groß gewesen wäre und er sie daher auch nicht übernommen hätte. Dieses Dilemma betraf aber nicht nur die SED und Walter Ulbricht, sondern verweist auf einen grundsätzlichen Mangel in allen sozialistischen Ländern und deren regierenden Parteien, denn es gab keinen durch Parteistatut und Verfassung geregelten Modus für die Übergabe der höchsten Führungspositionen an die nächste Generation. Häufig wurde das Problem erst – wie im Vatikan – durch den Tod gelöst oder aber durch schädliche Diadochenkämpfe mit all ihren meist negativen Folgen. Es ist eine bekannte Tatsache, dass Walter Ulbricht lange Zeit in der Bevölkerung nicht sonderlich beliebt war. Das hatte viele Ursachen, die nicht so sehr mit ihm persönlich zu tun hatten als mit den schwierigen Verhältnissen der Nachkriegszeit. Es ist ja immer sehr leicht, für Mängel und Missstände einen Schuldigen zu finden, und da er eine große Verantwortung trug, wurde ihm vieles angekreidet, das zu ändern gar nicht in seiner Macht lag. Aber im Laufe der Zeit wendete sich die Haltung ihm gegenüber mehr und mehr ins Positive, und besonders in den 60er Jahren fand er zunehmend Anerkennung und Achtung. Auch meine persönliche Haltung ihm gegenüber war, wie eingangs schon erwähnt, keineswegs frei von Widersprüchen und kritischen Vorbehalten, die dazu führten, dass ich nicht zu seinen Anhängern gehörte, wenngleich ich immer großen Respekt und Achtung vor seinen Fähigkeiten und Leistungen hatte. Meine persönliches Verhältnis zu ihm wurde in den 60er Jahren zunehmend positiver, als ich bemerkte, dass er keineswegs oberflächlich über die tiefgreifenden Folgen des XX. Parteitages der KPdSU und die bisherigen Erfahrungen des Sozialismus vor allem auch in der Sowjetunion hinwegging, sondern daraus sehr weitreichende Schlussfolgerungen gezogen hatte. Mein Respekt und meine Achtung wuchsen in dem Maße, wie ich erkannte, dass er die Probleme nicht praktizistisch anging, um kurzfristige Erfolge zu verbuchen, sondern eine theoretisch durchdachte und begründete Konzeption verfolgte, die auf den langfristigen Erfolg des Sozialismus orientierte. Mich beeindruckten nicht nur die Weitsicht und Konsequenz in seiner Politik, sondern auch die Umsicht und die Vorsicht, die er vor allem im Verhältnis zur KPdSU und zur Sowjetunion walten ließ. Dabei verzichtete er darauf, sich als großer Theoretiker aufzuspielen, der glaubte, alle Welt durch immer neue Weisheiten belehren zu müssen. Er erwies sich zunehmend als ein Politiker, der – aus einer langen praktischen Erfahrung schöpfend – auch im Alter noch fähig war zu lernen, überholte Auffassungen und dogmatische Vorstellungen zu überwinden und zukunftsweisende theoretische und praktische Ideen für die erfolgreiche Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft zu entwickeln. Aus allen diesen Gründen bin ich der Meinung, dass Walter Ulbricht der bedeutendste politische Führer und Staatsmann der DDR-Geschichte war und ihm hohe Anerkennung gebührt. Aus der internationalen Garde der alten kommunistischen Parteiführer war er der Einzige, der es vermochte, die Erschütterungen in der kommunistischen Bewegung nach dem XX. Parteitag der KPdSU durchzustehen und schließlich konstruktive Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, weshalb er zu Recht auch hohes internationales Ansehen errang.
Gerald Götting: Ich traf Adenauer und Ulbricht
Gerald Götting, Jahrgang 1923, Besuch der Franckeschen Stiftungen in Halle, Arbeitsdienst, Nachrichtendienst bei der Luftwaffe, 1945 amerikanische Gefangenschaft. 1946 Mitglied der CDU, Studium der Philologie, Germanistik und Geschichte. 1949 bis 1966 Generalsekretär und von 1966 bis 1989 Vorsitzender der CDU. 1949 bis 1990 Abgeordneter der Volkskammer, bis 1958 als Vizepräsident und stellvertretender Präsident, bis 1963 Vorsitzender der CDU-Fraktion, von 1969 bis 1975 Präsident der Volkskammer. Präsident der Liga für Völkerfreundschaft seit 1976. Von 1960 bis 1989 Stellvertretender des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR. Im Februar 1991 aus der fusionierten CDU ausgetreten. Es heißt, die Gründung der CDU geht auf eine Weisung Stalins zurück? Das trifft zu. Stalin war im Zweifel, ob die KPD nach dem Krieg die Masse der Deutschen würde erreichen können, was nach zwölf Jahren übler antikommunistischer Nazipropaganda und -hetze ja nicht abwegig war. Schließlich hatte die Partei auch vor 1933 keine Mehrheit gegen die Faschisten zustande gebracht, keine antifaschistische Einheitsfront mit den Sozialdemokraten zur Abwehr der Nazidiktatur und damit zur Verhinderung des Krieges. Was, mit Verlaub, nicht nur an den Kommunisten lag. Aber Entschuldigung, zurück zur CDU. Stalin hat, soweit ich weiß, noch vor Ende des Krieges verfügt, dass unmittelbar nach der Kapitulation vier Parteien wiedergründet werden sollten: die KPD, die SPD, für das Bürgertum und Mitläufer die Liberaldemokratische Partei und in der Nachfolge der früheren katholischen Zentrumspartei die CDU. Den Auftrag dazu hatte Legationsrat Tömmler[Anmerkung 16] erhalten, der in seiner Petersburger Zeit Lenin kennengelernt hatte. Er sollte dem ehemaligen Zentrumspolitiker Andreas Hermes,[Anmerkung 17] den die Rote Armee aus der Todeszelle in Plötzensee befreit hatte, die Wiederbelebung der Zentrumspartei nahelegen. Hermes meinte jedoch, dass in der sowjetisch besetzten Zone mehr Protestanten als Katholiken lebten, und schlug darum »Christlich-Demokratische Union« vor. Dieser Parteiname wurde von Stalin schriftlich genehmigt. Das Papier liegt in Moskau. Daraufhin haben Tulpanow[Anmerkung 18] und Tömmler den Gründungsaufruf vom 26. Juni 1945 formuliert. Im Juli 1945 eröffnete Hermes die »Reichsgeschäftsstelle der CDU« in Berlin. In der Folgezeit wurde Hermes als CDU-Vorsitzender Zweiter Stellvertreter des Oberbürgermeisters von Berlin und Stadtrat für Ernährung. Im Dezember 1945 ging er jedoch wegen unterschiedlicher Aufassungen zur Bodenreform nach Bad Godesberg und schloss sich der Adenauer-CDU an. Dort geriet er alsbald ins politische Abseits, weil er gegen die Westintegration war. Die vier Parteien bildeten damals den antifaschistisch-demokratischen Block. Das Prinzip der Gemeinsamkeit, das bis zum Ende der DDR galt, hatte also dort seine Wurzeln. So ist es. Die Parteien kämpften nicht gegeneinander, wie das in der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft der Fall ist. Es ging darum, miteinander die Trümmer der alten Gesellschaft zu überwinden und eine neue, eine andere Gesellschaft zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit war für mich überhaupt der Grund, der CDU beizutreten, denn die fürchterlichen Schlägereien der Parteien in der Weimarer Republik hatte ich als Kind erlebt. Das durfte sich nicht wiederholen. War die West-CDU eine Abspaltung oder eine eigenständige Parteigründung? In den westlichen Besatzungszonen bildeten sich unabhängig voneinander christliche-demokratische Parteigruppierungen, das zog sich bis 1947 hin, weshalb die CDU (West) kein Gründungsdatum hat. Es gab in der Woche vor Weihnachten 1945 ein »Reichstreffen« dieser Gruppen in Bad Godesberg. In der Darstellung der Konrad-Adenauer-Stiftung heißt es dazu: »Von diesem Zeitpunkt an wurde der Name ›Union‹, wie er in Berlin und in der SBZ geprägt worden war, im Westen übernommen.« Mit anderen Worten: Die heutige Regierungspartei der Bundesrepublik Deutschland verdankt Stalin ihren Namen? So weit würde ich nicht gehen. Aber ein gewisser historischer Kontext besteht natürlich. Wobei ich glaube, dass man damals den Ostnamen CDU auch deshalb übernahm, um Einfluss auf die Christdemokraten in der SBZ zu bekommen. Konrad Adenauers Ziel jedenfalls bestand darin, in Westeuropa eine geschlossene katholische Abwehrfront gegen den vordringenden Kommunismus zu schaffen und später in den Osten auszudehnen. Hast du Adenauer mal getroffen? Das war auf dem 3. Deutschlandtag der Jungen Union vom 12. bis 15. August 1947 in Hamburg. Eingeladen waren die Landesvorsitzenden, ich war der Vorsitzende von Sachsen-Anhalt. Adenauer gab für uns fünf Landesvorsitzende aus dem Osten eine Privataudienz. Meine Mitstreiter kniffen, sie fürchteten den Ärger daheim, wenn sie erzählten, sie hätten mit dem Reaktionär Adenauer geplaudert. Ich hatte ein ordentliches Verhältnis zu dem in Halle für uns zuständigen Kulturoffizier der Sowjetischen Militäradministration und machte mir daher keine Sorgen. Also war ich allein bei Adenauer. Der erzählte mir, dass ihn die SBZ nicht interessiere, ihn beschäftige mehr, dass Westdeutschland ein ordentliches Verhältnis zu seinen Nachbarn im Westen bekäme. Und dann sagte er noch, denn er wähnte mich als einen Bruder in Christo, wir sollten im Osten so lange aushalten, wie es gehe. Denn dass die kommunistischen Sowjets uns irgendwann verbieten würden, schien ihm ausgemachte Sache. Wo fand das Gespräch statt? Die Tagung fand im Fährhaus statt, und dort hatte Adenauer ein Zimmer, wo ich mit ihm allein Kaffee trank. Was machte er für einen Eindruck auf dich? Er war damals schon jenseits der 70, wirkte aber sehr entschlossen und zielstrebig. In seinen Augen war ich eine Art Exot, kam aus einer Gegend, in die er nie freiwillig seinen Fuß setzen würde. Aber ich verhehle nicht: Er hat mich beeindruckt. Wie behandelte er dich? Von oben herab? Keineswegs, er behandelte mich sachlich und korrekt, erkundigte sich nach der Lage in der Zone, aber ließ keinen Zweifel daran, dass er sich offiziell mit der CDU im Osten nicht ins Benehmen setzen würde. Er lehnte jedes Gespräch mit Otto Nuschke,[Anmerkung 19] dem Parteivorsitzenden, ab. Aber er setzte erkennbar auf die Jugend, auf meine Generation. Deshalb gab’s ja auch Kaffee und dieses gemütliche, keineswegs feindselige Gespräch von vielleicht einer Stunde. Hast du ihn später noch einmal getroffen? Nein. Wir hatten nie wieder Kontakt. Auch nicht schriftlich. Du hattest zu Walter Ulbricht ein gutes Verhältnis. Das kann man wohl sagen. Er hatte von Anfang an Vertrauen zu mir und ich zu ihm. Gleich nach 1945 sprachen wir in der CDU vom »Sozialismus aus christlicher Verantwortung«. Jakob Kaiser hat diesen Begriff geprägt. Ulbricht nahm mich eines Tages beiseite und sagte: »Das ist doch eine verkehrte Welt. Ihr sprecht vom Sozialismus, während wir von der antifaschistisch demokratischen Ordnung reden.« Wenn du Ulbricht und Adenauer vergleichst … Irgendwo waren sie sich ähnlich. Jeder wollte lieber das halbe Deutschland ganz, denn das ganze Deutschland halb. Und Adenauer wollte aus mir einen Widerstandskämpfer in der Zone machen und Ulbricht einen anständigen Kommunisten. Kommunist bin ich nicht geworden, aber ein Verbündeter Walter Ulbrichts schon. Dieses Zitat mit dem »halben Deutschland ganz« wird ausschließlich Adenauer zugeschrieben. Ich habe es Ulbricht erzählt, der sagte amüsiert: »Das ist doch gut, da hat er recht.« Wir saßen gelegentlich, das war dann schon in den 60er Jahren, nach den Sitzungen im Staatsrat beim Essen zusammen und sprachen wie normale Menschen. Für Anekdoten war er immer zu haben. Ich kam gerade aus Conakry in Guinea, wo seit 1958 Sékou Touré herrschte, mit dem wir damals ganz gute Beziehungen hatten. »Ein 38-jähriger Neger aus Äquatorialafrika names Sékou Touré«, hieß es im Spiegel 12/1960, »hat den beiden würdigen Großvätern des Abendlandes, Charles de Gaulle und Konrad Adenauer, eine Nase gedreht. […] Vorletzte Woche tat der Neger wieder etwas Unerhörtes: Ohne sich um die Bonner Drohung zu kümmern, jede Anerkennung der DDR werde von der Bundesrepublik mit aller Strenge geahndet, schickte Sékou Touré einen Botschafter nach Pankow und brüskierte den Kanzler Adenauer.« Also wurde »Neger-Freund Lübke« (Spiegel 3/1962) als erster Bundespräsident auf »Afrika-Tournee« geschickt, wie das Hamburger Nachrichtenmagazin berichtete. Er sollte mit großzügigen Geschenken die Gunst der Abtrünnigen zurückgewinnen. In Guinea überreichte er einen Kredit über 25 Millionen DM zur Verbesserung der Wasserversorgung und versprach die Errichtung eines Lehr und Musterbetriebes für die Fleischverwertung, einen Forschungs Fischkutter, drei Muster-Räucherplätze für Fische, eine fahrbare Krankenstation, eine fahrbare Veterinärstation mit einem von Bonn besoldeten Tierarzt, eine Pflanzenschutz-Station mit Sachverständigen und – gleichfalls kostenlos – Straßenbau-Spezialisten. Das nahm Sékou Touré dankbar an, aber fragte bei der Begrüßung Lübkes auf dem Flugplatz, weshalb der Herr Präsident seinen Bart abgenommen habe … Das ist jetzt ein Witz wie die anderen Lübke zugeschriebenen Sprüche, die sich die Spiegel-Redakteure ausgedacht hatten? Nein, kein Witz, es stand auch nicht im Spiegel. Das haben sie mir bei meinem Besuch in Conakry erzählt. Sékou Touré hatte diese Anspielung auf Ulbricht bewusst gemacht, wobei ich mir nicht einmal sicher war, ob Lübke sie auch so verstanden hatte, wie sie gemeint war. Ulbricht jedenfalls lachte sehr, als ich ihm das erzählte. Ein andermal hatte er mich als seinen Sonderbotschafter nach Indien geschickt. Das machte er gelegentlich, um internationale Kontakte zu knüpfen. Auch in den Vatikan hatte er mich einmal entsandt. In Indien besuchte ich den Gouverneur in Bombay, dort unterhielt die DDR bereits seit 1954 ein Außenhandelsbüro. Vor dem Gouverneurspalast begrüßte mich eine Kapelle mit dem »Deutschlandlied«. Ich wertete es stillschweigend als »deutsche Volkslied«. Drinnen fragte mich schließlich der alte, ehrwürdige Gouverneur: »Exzellenz, wie geht es Seiner Majestät?« Ich wähnte, er meinte mit »His Majesty« unseren Staatsratsvorsitzenden, denn wer sollte denn sonst damit gemeint sein, und sagte diplomatisch-höflich: »Gut, sehr gut, danke der Nachfrage.« Im Verlaufe des Gesprächs wurde mir jedoch klar, dass er nicht Walter, sondern Wilhelm gemeint hatte. Ich kam vom anderen Ende der Welt, und er glaubte, das noch immer der Kaiser lebe. Ich korrigierte ihn jedoch nicht, zumal ich zuvor bestätigt hatte, dass »Majestät« noch gut beieinander seien. – His Majesty was amused, als ich ihm das nach meiner Rückkehr in Berlin berichtete. Wann hattest du zum ersten Mal mit Walter Ulbricht zu tun gehabt? Das war noch in Halle, in den 40er Jahren, als ich Landesvorsitzender der Jungen Union war. Ich hatte im Neuen Weg, das war die Tageszeitung der Landes-CDU, gefordert, mit dem Klassenkampf aufzuhören. Ulbricht hatte offenkundig den Beitrag gelesen, jedenfalls ging er bei einer Tagung in Halle, auf der er den Zweijahrplan vorstellte, darauf ein. Dieser junge CDU-Freund, so sagte er sinngemäß, irre, der Klassenkampf sei noch lange nicht beendet. Und nach der Konferenz erfolgte dann eine ausführliche, aber freundliche Belehrung. Ulbricht lag immer am Herzen, eng mit christlichen Kreisen zusammenzuarbeiten. Später rief er mich einmal zu sich und übergab mir die während des Krieges über den Moskauer Rundfunk ausgestrahlten Predigten des in Gefangenschaft geratenen Militärseelsorgers Friedrich Wilhelm Krummacher. Er schlug vor, diese – natürlich nach Rücksprache mit Krummacher, der seit 1955 Bischof in Greifswald war – zu veröffentlichen. Dabei erzählte mir Ulbricht, dass er seinerzeit wochenlang in Moskau herumgelaufen sei, um für Krummacher ein Kreuz zu bekommen. Es gab nur Doppelkreuze der russisch-orthodoxen Kirche. – Krummacher zeigte mir später einmal dieses von Ulbricht besorgte Kreuz und sprach über den respektvollen Umgang der Kommunisten mit ihm. Die Blockpolitik bekam gelegentlich Risse, es gab doch innerhalb der CDU Führung im Vorfeld der ersten Volkskammerwahl im Oktober 1950 Auseinandersetzungen. Du warst damals bereits Generalsekretär der CDU. Nun ja, unser Parteivorsitzender Otto Nuschke wollte zunächst keine gemeinsame Wahlliste der Kandidaten der Nationalen Front. Nur über meine Leiche, hatte er bei zwei Auftritten in Thüringen erklärt. Nuschke, der 1919 der Weimarer Nationalversammlung und bis 1933 dem Preußischen Landtag – als Generalsekretär der Deutschen Staatspartei (DDP) – angehört hatte und wie Ulbricht jetzt Stellvertretender Ministerpräsident war, rechnete sich offenkundig Chancen aus, Ministerpräsident der DDR und mehr zu werden. Die Stalin-Berija-Linie, die in den sowjetischen Noten vom März 1952 sichtbar wurde, lief doch auf ein neutrales, geeintes Deutschland hinaus. Der 67-jährige Otto glaubte, seine Chancen zu verbessern, indem er sich ein wenig von der SED-Politik absetzte. Ich selbst hingegen warb in den Landesverbänden für die gemeinsame Liste. Dann tagten die Blockparteien, und Nuschke meldete sich zu Wort, alle waren gespannt, was er sagen würde. Und der erklärte völlig überraschend: Ja, er wäre sehr dafür, dass die Kandidaten aller Parteien auf einer gemeinsamen Liste antreten sollten. Deshalb habe er seinen Generalsekretär, also mich, angewiesen, in den Landesverbänden entsprechend zu argumentieren. – Beim Hinausgehen stieß mich Ulbricht in die Seite und sagte: »Na, da haben Sie mich aber falsch informiert.« Und blinzelte mich dabei an. Worauf führst du den plötzlichen Sinneswandel bei Nuschke zurück? Ich denke, dass die Sowjets, vermutlich Semjonow,[Anmerkung 20] mit ihm geredet hatten. Auf die hörte er. Wie war Ulbrichts Verhältnis zu dir und zu Nuschke? Otto Nuschke achtete und respektierte er, mich hatte er gern. Er schickte mich oft als seinen Sonderbotschafter zu Staatsoberhäuptern in aller Welt. Am 17. Juni 1953 ist Otto Nuschke, immerhin Vizepremier der DDR, nach Westberlin verschleppt worden. Kannst du dich daran erinnern, hattest du damit etwas zu tun? Ja, aber das hat nichts mit Walter Ulbricht zu tun, das habe ich mit Semjonow geklärt. Erzähl mal. Wir saßen im Parteivorstand in der Jägerstraße, als ein Anruf kam, dass Otto Nuschke zu einer 15 Uhr beginnenden Sitzung der Regierung kommen solle. Die sollte irgendwo in Niederschöneweide stattfinden. Otto ließ sich gegen 14 Uhr in einem kleinen F 9 nach Treptow fahren, wurde in der Mühlenstraße unweit der Oberbaumbrücke erkannt und der Kraftfahrer von den Massen genötigt, nach Kreuzberg, also in den britischen Sektor, zu fahren. Vor dem Polizeirevier 109 wurde der Wagen gestoppt, der zweite Fahrer – ein Angestellter des CDU-Hauptvorstandes – flüchtete zurück über die Grenze und rief mich an. Wie ich später von Nuschke selbst erfuhr, traten dort sowohl die Briten als auch die Amerikaner an ihn heran und forderten ihn auf, im Westen zu bleiben. Die Amerikaner wollten ihn gleich ausfliegen und boten ihm einen sechsstelligen Betrag »für seine Memoiren«, die er in den Staaten schreiben sollte. Die Familie werde man nachholen. Nuschke protestierte und verlangte, in die DDR zurückgebracht zu werden. Das sei seine politische Heimat. Der RIAS führte mit ihm ein Interview, das wir im Rundfunk hörten und als seine Botschaft verstanden, dass er erstens gegen seinen Willen festgehalten werde und zweitens zurückkehren wolle. Ich meldete mich beim sowjetischen Hochkommissar Semjonow zum Gespräch an und bat diesen, bei seinem Kollegen im Alliierten Kontrollrat zu intervenieren, damit Nuschke zurückkommen könne. Semjonow fragte lachend: Will er das überhaupt? Das fand ich doch ein wenig befremdlich. Aber der Russe klärte das mit der Gegenseite. Ich erhielt einige Zeit später einen Anruf mit der Aufforderung, zur Oberbaumbrücke zu kommen. Von der Gegenseite schritt ein US-Major in Begleitung von Nuschke herüber, im Gefolge ein Pressepulk, und fragte, ob ich autorisiert sei, Mr. Nuschke in Empfang zu nehmen, was ich bejahte. Dann musste ich schriftlich quittieren, dass ich als Generalsekretär der CDU den Vorsitzenden der CDU übernommen habe. Wir fuhren dann in meinem Wagen in die Jägerstraße, wo er erst einmal ordentlich frühstückte. Es wird behauptet, Nuschke sei gar nicht verschleppt worden, sondern freiwillig nach Westberlin gefahren. Das ist Unsinn. Hätte er dann im Rundfunk gegen seine Entführung protestiert und seine Rückführung in die DDR verlangt? Seine Frau war gerade zum Mittagessen bei uns – wir lebten damals in einer Wohnung im Parteivorstand in der Jägerstraße –, als das Rundfunkinterview lief. Nein, es bestand kein Zweifel, dass Nuschke unbedingt wieder in die DDR zurückwollte. Nuschke genoss in der sowjetischen Führung hohes Ansehen? Das kann man so sagen. Ich erinnere mich an den 23. Februar 1956, an Otto Nuschkes 73. Geburstag. Er war in Barwycha bei Moskau zur Kur, und es kamen nicht nur Ulbricht und andere deutsche Genossen, die gerade zum XX. Parteitag in der Stadt weilten, zum Gratulieren ins Sanatorium, sondern auch namhafte KPdSU-Funktionäre, wie ich damals erfreut feststellte. Zwei Tage später, nach dem Ende des Parteitages, gaben die Sowjets zu Ehren des Stellvertretenden DDR Ministerpräsidenten abends einen Empfang. Die Stimmung war gedrückt, Chruschtschow hatte seine Geheimrede gehalten, wovon wir aber nichts wussten. Aber atmosphärisch war zu spüren, dass irgendetwas nicht stimmte. Vizepremier Anastas Mikojan würdigte Vizepremier Otto Nuschke mit einer warmherzigen, anrührenden Ansprache, die auch auf das politische Verhältnis zwischen der UdSSR und der DDR einging. Danach erhob sich Außenminister Wjatscheslaw Molotow und erkläre, das wäre die erste anständige Rede gewesen, die er heute gehört habe … Erst später wurde mir klar, was er damit gemeint hatte. Wie hat man in der CDU die territorialen Veränderungen, die neuen Grenzen, etwa die Oder-Neiße-Grenze zu Polen, diskutiert? Die Partei war gespalten. Aber dass das CDU-Mitglied Georg Dertinger als Außenminister die von Ulbricht und Cyrankiewicz in Warschau am 5./6. Juni 1950 ausgehandelte Deklaration über den Grenzverlauf vier Wochen später als »Görlitzer Abkommen« unterzeichnete, trug zur innerparteilichen Klärung bei. Ich habe in Wroclaw auf Einladung der Pax Christi vor polnischen katholischen Priestern dazu gesprochen. Die Anerkennung der Oder-Neiße Grenze durch die DDR wurde uns im Westen zum Vorwurf gemacht. Adenauer nahm wiederholt dazu Stellung, am 6. Oktober 1951 erklärte er in Berlin namens der Bundesregierung: »Das Land jenseits der Oder-Neiße gehört für uns zu Deutschland.« Drei Tage später stieß SPD-Chef Kurt Schumacher in das gleiche revanchistische Horn: »Die Sozialdemokratie als die Partei, die schon 1945 als erste Partei den unverzichtbaren Anspruch auf die Wiedervereinigung mit diesen Gebieten erhoben hat, begrüßt es, dass die amtliche deutsche Außenpolitik sich zu diesem Ziel bekennt.« Und Berlins Regierender Bürgermeister Ernst Reuter (SPD) sekundierte: »Nicht nur Berlin, Bonn und Stuttgart, auch Leipzig und Dresden, Breslau, Stettin und Königsberg gehören zu Deutschland. Was man uns gestohlen hat, wird man wieder herausgeben müssen.«[39] Tatsache ist: Ohne die Anerkennung des zwischen der DDR und Polen 1950 geschlossenen Grenzvertrages wäre von den Alliierten 1990 keine Zustimmung zur deutschen Einheit erteilt worden. Im 2+4-Vertrag wurde diese völkerrechtlich verbindliche Regelung der DDR aufgenommen. Die DDR hat maßgeblich zur Versöhnung mit dem polnischen Volk beigetragen, was heute ignoriert wird. Hattest du Einfluss auf Ulbricht oder er auf dich? Es war ein gegenseitiges Geben und Nehmen. In diesem Zusammenhang nur zwei kleine Beispiele: Bei Einführung der Wehrpflicht 1962 habe ich mit Ulbricht darüber gesprochen, dass auch für Menschen, die aus christlicher Überzeugung den Dienst mit der Waffe ablehnen, die Möglichkeit gegeben sein sollte, dass sie nicht gegen dieses Gesetz verstoßen müssten, wenn sie ihrem Glauben folgten. In der Folge entstand die Institution der »Bausoldaten«. Die ersten Einheiten habe ich kurze Zeit später in Neubrandenburg besucht. Ein andermal war ich bei Ulbricht und sprach mit ihm darüber, ob nicht trotz der Verweigerung der Anerkennung der Staatsbürgerschaft durch Bonn Rentner in den Westen fahren sollten. Er fand das nachdenkenswert und schlug dann vor, um den »Blockfrieden« nicht durch Eifersüchteleien anderer Parteien zu stören, dass nicht die CDU, sondern besser Thüringens Landesbischof Moritz Mitzenheim diesen Vorschlag öffentlich machen solle. So geschah es denn auch. Ulbricht akzeptierte auch meine Forderung, den Karfreitag arbeitsfrei zu halten. Die Blockparteien hatten in der DDR wesentlich mehr Einfluss, als das heute manche wahrhaben wollen. Es gab wiederholt vertrauliche Unter vier-Augen-Gespräche zwischen Walter Ulbricht und dir. Auch nach dem 13. August 1961, wie ich hörte. Ich kam am 15. August aus Lambaréné, wo ich im Auftrage Walter Ulbrichts dem Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer einen persönlichen Brief überbracht und dem Urwaldarzt die Ehrendoktorwürde der Humboldt Universität verliehen hatte. Schweitzer reagierte überschwänglich und gab mir Post für Walter Ulbricht mit. Bei der Zwischenlandung in Paris hatte es geheißen, in der DDR herrsche Bürgerkrieg und Chaos, ein BRD Diplomat schlug mir vor, statt nach Berlin besser nach Köln-Bonn zu fliegen. In Schönefeld holte mich der Vize-Außenminister Sepp Schwab ab und informierte mich über die Vorgänge am 13. August, den Rest entnahm ich den Zeitungen, die er mitgebracht hatte. Unter anderem las ich, dass auch die CDU im Namen von Gerald Götting den Grenzsicherungsmaßnahmen zugestimmt habe. Ich fuhr direkt zur Sitzung des Staatsrates in der Innenstadt, die sehr kurz war, denn Ulbricht informierte lediglich über die vollzogenen Maßnahmen, die im Aufrag der Warschauer Vertragsstaaten an der Sektorengrenze zu Westberlin und an der Staatsgrenze West zur BRD unternommen worden waren. Danach, bereits außerhalb des Sitzungsraumes, machte ich Ulbricht darauf aufmerksam, dass ich gar nicht im Lande gewesen sei, womit ich ihm zu verstehen gab, dass ich weder um Zustimmung gefragt worden war noch diese hätte erteilen können. Ulbricht stutzte und sagte dann: »Sind Sie etwa dagegen?« Natürlich war ich das nicht. Darauf er wieder: »Na, sehen Sie, dann ist doch alles in Ordnung.« Weil die Sitzung vorzeitig geendet hatte, war sein Auto noch nicht da, und er fragte mich, ob ich ihn mitnehmen könne. Ich wollte zwar in den Parteihauptvorstand, der nicht in Pankow lag, wohin Ulbricht musste. Das Schloss Niederschönhausen war seit 1960 Amtssitz des Staatsrates, das Staatsratsgebäude am Marx-Engels-Platz wurde erst 1964 fertiggestellt. Aber schließlich konnte ich Ulbricht kaum sagen: Nein, ich fahre in eine andere Richtung. Also stieg er in mein Auto. Ach, begann er, da habe ihm Chruschtschow etwas Schönes eingebrockt. Am 1. August, im Vorfeld der Sitzung des Politisch Beratenden Ausschusses in Moskau, habe er, so Ulbricht, ein Gespräch mit Chruschtschow gehabt, bei dem unter anderem auch die Berlin-Frage erörtert worden sei.[Anmerkung 21] Er habe diesem die aktuelle Lage vorgetragen, worauf Chruschtschow erklärte hätte, die DDR solle besser an der Grenze kontrollieren. Zwei Wochen zuvor habe er, Ulbricht, eine Hausmitteilung von Paul Verner, dem Berliner Parteichef, erhalten, der von Karpin, einem für Deutschlandfragen zuständigen Mitarbeiter im Moskauer ZK, erfahren hatte, dass man in der sowjetischen Führung noch immer nicht wisse, wie man mit diesem Problem umgehen solle. Umso überraschter sei er, Ubricht, gewesen, als Chruschtschow in großer Runde mit allen Spitzenleuten des Bündnisses erklärt habe, der Genosse Ulbricht hätte ihm soeben vorgeschlagen, um Westberlin eine Mauer zu ziehen. Er sei, sagte mir Ulbricht auf der Fahrt nach Pankow, wie vom Donner gerührt gewesen. Einen solchen Vorschlag hatte er nie gemacht. Er habe allerdings schlecht in dieser Runde aufstehen und Chruschtschow widersprechen oder gar dementieren können. Und auch außerhalb des Kreml hätte er das wohl kaum öffentlich machen können. Ich sah, dass Ulbrichts Betroffenheit echt und keineswegs gespielt war. Aber er war eben nicht nur Parteisoldat, sondern auch Bündnispartner. Chruschtschow hat das geschätzt. Mich betrübt, dass der Zeitgeist die tatsächlichen Zusammenhänge entstellt und wahrheitswidrig Ulbricht allein für den Mauerbau verantwortlich macht. Du warst einer der Stellvertreter Ulbrichts im Staatsrat. Wie kam es dazu? Nach Piecks Tod hatte kaum jemand mit einem »kollektiven Staatsoberhaupt« gerechnet. Die Bildung des Staatsrates war aber die konsequente Fortsetzung der Politik des Demokratischen Blocks. 1960 begann unter Ulbricht eine neue demokratische Entwicklung. Alle Parteien und auch die parteilosen Bürger waren zur Mitarbeit eingeladen. Wir hatten auch das Recht, Gesetzentwürf einzubringen. Als erster Mann der führenden Partei respektierte Ulbricht die unterschiedlichen Meinungen von CDU, der DBD, der LDPD und der NDPD. Er schlug darum vor, dass deren Repräsentanten Stellvertreter des Staatsratsvorsitzenden wurden. War das nicht eine formale Frage? Keineswegs. Wir hatten tatsächlich Einfluss und waren keine »Blockflöten«, wie wir später abwertend genannt wurden. Als Ulbricht einmal nicht selbst an einer Staatsratssitzung teilnehmen konnte, beauftragte er mich, die Sitzung zu leiten – er hätte auch einen Stellvertreter der SED nehmen können. Als Volkskammerpräsident Johannes Dieckmann (LDPD) 1969 verstarb und diese Funktion neu besetzt werden musste, lud er die Vorsitzenden der Blockparteien ein, um die Nachfolge zu besprechen. Alle gingen davon aus, dass Manfred Gerlach, der LDPD Vorsitzende, es sein würde. Doch zum allgemeinen Erstaunen erklärte Ulbricht, das Amt sei kein Erbhof, und schlug mich vor. Wie hast du diese Votum aufgefasst? Warst du erschrocken, erfreut, verunsichert? Von allem etwas. Auf der anderen Seite: Warum sollte ich nicht über meinen Schatten springen können? Ulbricht vermochte es doch auch. Da gab es beispielsweise diese Präsentation der NVA-Uniformen. Mir und vielen meiner Parteifreunde fiel es schwer, uns überhaupt mit der Bildung nationaler Streitkräfte anzufreunden, doch Ulbricht vermochte uns von der Notwendigkeit zu überzeugen. Und nachdem wir das geschluckt hatten, führte er uns in einen Raum, in dem die Uniformen gezeigt wurden. O Gott, entfuhr es mir laut, die sehen ja aus wie Wehrmacht! Darauf Ulbricht: Wären Ihnen russische Uniformen lieber? – Betretenes Schweigen ringsum. Der Mann, der an der Seite der Roten Armee gegen die faschistische Armee gekämpft hatte, der ein Internationalist war, war zugleich deutscher, als es ihm viele zugetraut hatten. Du hast mit deiner Familie im Gästehaus des Ministerrats in Dierhagen auf dem Darß gelegentlich Urlaub gemacht. Waren da auch die Ulbrichts? Ja. Die bewegten sich völlig normal, liefen am Strand und unterhielten sich mit den Leuten. Angela Merkel meint sich zu erinnern, dass der Strand abgesperrt war. Unsinn. Der war offen für alle, da gab es keine Absperrungen. Die sowjetische Volksbildungsministerin Jekaterina Furzewa kam einmal gleichermaßen verunsichert wie entrüstet zu meiner Frau und mir und empörte sich darüber, dass sie am Strand gelaufen sei und plötzlich auf viele nackte Menschen gestoßen wäre. Da müsse man etwas unternehmen, das wäre doch verboten, sich in der Öffentlichkeit zu entblößen. Nein, beruhigten wir sie, in der DDR sei das erlaubt, dass sich die Menschen zeigten, wie der Herrgott sie geschaffen habe. Das heiße FKK, Freikörperkultur, und sei ganz normal. Sie verstand das nicht. Walter und Lotte sind dort vorbeimarschiert, das hat sie nicht gestört. Da wir schon von der jetzigen CDU Vorsitzenden sprechen: Sie unternahm Vorstöße, die Geschichte der Ost-CDU in die Geschichte der West-CDU zu integrieren. Es gab diesbezüglich Anfragen aus der Konrad-Adenauer-Stiftung bei mir, sie wollte meinen Nachlass haben. Aber da man, wie mir schien, sehr selektiv damit umzugehen gedachten, habe ich meine Unterlagen lieber ans Landesarchiv in Halle gegeben. Wann hast du Walter zum letzten Mal gesehen und gesprochen? Das war nach diesem furchtbaren Unfall, als im Sommer 1972 die IL-62 bei Königs Wusterhausen abstürzte. Ich hielt die Rede für die 156 Opfer und drückte ihm bei der Trauerfeier die Hand. Dass wir uns nicht wiedersehen sollten, ahnte damals niemand von uns. Ulbrichts Tod hat mich erschüttert. Es war nicht nur ein Verlust für die DDR. Ich verlor auch einen verlässlichen politischen Freund. Er hatte meine christliche Weltanschauung respektiert. Ulbricht sah die Gemeinsamkeiten von Marxisten und Christen und tat viel dafür, dass dies im Alltag erfahrbar war.
Elfriede Leymann: »Westpakete« von Walter Ulbrichts Schwester Hildegard
Elfriede Leymann, Jahrgang 1928, geboren und aufgewachsen in Leipzig, Besuch der Arbeiter-und-Bauern Fakultär 1946/47, Jura-Studium an der Leipziger Universität bis 1950, danach Tätigkeit an der Akademie für Staat und Recht in Potsdam-Babelsberg bis 1964, anschließend an der Humboldt Universität zu Berlin an der Sektion Rechtswissenschaft, seit 1976 Außerordentliche Professorin für das Gebiet Verwaltungsrecht. 1988 Emeritierung Den Namen »Ulbricht« hörte ich Anfang der 30er Jahre oft. Mein Vater Rudolf Eichhorn sprach dann von Erich Ulbricht, dem Freund seines älteren Bruders Herbert. Beiläufig wurde auch erwähnt, dass dieser Erich einen älteren Bruder namens Walter habe, der Reichstagsabgeordneter in Berlin sei. Dass auch eine Schwester existierte, erfuhr ich erst in einem Brief aus den USA. Mein Onkel Herbert wunderte sich darin: »Ist es nicht ein komischer Zufall, dass alle drei Geschwister Hilda, Walter und Erich, der Jüngste, alle in demselben Jahr zur Ruhe gingen?« Alle drei Ulbrichts starben im Jahre 1973. Herbert Eichhorn und Erich Ulbricht hatten sich in Leipzig während ihrer Ausbildung zum Bandagisten, heute heißt das Orthopädiehandwerker, kennengelernt. Herbert Eichhorn war, wie er im März 1984 schrieb, »ein wöchentlicher Besucher bei dem alten Schneidermeister Ulbricht und Familie«. Nach ihrer Gesellenprüfung in den Inflationsjahren fanden Herbert Eichhorn und Erich Ulbricht weder in Leipzig noch anderswo in Deutschland Arbeit. Mein Vater erzählte oft, dass beide erwogen, in die Sowjetunion auszuwandern. Doch dafür türmten sich ungeahnte Schwierigkeiten auf. Deshalb beantragte Herbert 1922 die Einreise in die USA, wo entfernte Verwandte für ihn bürgten. So bestieg er im Oktober 1925 ein Schiff nach New York. Im März 1926 folgte ihm seine Frau Elisabeth, meine Tante. Bald bekam er dort festen Boden unter den Füßen, er hatte eine auskömmliche Arbeit. Und so »verhalf ich meinem ehemaligen Lehrlings- und Arbeitsgenossen Erich Ulbricht nach hier zu kommen«, berichtete er mir in jenem Brief. 1928 konnte er ihn und dessen Frau Erna in New York willkommen heißen. Beide blieben ihr Leben lang eng verbunden – als Freunde wie als gefragte Spezialisten für orthopädische Artikel verschiedener Art. Darüber sprach mein Vater wiederholt, reichte auch mal ein Foto von Erich Ulbricht herum, wenn sich einige ehemalige Mitglieder des Kommunistischen Jugendverbandes Anfang der 30er Jahre mit ihren Familien trafen. An Sommersonntagen fuhren sie auf ihren Rädern – der Nachwuchs jeweils auf einem Kindersitz auf Vaters Rad – zu den Lübschitzer Teichen bei Machern, östlich von Leipzig gelegen. Im Winter besuchten sie sich reihum, so in der Sternwartenstraße die Thiemigs (Arthur und Lene), in den Meyerschen Häusern in Plagwitz (die »große Marthl« und ihr Mann), meine Eltern in Leipzig-Schönefeld, später in der Elisenstraße in der Südvorstadt. Ganz in unserer Nähe, in der Scharnhorststraße, lebten die »kleine Marthl« Biller und ihr Gerhard. 1932 lernte ich, an der Hand meiner Oma, die Eltern Ulbricht kennen. Das muss nach Omas erstem Besuch in den USA gewesen sein. Natürlich hatte sie dort Erich und Erna Ulbricht getroffen und – so vermute ich heute – von ihnen Nachrichten, Geschenke und vielleicht auch Geld als Kurier befördert. Unser Besuch bei Ulbrichts war angemeldet: Der Kaffee stand bereit. Der alte Schneidermeister Ulbricht wohnte mit seiner Frau im »Naundörfchen«. Hinter dem wuchtigen Bau der Hauptfeuerwache am Fleischerplatz gelangten wir über eine schmale Brücke in eine richtige Dorfstraße, wie ich sie von Besuchen bei Verwandten in der Marthastraße im Osten Leipzigs kannte. Kleine, meist eingeschossige Häuser, viele mit Fachwerk, reihten sich aneinander, eben das ehemalige Naundorf, das vormals westlich außerhalb der Leipziger Stadtmauern lag. Es war eine Arme Leute-Gegend. So beschrieb es auch Luise Flavin, die Tochter von Walter und Erich Ulbrichts Schwester Hildegard: »Opas Wohnhaus, in dem er mit seiner zweiten Frau lebte, befand sich hinter einem massiven Tor am Ende der Straße. Das verhältnismäßig abgeschlossene Areal wurde auch von den Hausgärten der Wohngebäude in den Nebenstraßen begrenzt. Und ich entsinne mich der riesigen alten Bäume, die dort standen.«[40] Hildegard Ulbricht hatte offensichtlich noch vor Bruder Erich Leipzig verlassen. Sie heiratete einen engagierten Gewerkschafter und brachte 1932 ihre Tochter Luise in Königs Wusterhausen bei Berlin zur Welt. Als Kind weilte Luise, wie sie später Lotte Ulbricht berichtete, oft bei den Großeltern in Leipzig. Für sie war das »Naundörfchen« wie ein Zuhause. Weder sie (noch ich) haben damals bemerkt, dass dieser Ort ein sogenanntes Dirnenviertel und eine verrufene Gegend gewesen sein soll. Wenige Monate nach meinem Besuch im »Naundörfchen« im Frühjahr 1933 lernte ich Erich Ulbricht selbst kennen. Mit seiner Frau Erna und Tochter Ellinor, etwa so alt wie ich, besuchte er meine Eltern in Leipzig-Schönefeld. Für mich als Fünfjährige war das ein außergewöhnliches Ereignis, kamen sie doch aus dem fernen und für mich wunderbaren Amerika, wovon mir meine Großmutter nach ihrer ersten Reise viel erzählt hatte. Aus den Gesprächen der Erwachsenen ist mir in Erinnerung, dass Erich Ulbricht länger als geplant in Leipzig bleiben musste, weil er seinen Pass verloren hatte. Davon sprach mein Vater später wiederholt und mutmaßte, dass dieser Verlust zu diesem Zeitpunkt nicht zufällig gewesen sein könnte. Die Nazis waren an der Macht, und Erichs Bruder Walter Ulbricht – wurde bereits steckbrieflich gesucht. Vater Ernst Ulbricht war, quasi in Mithaftung genommen, als Schneider entlassen worden. Wohl auf Veranlassung von Erich ließ sich deshalb mein Vater, damals Arbeiter im Telegrafenbauamt Leipzig, im Sommer 1933 erst- und letztmalig in seinem Leben eine Hose daheim anmessen und nähen. Ich erinnere mich an den Schneidermeister Ernst Ulbricht als einen mittelgroßen schmalen, etwas gebeugten, sehr stillen Mann. Auch Arthur Thiemig und andere mit meinem Vater bekannte ehemalige Mitglieder des Kommunistischen Jugendverbandes in Leipzig kamen aus Solidarität mit dem arbeitslosen Ernst Ulbricht zu neuen, maßgeschneiderten Hosen. In den Vorkriegsjahren erwähnte mein Onkel Herbert Eichhorn in seinen Briefen Erich Ulbricht nur selten, ungeachtet ihrer engen Verbundenheit. Es wird wohl aus Sicherheitsgründen unterblieben sein. Nach dem Weltkrieg, aus dem mein Vater nicht zurückkehrte, wurde diese Verbindung in die USA für meine Mutter und mich sehr spürbar. Seit 1946 erhielten wir von meinem Onkel regelmäßig sogenannte Care-Pakete aus den USA. Diese waren zollfrei. Nach Gründung der DDR 1949 wurden dafür Zollgebühren erhoben. Wir mussten mit dem schmalen Verdienst meiner Mutter als Reinigungskraft und meinen 150 Mark Stipendium auskommen. Als wir Herbert Eichhorn das mitteilten, kam er auf einen Trick: Er schickte fortan seine Hilfslieferungen an eine Hildegard Niendorf in Bad Seegeberg. Das lag in Schleswig-Holstein und in der Bundesrepublik. Sie musste keinen Zoll entrichten, und der Postverkehr zwischen der BRD und der DDR war ebenfalls zollfrei. Nunmehr bekamen wir und auch andere Verwandte und Bekannte von Onkel Herbert in der DDR die uns zugedachten Sendungen auf diesem Wege. Obwohl ich mich stets bedankte, erhielt ich nie eine Antwort, was mich verwunderte. Fast fünfzig Jahre später erst erfuhr ich, dass diese Hildegard Niendorf in Bad Seegeberg die Schwester von Erich und Walter Ulbricht war. Sie wird wohl ihre Gründe gehabt haben, sich uns gegenüber ein wenig konspirativ verhalten zu haben. Später übernahm Genex[Anmerkung 22] diese Aufgabe. Onkel Herbert schickte zu Weihnachten und an Geburtstagen Dollar, und wir erhielten dafür Geschenke aus Karl-Marx-Stadt. Onkel Herbert Eichhorn starb, jenseits der 80, im Jahre 1987 in den USA. Wir sahen uns zum letzten Mal 1966 in Berlin, als er uns mit seiner Frau in Berlin besuchte. Die Verbindung riss ab, als ich – wie alle Mitarbeiter der Humboldt-Universität, an der ich damals den Lehrstuhl Verwaltungsrecht führte mich schriftlich verpflichtete, keinerlei Kontakte ins kapitalistische Ausland zu unterhalten. Ich unterschrieb, weil ich davon ausging, dass die Korrespondenz mit Herbert über meine Mutter problemlos weiterliefe, was sie auch tat. Mutter lebte seit meiner Heirat in unserem Hause. Auch mein Mann, der im Apparat des Zentralkomitees arbeitete, war von dieser restriktiven Maßnahme betroffen. Dass diese aber auch auf Mutter ausgedehnt wurde, merkten wir, als sie von ihrem Schwager zu einem Besuch in die USA eingeladen wurde. Sie war im Rentenalter und konnte also ins NSW[Anmerkung 23] fahren. Sie erhielt keine Ausreiseerlaubnis. Onkel Herbert sah den Abbruch des Briefwechsels als meine eigenständige, ihn persönlich treffende Entscheidung. Ich sah mich nicht in der Lage, ihm die Situation zu erklären, sie war nicht nur ihm unverständlich. 1983 schrieb er meiner Mutter, ob es denn keine Möglichkeit gäbe, »die politischen Ideen, die uns ungeheuerlich trennen, zu überbrücken. Selbst die drei Ulbricht-Geschwister haben sich am Sterbebett geeinigt und sich inniglich die Hände geschüttelt.« Tatsächlich hatte Schwester Hildegard aus Bad Seegeberg ihren älteren Bruder Walter Ulbricht 1973 kurz vor seinem Tod in der DDR besucht. Ob auch Erich Ulbricht damals in Deutschland weilte, ist nicht bekannt.[41]
Elfriede Brüning: 1933 kam er fast täglich zu uns
Elfriede Brüning, Jahrgang 1910, schloss sich Ende der 20er Jahre der KPD und dem Bund proletarisch revolutionärer Schriftsteller an. Sie wurde 1935 von den Nazis inhaftiert. Nach dem Krieg arbeitete sie für Zeitungen und Zeitschriften, seit 1950 lebt sie als freie Schriftstellerin in Berlin. Bis heute erschienen von ihr 28 Bücher. Dein Vater war Tischler und deine Mutter Näherin, und irgendwann wurdet ihr exmittiert, weil die Werkstatt in der Weltwirtschaftskrise krachen ging. Ja, das war ein Problem, denn nicht nur wir standen auf der Straße, sondern auch unsere Möbel. Die Genossen halfen. Der eine nahm den Schrank mit nach Hause, der andere Stühle und Tisch, ein Dritter das Sofa … Und dann besorgten sie uns eine Wohnung in Moabit. Die hatte drei Ausgänge, eine Tür zur Straße, eine im Hausflur und die dritte führte auf den Hof. Das, so merkte ich erst später, war Kalkül. So konnte man notfalls unbemerkt über den Hof flüchten, wenn vorn etwa die Polizei reinkam. Kalkül von wem? Na, von wem wohl? Von Walter Ulbricht. Er war damals auch der Quartiermeister der Partei. Wir wurden Anfang 1933 gefragt, ob sich bei uns im Hinterzimmer gelegentlich die Genossen treffen könnten, worauf mein Vater sagte: Selbstverständlich, ihr habt uns damals mit den Möbeln geholfen, jetzt helfen wir euch. Dazu muss ich noch nachtragen, dass nicht ein Stück vom Mobiliar fehlte, als wir dort einzogen. Sie brachten alles wieder. Und wer kam da so? Die ganze Parteiführung. Pieck, Ulbricht, ich glaube, dass auch Thälmann einmal dabei war, er wurde bekanntlich bereits am 3. März 1933 verhaftet. Die meisten kannte ich nicht. Im Keller hatte mein Vater sich eine Werkstatt eingerichtet, und beim ersten Treffen stand die Luke auf. Pieck sah die Hobelbank und sagte zu meinem Vater: Na, Kollege. Worauf mein Vater, der extrem kurzsichtig war und Pieck darum nicht erkannte, von unten rief: Biste auch Tischler? Ich war einer, sagte Pieck. Und, was machste jetzt?, erkundigte sich mein Vater wieder. Jetzt bin ich Leimreisender? Vertreter also, kam es aus dem Keller. Ernährt dich denn das? Na, geht so, sagte Pieck und lachte. Und Ulbricht? Der kam fast täglich und traf sich mit irgendwelchen Leuten. Das ging bis zum Herbst, danach blieb er weg. Er war, wie ich nach dem Krieg erfuhr, von der Partei nach Frankreich geschickt worden. Die Gestapo hatte ihn am 1. März zur Fahndung ausgeschrieben, die Partei war verboten. Das erklärt ja auch das hohe Maß der Konspiration. Darum ja auch unsere Ladenwohnung mit den drei Ausgängen. Es war wirklich alles gut durchdacht. Die Nazis sind auch nie dahintergekommen. Du bist doch aber verhaftet worden. Aber nicht deshalb. Wir hatten in unserer Gruppe einen Verräter. Wir lieferten regelmäßig Texte für die Neuen Deutschen Blätter, eine in Prag verlegte Exilzeitschrift. Und er berichtete über ein Treffen von uns im Grunewald an die Gestapo. Deshalb kam ich 1935 ins Frauengefängnis Barnimstraße, wo ich meinen Roman »Junges Herz muss wandern« schrieb, unpolitische Unterhaltungsliteratur. Das Verfahren wegen Landesverrats endete mit einem Freispruch, sie hatten wirklich nichts gewusst, und meine harmlose Schreiberei in der Zelle wird ein Übriges getan haben. Wie war denn Ulbricht so? Auf mich wirkte er irgendwie unnahbar, fast abweisend. Anders als Pieck, der immer freundlich und zuvorkommend war. Ulbricht wirkte stets sehr konzentriert, angestrengt. Gut, er war Reichstagsabgeordneter und Chef des KPD-Bezirks Berlin-Brandenburg Lausitz-Grenzmark, die Partei war verboten und die politische Arbeit illegal, also höchst gefährlich. Das war nicht die Zeit zum Scherzen. Aber trotzdem. Ihn umgab stets eine Aura der Unnahbarkeit. Hast du ihn später darauf mal angesprochen? Wann »später«? Nach dem Krieg, zu DDR-Zeiten. Du hast doch schließlich den Vaterländischen Verdienstorden in allen drei Stufen bekommen … Da war er schon tot. Erlaube, dass ich widerspreche. 1960 gab es den VVO in Bronze. Hat er ihn nicht verliehen? Nein, ich glaube, den habe ich damals von Ministerpräsident Otto Grotewohl bekommen, nicht von Walter. Also noch mal gefragt: Hast du jemals über 1933 mit Walter Ulbricht gesprochen? Nein. Ich habe nach 1933 niemals wieder mit Ulbricht gesprochen. Es hat sich einfach nicht ergeben. Und nun ist er auch schon wieder vierzig Jahre tot und ich bin über hundert.
Heinz Keßler: Ich lernte ihn 1941 im Lager als einen Antifaschisten kennen
Heinz Keßler, Jahrgang 1920, Roter Jungpionier, Mitglied des Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands, Wehrmachtssoldat, 1941 Übertritt zur Sowjetarmee, vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt. Das Urteil ist bis heute nicht aufgehoben. Frontbeauftragter des Nationalkomitees »Freies Deutschland«. Seit dieser Zeit befreundet mit Walter Ulbricht. Mitbegründer der FDJ, Mitglied des Parteivorstandes bzw. des Zentralkomitees der SED von 1946 bis 1989, Abgeordneter der Volkskammer bis 1990, seit 1986 Mitglied des Politbüros des ZK der SED, führend am Aufbau der Streitkräfte der DDR beteiligt, zuletzt Minister für Nationale Verteidigung der DDR, Armeegeneral. Heinz, mit über neunzig Jahren bist du ein Jahrhundertzeuge. Du kennst Walter Ulbricht aus der sowjetischen Emigration, hast ihn 1943 als Mitbegründer des Nationalkomitees »Freies Deutschland« erlebt, warst als Aktivist der ersten Stunde dabei, als er 1945 das neue Leben in Berlin organisieren half, kennst ihn vom Vereinigungsparteitag, warst mit ihm seit 1946 ununterbrochen im Parteivorstand bzw. im Zentralkomitee der SED und hast ihn als deinen Vorgesetzten im Nationalen Verteidigungsrat der DDR und gleichzeitig als Freund der Familie erlebt. Wenn du ihn in wenigen Worten charakterisieren solltest – was würdest du hervorheben? Für mich steht er in einer Reihe mit Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, Ernst Thälmann und Wilhelm Pieck. Er war über sechzig Jahre Gewerkschafter und fast ebenso lang Kommunist. Insofern verkörpert er für mich gute Traditionen der deutschen und der internationalen Arbeiterbewegung. Zeitlebens war er ein Lernender, hat sich vom Tischler zum Staatsmann entwickelt, war ein schöpferischer Marxist. Er hatte Charakter. Auf sein Wort war Verlass. Er war ein Mensch mit Stärken, Schwächen und Kanten. Für mich ein Vorbild. Wann bist du ihm zum ersten Mal begegnet? Das war im Spätsommer 1941 im Lager 27 in Krasnogorsk 27 Kilometer westlich von Moskau. Mich befragten dort drei Personen. Der eine war Rudolf Lindau,[Anmerkung 24] die andere stellte sich als Lotte Kühn vor, und der dritte war Walter Ulbricht. Erstmals seit meiner Desertion aus der Naziwehrmacht in Belorussland vor einigen Wochen traf ich auf deutsche Emigranten. Sie wollten von mir wissen, wie die Stimmung unter den Deutschen sei. Mein Urteil, das sah ich ihnen an, befriedigte sie nicht so richtig, um nicht zu sagen: es missfiel. Ich sagte, dass die übergroße Mehrheit der Deutschen der faschistischen Ideologie verfallen sei. Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere folgten bedingungslos ihrem Führer, es sei illusorisch zu glauben, dass sich da in absehbarer Zeit etwas ändere. Die meisten Soldaten hielten den Krieg gegen die Sowjetunion sogar für gerechtfertigt. Daraufhin erkundigten sie sich, warum ich dann übergelaufen sei. Weil mir meine Mutter, so sagte ich, vom Kommunismus überzeugt wie mein Vater, mit auf dem Weg gegeben hatte: Jeder Mensch macht Fehler. Aber einen Fehler mache bitte nie: Lass dich nicht in einen imperialistischen Aggressionskrieg gegen die Sowjetunion schicken. Dass ich diesen Rat beherzigte, führte dazu, dass sie von den Nazis ins KZ gesteckt wurde. Erst später erfuhr ich, dass sie von 1941 bis 1945 in Ravensbrück leiden musste. Wie verlief dein erstes Gespräch mit Ulbricht? Er fragte mich, was mir für die nächste Zeit so vorschwebe. Ich antwortete ohne zu zögern, dass ich mithelfen wolle, den Krieg zu beenden, auf welche Weise, auf welchem Platz auch immer, wenn möglich auch direkt an der Front. Ulbricht lächelte in seiner bekannten Art, meinte, das sei sehr zu begrüßen, aber gegenwärtig unmöglich. Die militärische und politische Lage sei zu schwierig und zu unübersichtlich. Ich wusste, dass der deutsche Vorstoß an allen Frontabschnitten ungebrochen weiterging, dass starke deutsche Truppenverbände im Marsch auf Moskau waren und bald vor der Hauptstadt stehen würden. Also sollte ich warten, man würde mich sicher rechtzeitig über meine Aufgaben unterrichten. So gingen wir auseinander. Wenige Wochen später, im September, wurden Franz Gold,[Anmerkung 25] ein böhmischer Kommunist, der erst vor wenigen Tagen übergelaufen war, und ich zur Lagerleitung gerufen. Dort erwarteten uns diese drei erneut. Diesmal aber führte Walter Ulbricht das Wort. Die militärische und wirtschaftliche Situation in und um Moskau sei inzwischen nicht einfacher, sondern eher noch komplizierter geworden, sagte er. Die entscheidende Schlacht zur Verteidigung der Hauptstadt und damit der Sowjetunion stehe bevor. Es sei notwendig, die inzwischen hier in Frontnähe zusammengeführten Kriegsgefangenen ins tiefe Hinterland zu transportieren. Er fragte mich und Franz Gold, ob wir bereit seien, beim Aufbau eines solchen Lagers an einem neuen Standort – wo immer der auch sein würde – mitzuhelfen. Dort sollten wir nicht nur die sowjetische Lagerleitung unterstützen, sondern auch antifaschistische Überzeugungsarbeit unter den Kriegsgefangenen leisten. Unsere Erfahrungen wollte man danach auf andere Lager übertragen. Das sei, so erklärte uns Ulbricht, nicht nur notwendig, um die Disziplin aufrechtzuerhalten und das Leben im Lager einigermaßen erträglich zu gestalten. Es gehe auch darum, dass die Kriegsgefangenen begriffen, dass sie einer verbrecherischen Propaganda und Politik zum Opfer gefallen waren und daraus für das eigene Leben Schlüsse ziehen sollten. Für sie war der Krieg zu Ende, sie hatten überlebt – und müssten diesem Leben einen neuen Sinn geben. Und sei es nur den, dass sie den Schaden wiedergutmachten, den sie in der Sowjetunion angerichtet hatten, indem sie ordentlich arbeiteten: im Wald, in Bergwerken, in Produktionsbetrieben. Ulbricht argumentierte schlüssig und überzeugend, und ich fand ihn von Anfang an auch deshalb sympathisch, weil er Sachse war wie ich: Er kam aus Leipzig, ich aus Chemnitz. Gold und ich waren dazu prinzipiell bereit, auch wenn wir viel lieber aktiv an der Front gekämpft hätten. Wie ging es dann weiter? Die Verlegung des Lagers Nr. 27 begann bereits wenige Tage später. Wir wurden – wie Tausende andere Gefangene auch – in Waggons gesperrt, die für die große Zahl der Menschen viel zu klein waren. Die Luft war binnen kurzem stickig, es war dunkel, und nur durch einige wenige Ritzen drang Licht von außen herein. Die Fahrt war physisch wie auch psychisch furchtbar, was ich aber verstand. Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen sowjetischer Menschen wurden zur selben Zeit nach dem Osten evakuiert, aus der künftigen Kampfzone gebracht, zehntausende Industriebetriebe wurden demontiert, verlegt und im sicheren Sibirien und in Mittelasien neu aufgebaut. Eine wahnsinnige logistische Leistung. Da waren die Kriegsgefangenen quasi Ballast und unnütze Esser. Und dennoch sorgte man sich um uns und für uns. Es war nicht so wie auf der deutschen Seite, wo – wie wir heute wissen – von den etwa 5,7 Millionen kriegsgefangenen Rotarmisten rund 3,3 Millionen systematisch durch Hunger, Seuchen, Ausbeutung und Hinrichtungen zu Tode kamen. Nächst den Juden waren die Rotarmisten die größte Opfergruppe der faschistischen Diktatur.[42] Wie lange wart ihr unterwegs? Nach drei Wochen erreichten wir Karaganda. Unterwegs bekamen wir jeden Tag ein Stück Brot, einen Becher Tee mit einem kleinen Stück Zucker und ab und zu eine kleine Scheibe Speck. Wir fielen aus den Eisenbahnwagen und marschierten mehrere Stunden durch die Steppe. Dann erreichten wir ein winziges Lager. Die Baracken reichten nicht, wir mussten erst weitere bauen. Wir schliefen in der ersten Zeit unter freiem Himmel und spürten die nächtliche Kälte. Die Arbeit war sehr schwer, der Hunger – bei nur 250 Gramm Brot am Tag und ab und zu einer Schüssel dünner Suppe, die kaum sättigte – schmerzte. Es war natürlich nicht leicht, den anderen Gefangenen zu erklären, dass die Russen von den gleichen kleinen Rationen leben mussten. Hinzu kam, dass uns eine Typhuswelle heimsuchte, die auch meinen neuen Freund Franz Gold traf. Ich wurde Brigadier und musste bei der Arbeit für Ordnung und Disziplin sorgen und auch Streit schlichten. Es kam unter den gereizten Kriegsgefangenen zu Schlägereien und Übergriffen sowie Kameradendiebstählen. Ende November, der Wind fegte über die Steppe und trieb uns Sand und Schnee ins Gesicht, fiel die Arbeit mit Beil und Säge und unhandlichen Holzpfählen immer schwerer. Wir mussten öfter die Arbeit unterbrechen, um uns aufzuwärmen, und sei es nur dadurch, dass wir die Arme kräftig an den Leib schlugen. Da kam ein Mann auf uns zu, offensichtlich aus dem Stab der Lagerleitung, sicher kein Gefangener, sondern ein Russe oder Emigrant, denn er trug Zivilkleidung: einen dicken Schaffellmantel, eine »Schapka«, die typische Fellmütze, und »Walenki«, die wärmenden Filzstiefel. Ich sagte, dass die Kälte heute besonders schlimm und zermürbend sei. Da warf er mir einen Satz an den Kopf, der mich wütend machte – vermutlich hatte er sich nichts dabei gedacht, vielleicht hielt er ihn für witzig, mich empörte er. Er sagte nämlich: »Wenn ich so langsam arbeiten würde wie du, dann zitterte ich auch vor Frost.« Ich schoss zurück: »Hätte ich einen Mantel, eine Schapka und Walenki wie Sie«, ich betonte das »Sie« demonstrativ, »dann würde ich bestimmt auch schneller arbeiten. Und wenn Sie mir nicht mehr zu sagen haben als dies, dann lassen Sie mich in Ruhe!« Gut, gut, wiegelte er ab, entschuldigte sich und lud mich zu sich ins Büro, vielleicht könne man etwas zur Erleichterung der Arbeit unter diesen Bedingungen tun. Der Mann hieß Heinz Hoffmann,[Anmerkung 26] der sich hier aber »Roth« nannte. Er war ein Kommunist aus Mannheim, der vor Madrid gegen Franco gekämpft hatte und dort schwer verwundet worden war, dann nach Moskau kam, wo er politische Arbeit leistete. Dann hatte man ihn gemeinsam mit einem weiteren Interbrigadisten, Herbert Grünstein,[Anmerkung 27] nach Karaganda kommandiert. Wir wurden gute Freunde, viele Jahre war Hoffmann als Verteidigungsminister mein Chef und Vorgänger. In der gleichen Zeit, als wir in der kasachischen Steppe unter gewiss schweren Bedingungen das Lager errichteten, wurden auch sowjetische Kriegsgefangene im KZ Sachsenhausen interniert. Im Oktober 1941 testete man an ihnen die ersten Vergasungsautos, und auch Typhus raffte sie in dieser Zeit dahin. Und die, die überlebten, wurden Nacht für Nacht zur Hinrichtung geführt. Bis Mitte November starben allein in Sachsenhausen etwa 18.000 Rotarmisten, davon rund 15.000 durch Genickschuss. Hast du in jener schweren Zeit auch Ulbricht wiedergesehen? Ja, er kam im Dezember gemeinsam mit Arthur Pieck[Anmerkung 28] und Hans Mahle[Anmerkung 29] aus Moskau zu uns. Die als Delegation der KPD aus Moskau angekündigte Gruppe wollte schauen, ob es hier Erfahrungen gab, die auch in anderen Lagern genutzt werden konnten, und mit uns Weihnachten feiern. Die große Schwierigkeit, an die niemand zuvor gedacht hatte, war einen Tannenbaum zu bekommen. In Kasachstan, in der weiten Steppe, wuchsen, wenn überhaupt, nur wenige Bäume, allerdings keine Tannenbäume. Ich weiß bis heute nicht, auf welch abenteuerlichen Wegen es dennoch gelang, Tannenbäume zu schaffen. Auf alle Fälle – die Weihnachtsfeier mit Walter Ulbricht in der Steppe fand mit Baum statt. Am Ende der Visite wertete Ulbricht gründlich aus. Er befand, dass die hier tätigen Emigranten (Heinz Hoffmann, Herbert Grünstein und andere) und eine Reihe von Antifa-Aktivisten (darunter Franz Gold und ich) bisher eine ordentliche Arbeit geleistet hätten. Es gebe ein Lageraktiv, Zirkel und Arbeitsgemeinschaften. Ulbricht fragte uns, ob wir noch einmal die Schulbank drücken wollten. Im Januar 1942 würde in Oranki, südlich von Gorki an der mittleren Wolga, die erste Antifa-Schule ihre Arbeit aufnehmen. Es war, wie man heute sagen würde, ein Pilotprojekt mit dem Ziel, zunächst im Verlauf von vier, fünf Monaten Erfahrungen zu sammeln, um sie danach für die später in größerer Zahl vorgesehenen Schulen zu nutzen. Was war damit gemeint? Erich Weinert,[Anmerkung 30] der sich später mit den Vorwürfen auseinandersetzte, in den sowjetischen Antifa-Schulen werde »Gehirnwäsche« betrieben, die Kriegsgefangenen würden dort »indoktriniert« und »auf Linie« gebracht, erklärte schon vor der Eröffnung der Schule in Oranki: »Es ist nicht die Absicht, in diesen Schulen die Kursanten durch eine sogenannte Weltanschauungsmühle zu drehen, dass auf der einen Seite der unfertige Mensch steht und auf der anderen Seite der fertige Marxist herauskommt. Die Kurse haben den Sinn, sie vertraut zu machen mit einer Denkmethode, mit einer Untersuchungsmethode, die erfahrungsgemäß die besten Einblicke gewährt in die Hintergründe der Bewegungsgesetze der menschlichen Gesellschaft.« Leiter der Schule war der Philosophieprofessor Nikolai Jantzen. Zum Lehrkörper gehörten erfahrene Politiker wie Rudolf Lindau (Spezialist für Geschichte der Arbeiterbewegung), Hermann Matern (für alle Fragen der Einheits- und Volksfrontpolitik), Edwin Hoernle (für Fragen der Agrarpolitik), Wilhelm Florin (Gewerkschaftpolitik), Lene Berg (Fragen der Sozialpolitik und der Frauenbewegung), Heinz Hoffmann (für Geschichte des Krieges und der Militärpolitik), Anton Ackermann (Internationale Beziehungen, Literatur und Kulturpolitik) und andere deutsche Antifaschisten. Sie hielten vor dem ganzen Lehrgang Vorträge auf ihrem Fachgebiet und arbeiteten zugleich auch als Klassenleiter für kleinere Gruppen, mit denen sie Seminare abhielten sowie Diskussionen über den jeweiligen Stoff und über die bei uns aufgetretenen Fragen leiteten. Sie gaben die Themen für die Belegarbeiten vor und bewerteten sie – eine Form, die erfolgreich anstelle von Prüfungen praktiziert wurde. Es ist erstaunlich und spricht für die Siegeszuversicht der sowjetischen Militärs und Politiker, eine solche Einrichtung im Januar 1942 ins Leben zu rufen, als die deutschen Truppen vor Leningrad, Moskau und Stalingrad standen, der europäische Teil der Sowjetunion weitgehend besetzt war und der Kriegsausgang eigentlich offen schien. Denn dass ihr, die ehemaligen Wehrmachtangehörigen, für die Zeit nach dem Kriege, für Deutschland ausgebildet wurde, war ja wohl klar. Nun ja, das vermittelte Wissen konnten wir Absolventen überall gebrauchen, es befähigte, auf vielen Gebieten zu arbeiten. Als nach fünf Monaten der Lehrgang abgeschlossen war, kehrten die meisten von uns in die verschiedenen Gefangenenlager zurück, um dort Antifa Aktivs aufzubauen und zu leiten. Andere wurden als Lehrer an Antifa-Schulen eingesetzt, die später entstanden. Franz Gold, ein österreichischer Kamerad namens Zwiefelhöfer und ich kamen wieder nach Krasnogorsk. Dort traf ich auf Dr. Frida Rubiner, schon in den 60ern, eine Veteranin der deutschen Arbeiterbewegung. Sie hatte zwischen 1914 und 1918 im Schweizer Exil Lenin kennengelernt und mit ihm zusammengearbeitet, mit Rosa Luxemburg und Clara Zetkin war sie befreudet gewesen. Da war Alfred Kurella, der lange in der Komintern an der Seite von Georgi Dimitroff gearbeitete hatte, und der bekannte sowjetische Orientalist Prof. Josef Samuilowitsch Braganski, dessen Buch »Mussolini ohne Maske« mir meine Mutter daheim zum Lesen gegeben hatte. Diese Personen instruierten uns, wie wir an und hinter der Front mit Flugblättern und Lautsprechern deutsche Soldaten zum Überlaufen bewegen könnten. Wir wurden im Kessel von Welikije Luki eingesetzt, wo eine faschistische Einheit unter dem Kommando eines Ritterkreuzträgers einen sinnlosen Kampf führte. Ich will es kurz machen, die Aktion war nur bedingt erfolgreich, der Kessel wurde von der Roten Armee gesprengt, die Verluste auf beiden Seiten waren hoch. Dennoch wurden unsere Einsatz-Berichte an der ganzen Front ausgewertet. Mir ist ein Bild aus meinem DDR Geschichtsbuch der 8. Klasse in Erinnerung, das dich als Frontbeauftragten des Nationalkomitees »Freies Deutschland« an der Narva-Front zeigt. Im ersten Halbjahr 1943 war ich bei sehr vielen Fronteinsätzen dabei. Einmal erhielt ich einen Streifschuss, und Franz Gold, der selber krank war und fieberte, schleppte mich mehrere Kilometer weit zum Sanitätsstützpunkt. Von dort brachte man uns nach Moskau. Auf dem Weg dorthin wurden wir verhaftet und fast an die Wand gestellt, weil zwei aufmerksame Partisaninnen bemerkt hatten, dass wir Deutsche waren und uns darum für Spione hielten. Im Mai/Juni, nach meiner Genesung, setzte man mich im Raum Kursk ein, dann kehrte ich wieder nach Krasnogorsk zurück. Im dortigen Kriegsgefangenenlager 27 schlug Hans Gossens[Anmerkung 31] vor, einen nationalen Ausschuss oder ein Komitee zu bilden, welches ein erster Schritt auf dem Weg zu einer deutschen Friedens- und Freiheitsbewegung sein könnte. Diese Idee wurde lebhaft diskutiert und ein »Vorbereitender Ausschuss« ins Leben gerufen, dem neben Erich Weinert vier weitere politische Emigranten und vier Kriegsgefangene (Hadermann, von Kügelgen, Strehsow und Eschborn) angehörten. Der Ausschuss richtete einen Gründungsaufruf an alle deutschen Soldaten und Offiziere in den Kriegsgefangenenlagern der Sowjetunion. Auf jener Versammlung im Lager 27 in Krasnogorsk hatte auch ich das Wort ergriffen. Ich war 23 Jahre alt und drückte direkt und ungestüm aus, was viele Soldaten inzwischen empfanden: »Hitler wird auch ohne uns geschlagen werden. Aber damit können wir deutschen Patrioten nicht zufrieden sein. Warum? Weil wir wissen, dass diese Bande den Namen des deutschen Volkes mit Dreck besudelt hat und dass nur wir selbst uns von diesem Dreck reinwaschen können. Die Zeit ist gekommen, wo mit großen Reden und Lippenbekenntnissen nichts mehr getan ist. Kameraden, jeder sollte sich überlegen, was der heutige Schritt bedeutet: Kämpfe wird es viele geben, leicht wird es nicht sein. Denn es geht nicht um ein Butterbrot, sondern um Deutschland.« Am 12. Juli 1943 fand im Klubhaus von Krasnogorsk, im Saal des dortigen Ortssowjet, die Gründungsversammlung der Bewegung »Freies Deutschland« statt. An ihr nahmen dreihundert Delegierte teil – es war also kein verschwiegenes Treffen von Verschwörern, sondern eine Zusammenkunft von sehr selbstbewussten, national gesinnten Männern, die alle auf weitaus größeren Versammlungen in den verschiedenen Kriegsgefangenenlagern vorgeschlagen und ordentlich für diese konstituierende Sitzung gewählt worden waren. Stimmt. Beteiligt waren auch deutsche Emigranten, die seit fast zehn Jahren in der Sowjetunion lebten und arbeiteten, ehemalige Reichstagsabgeordnete, Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre und auffallend viele Schriftsteller und Publizisten. Daneben – und dies war die Mehrheit – saßen die Delegierten der Kriegsgefangenen, die sich zu diesem Schritt entschlossen und ihre antifaschistische Haltung schon mehrfach bewiesen hatten: Soldaten und Offiziere bis zum Major. Die höheren Dienstränge wie Oberste und Generale fehlten. Offenbar herrschten in den Offizierslagern noch sehr stark die alten Hierarchien und ein nationalistisch geprägter Korpsgeist, was manche noch zögern ließ, die eigentlich schon zum Bekenntnis und zur Aktion bereit waren. Sicher mochte auch die Furcht eine Rolle spielen, von den »Roten« vereinnahmt zu werden. Immerhin, drei Beobachter hatten sie entsandt, das Interesse an der Konferenz und ihren Argumenten war vorhanden. Die Berichte vom Verlauf der Konferenz trugen jedenfalls dazu bei, dass einige Wochen später in Jelabuga, nach einer Rede von General von Seydlitz und einer sehr überzeugenden Ansprache des Gefreiten Hans Zippel vom Nationalkomitee der »Bund Deutscher Offiziere« (BDO) gegründet wurde, der sich im September 1943 schließlich mit dem NKFD vereinigte. Walter Ulbricht wurde in eine Schlüsselfunktion gewählt. Er sollte die operative Leitung führen. Diese fungierte als ein Organ des Geschäftsführenden Ausschusses, der zwischen den Plenartagungen des NKFD die Bewegung vertrat und leitete und dem Plenum rechenschaftspflichtig war. Über das Nationalkomitee »Freies Deutschland«, sein Wirken als Teil der Antihitlerkoalition in vielen Staaten und die Folgen, ist viel publiziert worden, das muss ich hier nicht wiederholen. NKFD-Präsident Erich Weinert räumte im November 1945, als das Komitee offiziell aufgelöst wurde, selbstkritisch ein, dass es trotz aller Leistungen das im Gründungsmanifest fixierte Ziel nicht erreicht hatte. Es sei nicht gelungen, dass sich deutsche Einheiten unter ihren Kommandeuren geschlossen gegen den schon verlorenen Krieg erhoben hätten. Erfolglos die Bemühungen, eine Mehrheit der Bevölkerung zum sichtbaren Protest zu bewegen. Deutschland wurde nicht durch das deutschen Volk befreit, erst die alliierten Armeen hätten in schweren, opferreichen Kämpfen die Nazidiktatur und den Krieg beendet. Wie lange warst du als Frontbeauftragter des NKFD im Einsatz? Bis Ende 1944. Nach der Kursker Schlacht musste ich aus gesundheitlichen Gründen aufhören, ich war völlig erschöpft und wurde nach Ljunowo geschickt, in jenes Lager also, in welchem die deutschen Generäle untergebracht waren. Dort traf ich Generalfeldmarschall Paulus, die Generäle Seydlitz, Lattmann und Müller. Wir hatten intensive und wichtige Gespräche. Als die Offensive der Roten Armee auf Berlin begann, bereiteten wir uns in der Zentrale des Komitees auf die Nachkriegszeit vor. Es fanden in einem verhältnismäßig kleinen Kreis besonders aktiver NKFD-Aktivisten Diskussionen statt. Diese konzentrierten sich auf drei Aufgaben. Eine relativ kleine Gruppe wurde vorbereitet, um in den letzten Kriegsmonaten illegal nach Deutschland zurückzukehren und die Widerstandsgruppen im Lande tatkräftig zu unterstützen. Eine zweite Gruppe beschäftigte sich mit unterschiedlichen Maßnahmeplänen für eine rasche Normalisierung des Lebens bei Kriegsschluss. Und die dritte Gruppe befasste sich mit dem wohl schwierigsten Gebiet – mit der Jugendarbeit in Deutschland. Es galt, die Nazi-Ideologie aus einer ganzen Generation zu tilgen. Denn wie tief diese in die Köpfe eingedrungen war, sah man bei den fanatischen Hitlerjungen im Volkssturm. Mir war schon gesagt worden, dass dies für die nächste Zeit das Hauptfeld meiner Arbeit werden würde. So erörterte im November 1944 eine Kommission die »Bekämpfung der faschistischen Ideologie« und die »Neugestaltung des Schulwesens«. Geleitet wurde die Kommission von General Korfes, Mitglieder waren unter anderem der Kommunist Johannes R. Becher, der Sozialdemokrat Fritz Rücker, der ehemalige Studienrat Ernst Hadermann, die Journalisten Theo Grandy und Günter Kertzscher. Ich hörte dort erstmals solche Begriffe wie »Konzeption einer demokratischen Schule«, »Erneuerung der Lehrerschaft«, »Neuprofilierung der Hochschulen« und »Berufswettkampf«. Du bist dann, praktisch im Gefolge der Gruppe Ulbricht, im Mai 1945 nach Berlin geflogen? Um präzise zu sein: Wir landeten am Abend des 28. Mai in Tempelhof. Wilhelm Pieck hatte uns in Moskau verabschiedet, wir waren die zweite Gruppe deutscher Antifaschisten, die von dort nach Berlin entsandt wurde. Die Gruppe Ulbricht war schon seit vier Wochen vor Ort. Bereits in Moskau war entschieden worden, was jeder von uns zu machen hatte. Ein Teil von uns blieb in Berlin, um sich der Gruppe Ulbricht anzuschließen, ein anderer zog weiter nach Schwerin, und der dritte Trupp machte sich nach Dresden auf den Weg. Nach der Landung fuhren wir in einem ramponierten Kleinbus zunächst nach Karlshorst, wo die bedingungslose Kapitulation unterzeichnet worden war. Dort hatte jetzt der sowjetische Oberkommandierende in Deutschland, Marschall Georgi Shukow, seinen Sitz. Eingerichtet hatten sich auch die Berliner Stadtkommandantur und zahlreiche andere Dienststellen der sowjetischen Armee. Wir wurden noch spät am Abend von Walter Ulbricht und Otto Winzer begrüßt, dann teilte man uns die Termine der nächsten Tage mit und wies uns die Adressen zu, wo wir fürs Erste untergebracht werden sollten. Die Quartiere lagen alle in Karlshorst, wo verhältnismäßig viele Häuser vom Krieg verschont geblieben waren. Ich lebe ja unverändert in diesem Kiez, von hier bis zum deutsch-russischen Kapitulationsmuseum sind es nur wenige hundert Meter. Kannst du dich noch an die Fahrt von Tempelhof nach Karlshorst erinnern? Natürlich. Es war entsetzlich. Wir fuhren durch eine weite Steinwüste, auf der kein Haus mehr stand, überragt nur von gespenstisch zerklüfteten Ruinen, von Hausskeletten, bedeckt mit Bergen von Schutt, geborstenem Mauerwerk, verkohlten, kaum noch kenntlichen Überresten von Möbeln, Türen, Dielen und den spärlichen Bruchstücken von Öfen, Wannen und Hausrat. Die Bäume waren von den Granaten förmlich zu Stümpfen zerhackt. Und es roch überall nach Tod und Verwesung. Ulbricht soll dir gleich nach deiner Ankunft gesagt haben, dass du »die Jugendarbeit« in Berlin zu organisieren hättest. Was ist darunter zu verstehen? Zunächst half Walter mir, meine Mutter zu finden, die von der Roten Armee aus dem KZ befreit worden war. Nachdem ich kurz in Chemnitz bei meiner Familie gewesen war, meldete ich mich auftraggemäß bei Otto Winzer, der als Stadtrat für Volksbildung und Kultur eingesetzt worden war. Parteien waren noch nicht zugelassen, an Jugendorganisationen nicht zu denken. Beim Magistrat von Groß-Berlin sollte ein Hauptjugendausschuss aufgebaut werden, der die jungen Menschen »einsammelte«, sie beschäftigte und aus ihrer Apathie, die überall nach dem Ende des Hitlerreiches zu beobachten war, herausholte. Am meisten erschreckte mich der Zeitdruck, denn schon am 20. Juni wollte der Magistrat einen Beschluss über die Bildung und die Arbeitsweise des Jugendausschusses fassen – aber bis dahin sollten die ersten Schritte schon getan, die ersten Erfahrungen gewonnen worden sein. Zum Glück fand ich Unterstützung durch junge Freunde, die zum Jugendausschuss stießen und aktiv mitarbeiteten. Ich denke besonders an Erich Ziegler, der zur Widerstandsgruppe Heinz Kapelle gehört hatte, zu lebenslanger Haft verurteilt und dann aus dem Zuchthaus Brandenburg-Görden befreit worden war. Ich denke an Gerd Sredzki und Willi Betsch, an die Kameraden Herbert und Heinz Fölster, an meine jüdischen Freunde Siggi Sternberg und Klaus Rosenthal, der aus der englischen Emigration nach Berlin zurückgekommen war, an Gerhard Klein, der später Filmregisseur wurde und durch seinen Jugendfilm »Berlin – Ecke Schönhauser« bekannt wurde, an die jungen Sozialdemokraten Friedel Hoffmann, Gerhard Spraffke und Ilse Reichel, sie sollte von 1971 bis 1981 Senatorin für Jugend, Familie und Sport in Westberlin werden. Später stießen auch Vertreter der Religionsgemeinschaften zu uns, so der katholische Domvikar Robert Lange und der evangelische Pfarrer Oswald Hanisch. Und zum Glück gab es die sowjetischen Jugendoffiziere, zum großen Teil selbst noch Komsomolzen, sehr gebildete junge Männer, die Deutsch sprachen, die deutsche Literatur gut kannten und gern in Diskussionsveranstaltungen auftraten, die wir organisierten. Sie ebneten uns zudem viele Wege bei den Behörden, später auch zu den alliierten Dienststellen in Westberlin, sie stellten Lebensmittel zur Verfügung und fanden Unterkünfte, die für die Jugendarbeit geeignet waren. Hattest du in jenen Wochen auch mit Walter Ulbricht zu tun? Selbstverständlich. Am Abend des 10. Juni trafen sich die Beauftragten des ZK der KPD, die im Mai nach Berlin gekommen waren, zum letzten Mal in der Prinzenstraße in Lichtenberg. Walter erläuterte uns den Befehl Nr. 2, den die Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) erlassen hatte. Befehl Nr. 1 war am Vortag ergangen: Marschall Shukow hatte darin die Gründung der SMAD angeordnet und deren Struktur und Aufgaben formuliert. Mit Befehl Nr. 2 erlaubte Shukow in der sowjetisch besetzten Zone und in Berlin ab sofort die Tätigkeit demokratischer Parteien und Gewerkschaften. Einzige Bedingung: sie mussten entschieden antinazistisch zu sein. Ulbricht erläuterte uns, wie das zu werten sei. Nach seiner Interpretation signalisierte die Besatzungsmacht, dass sie das Land nicht nur nach Besatzungsrecht verwalten wollte, sondern von Anbeginn an der Mitarbeit deutscher Parteien und Organisationen interessiert war. Sie wünsche, so Walter Ulbricht, die Stärkung der deutschen Selbstverwaltungsorgane, die von der Bevölkerung getragen und gestützt werden müssten. In den anderen Besatzungszonen wurde die Tätigkeit von Parteien erst Wochen, mancherorts Monate später erlaubt. So war es. Walter kündigte also die Neugründung der KPD an und signalisierte die Veröffentlichung eines programmatischen Aufrufes, der gegenwärtig noch mit Stalin abgestimmt werde. Offenkundig ging das rasch: Er wurde bereits am nächsten Tag an die Öffentlichkeit gegeben. Er wurde an Litfaßsäulen und Häuserwände geklebt, auf Flugschriften und in der Berliner Zeitung, die seit dem 21. Mai erschien, veröffentlicht. Für mich und meine engsten Mitarbeiter war wichtig, dass darin zu Fragen der Jugend, zu ihren Rechten und Pflichten Stellung genommen wurde. Dabei war es nicht einmal das Allerwichtigste, dass wir nun mit diesem Aufruf in der Hand vor junge Menschen hintreten konnten, um mit ihnen über ihre eigenen Chancen und Aufgaben zu sprechen. Hätten wir dies so einfach und plump getan – das Echo wäre zunächst nur sehr verhalten gewesen, der Widerspruch jedoch nicht weniger schroff als vorher. Die Skepsis gegenüber Programmen jeglicher Art, gegen wortreich proklamierte Ziele, was immer sie versprachen, saß zu tief. Am 12. Juni trafen sich etwa zweihundert antifaschistische Funktionäre verschiedener Richtungen im Neuen Stadthaus. Walter Ulbricht diskutierte mit ihnen die Bildung eines antifaschistisch-demokratischen Blocks. Am 15. Juni wurde die SPD gegründet und trat ebenfalls mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit – es war erstaunlich, wie ähnlich sich die Programme der beiden Arbeiterparteien in den Grundpositionen waren. Wenig später bildeten sich noch zwei Parteien zunächst nur hier, da in der sowjetisch besetzten Zone und in Berlin die Möglichkeit bestand –, die Christlich Demokratische Union und die Liberaldemokratische Partei. Zwei Wochen später, am 25. Juni, fand die erste Funktionärskonferenz der KPD im Kino Colosseum an der Schönhauser Allee statt, an der 1.300 Funktionäre teilnahmen und auf der mit Ulbricht die nächsten Aufgaben beraten wurden. Die Konferenz unterstützte unter anderem auch die Schaffung eines Berliner Jugendausschusses. Am 1. Juli schließlich kehrte der Parteivorsitzende, Wilhelm Pieck, inzwischen fast 70, aus dem Exil nach Berlin zurück. Am 19. Juli – die Potsdamer Konferenz absolvierte das Vorspiel ihres Programms – fand die erste öffentliche KPD-Versammlung in der Berliner Hasenheide statt, die außerordentlich starken Zuspruch fand. Und Ende Juli gestattete die SMAD auf einen entsprechenden Antrag, in allen Ländern der sowjetisch besetzten Zone Jugendausschüsse zu gründen – unsere Vorarbeit in Berlin war also erfolgreich und fand Nachahmung. Mit dieser Erlaubnis war auch die Aussicht eröffnet, in einer verhältnismäßig kurzen Zeit eine einheitliche deutsche Jugendorganisation zu bilden. Dazu hatte es bereits eine Personalentscheidung gegeben. Ende Juni bat mich Walter Ulbricht zu sich und stellte mir einen Mann vor, dessen Namen ich zwar schon gehört, aber den ich noch nie gesehen hatte. Er hieß Erich Honecker, war acht Jahre älter als ich, kam aus dem Saarland und hatte bei den Nazis zehn Jahre im Zuchthaus gesessen. Er solle, so Ulbricht, die Leitung eines Zentralen Jugendausschusses für die gesamte sowjetisch besetzte Zone übernehmen, während ich mich vorrangig auf die Jugendarbeit in der bald von vier Besatzungsmächten kontrollierten Großstadt Berlin konzentrieren sollte. In dieser Arbeitsteilung wurden wir bald Freunde. Das Wichtigste scheint mir im Rückblick zu sein, dass wir damals den jungen, orientierungslos gewordenen Menschen das Gefühl vermittelten, gebraucht zu werden. Du bist der letzte lebende Unterzeichner der Gründungsurkunde der FDJ. Kannst du die letzten Schritte schildern? Am 2. und 3. Dezember trafen sich in der Pankower Schule »Anna Magdalena Bach«, der nachmaligen Oberschule »Carl von Ossietzky«, Vertreter der Jugendausschüsse ganz Berlins und aus der gesamten sowjetischen Zone zu einer Arbeitstagung. Das Hauptergebnis war neben der Bestätigung, dass überall in der Ostzone, in allen Städten und Gemeinden nunmehr arbeitsfähige und wirksame Jugendausschüsse existierten– ein einmütig angenommener Aufruf mit der Überschrift »Das Leben ruft die Jugend!« In dem Aufruf war zum ersten Mal die Forderung ausgedrückt, eine einheitliche Jugendorganisation zu schaffen. Nach diesem Aufruf fanden von Dezember 1945 bis Februar 1946 in allen fünf ostdeutschen Ländern und auch in vielen Orten der westlichen Zonen Deutschlands Delegiertenversammlungen statt, die sich für diesen einheitlichen Jugendverband aussprachen. Schon in ihren Gründungsaufrufen war zu erkennen ohne dass es wörtlich so formuliert worden war –, dass sowohl die Kommunistische wie die Sozialdemokratische Partei gegen eine erneute Spaltung der Jugend in viele miteinander konkurrierende Verbände oder Vereine waren. Das entsprach Ulbrichts Intentionen, die er uns oft genug hatte wissen lassen. Das bedeutete allerdings nicht, dass alle Genossen diese Auffassung teilten, zu stark waren die eigenen Erinnerungen an den Kommunistischen Jugendverband oder an die Falken. Besonders in Berlin wurde darüber lebhaft diskutiert, es wurde sogar eine besondere Aktivtagung der KPD zur Erörterung der Vorzüge und Nachteile beider Möglichkeiten notwendig. Positiv: Bekanntlich war vor 1933 der KJVD in Berlin besonders stark gewesen, das hatte sich auch im Widerstand gegen die Nazis gezeigt. Negativ: Man spürte vornehmlich in den Westsektoren die Aversion der Westalliierten gegen große politische Organisation. Auch bei den anderen Parteien und den Religionsgemeinschaften existierte, zunächst vage formuliert, aber doch erkennbar, der Wunsch, eigene weltanschaulich oder religiös gebundene Verbände zu schaffen. Doch die Erkenntnis wurde immer stärker, vor allem bei den jungen Leuten selber, dass nach der Vergangenheit und angesichts der Probleme das Trennende, das Gegensätzliche weniger wichtig war als die gemeinsamen Nöte, das gemeinsame Interesse und die verbindenden Erwartungen, die gleichen Hoffnungen. Der letzte entscheidende Anstoß erfolgte am 26. Februar 1946. Im Sitzungssaal des Berliner Magistrats in der Parochialstraße traf sich der Zentrale Jugendausschuss der Sowjetischen Zone mit Freunden aus Berlin. Wir beschlossen, einen offiziellen Antrag an die SMAD zu richten, dass sie eine einheitliche Jugendorganisation zuließe, und diskutierten das Gründungsdokument. Es wurde dann unterschrieben von Erich Honecker, Edith Baumann, Theo Wiechert, Rudi Mießner, Paul Verner, Gerhard Rolack, Heinz Külkens, Domvikar Lange und Pfarrer Hanisch. Auch ich setzte meine Unterschrift unter das Dokument. Das war die eigentliche Gründung der Freien Deutschen Jugend in der sowjetisch besetzten Zone, die dann am 7. März von der SMAD zugelassen wurde. Ich bin der Einzige aus diesem Kreis, der übrig geblieben ist. Du hast 1950 das Blauhemd gegen die Uniform getauscht. Nicht ganz freiwillig, wie man sagt. Das stimmt. Ich war keineswegs pazifistisch geprägt, trug auch als Frontbeauftragter des NKFD eine Waffe und habe an der Front geschossen. Aber erstens hielt ich bewaffnete Streitkräfte in Deutschland – wenige Jahre nach dem Kriege – für anmaßend und überflüssig, nicht zu reden von den Kosten, schließlich mussten die Trümmer des letzten Krieges erst noch beseitigt werden. Die Sowjetunion würde den Kalten Kriegern auf der Gegenseite schon ausreichend Paroli bieten, meinte ich. Zweitens aber sah ich meine Zukunft in der Politik: Ich wollte weiterhin mit jungen Arbeitern, Schülern und Studenten arbeiten. Walter Ulbricht redete mit mir, sprach von der Notwendigkeit, politische Errungenschaften auch militärisch schützen zu müssen. Heinz Hoffmann kam und agitierte mich, Erich Honecker nicht weniger. Selbst Oberst Sergej Tulpanow redete mit mir in dieser Sache noch kurz vor seiner Versetzung an die Leningrader Marineakademie. Sie bissen alle auf Granit bei mir. Erst Wilhelm Pieck gelang es, mich umzustimmen. Am 1. November 1950 trat ich in die Bewaffneten Organe ein und war zwei Jahre lang Generalinspekteur und Leiter der Volkspolizei-Luft (VP-Luft), die anfänglich Verwaltung der Aeroklubs hieß. Allerdings räume ich ein, dass Präsident Pieck wirklich nur den letzten Anstoß gab. Ich war Ende 1949 einige Wochen lang in der Bundesrepublik unterwegs und versuchte mit westdeutschen Jugendorganisationen den Falken, den Jungsozialisten, katholischen und protestantischen Jugendverbänden – zu reden. Der Kalte Krieg eskalierte, die Konfrontation nahm zu, unsere Land war vom Westen durch die Bildung der Bundesrepublik gespalten worden – die DDR betrachtete sich als Povisorium, als Interregnum, wir kämpften unverändert für die Einheit Deutschlands. Die intensiven Gesprächen zur Herstellung einer Aktionsgemeinschaft zwischen jungen Leuten in West und Ost liefen ins Leere, wir fanden keinen gemeinsamen Nenner. Mir wurde klar, dass wir dort keine Verbündeten finden würden, also galt das unmarxistische Prinzip: »Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott.« Und das zweite Moment, weshalb ich dem Vorschlag Piecks und der anderen, die mich zu überzeugen versucht hatten, folgte, war der Krieg in Korea, der mir zeigte, wie gefährlich die Lage inzwischen war. Heinz, du kennst von uns allen Walter am besten. Traust du ihm zu, dass er eine internationale Pressekonferenz nutzt, um der eigenen Bevölkerung und der Welt die Unwahrheit zu sagen, wie das inzwischen von den meisten Medien suggeriert wird? Ausgeschlossen. Er war ein strategischer Denker. Kein Schwätzer. Ich kenne die Situation von damals, also 1961, genau. Meine militärischen Funktionen und meine Mitgliedschaft im Nationalen Verteidigungsrat sorgten dafür, dass Grundsätzliches an mir nicht vorbeiging. In der politischen und militärischen Führung der DDR wurde zu jenem Zeitpunkt an keine Mauer gedacht. Auf die Frage der Journalistin von der Frankfurter Rundschau, ob denn die Bildung einer »Freien Stadt« Westberlin bedeutete, dass die Staatsgrenze der DDR am Brandenburger Tor verlaufe, hatte Ulbricht geantwortet: »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich habe vorhin schon gesagt: Wir sind für vertragliche Beziehungen zwischen Westberlin und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist der einfachste und normalste Weg zur Regelung dieser Fragen.« Das ist etwas anderes, als heute von den Medien verbreitet wird. Ulbrichts Devise lautete, und die war auch hier artikuliert: Wir wollen verhandeln! Dass der Westen darauf nicht eingegangen ist, kann nicht der DDR angelastet werden. Man kann diese Frage auch nicht von der Weltpolitik trennen. Bekanntlich trafen sich am 3. und 4. Juni 1961 erstmals der sowjetische Ministerpräsident und der US-Präsident. Chruschtschow und Kennedy wollten in Wien über die Einstellung der Kernwaffenversuche, den Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland und die Regelung der Berlin-Frage verhandeln. Es kam anders. Sie drohten sich gegenseitig mit Krieg. Die Gespräche wurden ergebnislos abgebrochen. Der Frieden stand auf des Messers Schneide. Und die DDR befand sich inmitten dieser Konfliktlage. Chruschtschow hatte hoch gepokert. Er hatte erklärt, die UdSSR wolle bis Dezember 1961, also innerhalb von sechs Monaten, mit der DDR einen Friedensvertrag abschließen. Den Organen der DDR sollte die volle Kontrolle über die Zugangswege nach Westberlin zu Lande, zu Wasser und in der Luft übertragen werden. Elf Tage danach sprach Walter Ulbricht auf eben jener Pressekonferenz. Er ging davon aus, dass durch den Friedensvertrag mit der DDR, den Chruschtschow bis Jahresende zu schließen angekündigt hatte, die DDR eben jene Kontrolle über die Verbindungswege zwischen Westberlin und der Bundesrepublik übernehmen würde. Warum sollte unter diesen Voraussetzungen die DDR überhaupt eine Mauer errichten? Erst am 23. Juli, also mehr als fünf Wochen nach der Pressekonferenz, erhielt der Oberkommandierende der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland den Befehl aus Moskau, Karten der DDR mit dem Grenzverlauf zwischen der DDR und der BRD sowie Stadtpläne Berlins mit der Demarkationslinie zwischen Ost- und Westberlin vorzubereiten. Danach informierte der sowjetische Botschafter Perwuchin die DDR-Führung, dass Chruschtschow befohlen habe, unter strengster Geheimhaltung einen »Plan zur Einführung der Grenzordnung zwischen den beiden Teilen Berlins« auszuarbeiten. Ich habe am 3. August 1961 Minister Hoffmann nach Moskau begleitet, wo wir im Stab der Vereinten Streitkräfte alle Maßnahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Oberkommandierenden der GSSD und der Organe der DDR abgestimmt haben. Am 8. August hat Nikita Chruschtschow den Plan der Grenzsicherung zu Westberlin bestätigt. In einem Gespräch mit dem BRD Botschafter in Moskau, Hans Kroll, hat Chruschtschow am 9. November 1961 dies bestätigt, indem er bekannte: Ich habe die Grenzschließung angewiesen. Ohne uns hätte die DDR die Grenze nicht schließen können.Warum sollen wir uns hinter dem Rücken von Ulbricht verstecken? Sein Rücken ist in diesem Fall sowieso nicht so breit. Dass heute Politiker und Medien diesen Sachverhalt verschweigen und die Unwahrheit über den 13. August 1961 und seine Hintergründe und Zusammenhänge verbreiten, zeigt doch nur, dass der Westen seine eigenen Sünden vertuschen will.
Hans Reichelt: Die DDR, nicht Adenauer hat die Kriegsgefangenen heimgeholt
Hans Reichelt, Jahrgang 1925, nach sowjetischer Kriegsgefangenschaft und Besuch der Antifa-Schule Rückkehr nach Deutschland 1949, Eintritt in die Demokratische Bauernpartei, Volkskammerabgeordneter von 1950 bis 1990, Minister für Land- und Forstwirtschaft (1953), Studium an der Hochschule für Ökonomie Berlin Karlshorst und 1971 dort Promotion. Von 1955 bis 1963 neuerlich Minister, von 1963 bis 1972 Stellvertretender Vorsitzender des Landwirtschaftsrates der DDR. Vorsitzender des Staatlichen Komitees für Meliorationen von 1966 bis 1972, danach, bis 1989, Minister Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft und Stellvertretender Vorsitzender des Ministerrates, von 1982 bis 1989 auch Stellvertretender Vorsitzender der DBD. Von 1989 bis 1990 Minister für Naturschutz, Umweltschutz und Wasserwirtschaft. Von 1994 bis 2003 Vorsitzender der Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Unterstützung. Du bist am 9. Mai 1945 auf tschechischem Territorium in sowjetische Kriegsgefangenschaft gekommen. Da war Ulbricht bereits wieder in Deutschland. Das heißt, du hast ihn folglich auch nicht mehr an der Antifa-Schule erlebt. Ende 1949 wurdest du entlassen. Du kennst diese im Westen verbreitete Behauptung, dass die Entlassung deutscher Kriegsgefangener – insbesondere jener aus dem Jahr 1955 – auf Intervention Adenauers zurückgingen. Du hast öffentlich wiederholt dieser These wiedersprochen.[43] Warum? Weil sie nicht stimmt. Als die letzten Kriegsgefangenen nach Adenauers Besuch 1955 entlassen wurden – und dabei handelte es sich zumeist um verurteilte Kriegsverbrecher, nicht um harmlose Wehrmachtangehörige –, wurde diese Legende in die Welt gesetzt, dass Adenauer sie »befreit« habe. Tatsache ist, dass bis 1949 über zwei Millionen Mann von der Sowjetunion entlassen wurden. Das waren etwa zwei Drittel aller deutschen Kriegsgefangenen. Natürlich geschah das nicht aufgrund von Interventionen, von welcher Seite auch immer. Bei allem Respekt: Die Sowjetunion war Siegermacht. Sie ließ sich von keinem Deutschen etwas vorschreiben, nahelegen oder raten. Das entsprach den Vereinbarungen der Alliierten von Potsdam. Zugleich muss man jedoch sehen, dass die Parteiführung beginnend mit dem Aufruf vom 11. Juni 1945, wo es auch eine Passage zu den Kriegsgefangenen gibt – dieses Problem permanent behandelte. Kaum eine Vorstandssitzung, auf der dieses Thema nicht zur Sprache kam. Und die KPD bzw. die SED-Führung unternahm wiederholt Vorstöße. Am 4. Mai 1946 beispielsweise hatte Walter Ulbricht an die Sowjetische Militäradministration geschrieben: »Die Angehörigen der Kriegsgefangenen beklagen sich sehr bitter darüber, dass ihre Männer und Söhne seit längerer Zeit kein Lebenszeichen mehr gegeben haben, obwohl seinerzeit angekündigt worden ist, jeder Kriegsgefangene werde in die Lage versetzt werden, eine Nachricht nach Hause gelangen zu lassen. Mit Rücksicht darauf, dass von interessierter Seite das Kapitel Kriegsgefangene sehr stark politisch ausgewertet wird, sollte geprüft werden, wie die technischen Voraussetzungen für eine Benachrichtigung an die Angehörigen der Kriegsgefangenen geschaffen werden können«, schrieb Ulbricht. »Es würde sehr zur politischen Beruhigung der deutschen Bevölkerung beitragen, wenn die Ungewissheit über das Schicksal der Kriegsgefangenen durch eine solche Benachrichtigung beseitigt würde. Bei den Kriegsgefangenen, die in der Gefangenschaft verstorben sind, wäre eine solche offizielle Mitteilung an die Angehörigen aus verschiedenen Gründen besonders erwünscht.«[44] Am 4. Dezember 1946, anderthalb Jahre nach Kriegsende, übergab die SED-Führung eine erste Liste mit Namen von Kriegsgefangenen, auch wenn es im Mai aus Karlshorst noch geheißen hatte, »dass es bei der SMA keine Stelle gibt, die eine bevorzugte Entlassung aus russischer Kriegsgefangenschaft bearbeitet. Anträge und Anfragen sind daher zwecklos.«[44] Trotzdem wurde schubweise entlassen, täglich trafen mitunter bis zu 6.000 ehemalige Kriegsgefangene in Frankfurt/Oder ein. Das stellte ein unerhörtes logistisches Problem dar: Die Männer mussten versorgt, verteilt und untergebracht werden. Am 31. Dezember 1948 erklärte der sowjetische Außenminister Molotow, dass sich im sowjetischen Gewahrsam noch 890.532 deutsche Kriegsgefangene befänden. Diese würden in der Folgezeit entlassen werden. Unter jenen war auch ich. Ende des Jahres 1949 kam ich nach Hause. Am ersten Tag des neuen Jahres nahm ich meine politische Arbeit im Parteivorstand der Demokratischen Bauernpartei Deutschlands in Berlin auf. Kurz und gut, die Führung der SED hat nach meiner Kenntnis wie keine andere Partei oder Institution in Deutschland derart ausdauernd und nachhaltig sich für die Kriegsgefangenen in der Sowjetunion eingesetzt. Und dabei spielte Walter Ulbricht eine maßgebliche Rolle, die bedauerlicherweise öffentlich nie wahrgenommen wurde. Daran sind wir zum Teil selber Schuld: Über dieses Thema haben wir später nie groß gesprochen. Wessen sollten wir uns auch rühmen? Dass Millionen Deutsche 1941 in die Sowjetunion einfielen, sich wie die Barbaren aufführten, das Land plünderten, und dann – nachdem eine internationale Antihitlerkoalition Nazideutschland niedergerungen hatte für diesen Völkermord in Haftung genommen wurden, nach etlichen Jahren wieder nach Hause geschickt worden waren? Wenn man über deren Entlassung, um die man sich aus verschiedenen – auch aus humanitären Gründen bemüht hatte, öffentliches Gewese gemacht hätte, hätte man auch fortgesetzt über deutsche Kriegsschuld und Kriegsverbrechen reden müssen. Man tat gut daran, im Interesse des inneren Friedens nicht fortgesetzt Salz in die offenen Wunden zu reiben. Für den Wiederaufbau brauchte man jede Hand. Wann hast du zum ersten Mal Ulbricht persönlich getroffen? Das war 1952 auf dem II. Parteitag der Bauernpartei. Gesehen hatte ich ihn aber schon beim 75. Geburtstag von Wilhelm Pieck, aber nicht mit ihm gesprochen. Ein erstes fachliches Gespräch erfolgte im Mai 1953, als klar war, dass ich Minister für Land- und Forstwirtschaft werden sollte. Da fand im Hause der Bezirksleitung der Berliner SED in der Französischen Straße eine Beratung statt, zu der man mich eingeladen hatte. Dort sprach mich Ulbricht an und sagte, ich solle aufmerksam zuhören, damit ich wisse, was alles auf mich zukäme. Dann wurde es Juni. Wie hast du den 17. erlebt? Am Nachmittag des 17. Juni rief Walter Ulbricht alle Vorsitzenden der Parteien und Massenorganisationen zu einem Treffen nach Schöneweide. Ich fuhr in die Schnellerstraße, um die DBD zu vertreten. In der Innenstadt rollten sowjetische Panzer. Der CDU Vorsitzende fehlte. Wie wir später hörten, war der 70-jährige Otto Nuschke auf dem Weg zu unserer Beratung von Westberlinern gekidnappt worden. Ich fuhr etwa 150 Meter hinter seinem Wagen und sah, wie dieser über die Oberbaumbrücke gedrängt wurde. Ulbricht war ruhig. Man habe die Lage im Griff, sagte er, der »konterrevolutionäre Putsch« sei abgewehrt. Die Parteien sollten sich an die Argumentation des ZK der SED halten. Diese trug er dann vor. Am Schluss sagte er, dass er Kritiken und Vorschläge aus den Parteien und Organisationen erwarte. Jeder sagte etwas. Das war nicht unbedingt tiefgründig, wir wussten augenblicklich zu wenig. Waren das wirklich Faschisten, die in Berlin-Mitte randalierten? Gewiss warf das Dritte Reich noch seine Schatten, in der Stadt standen die Ruinen. Natürlich gab es auch noch Trümmer der Nazi-Ideologie in den Köpfen. – Meine Partei, die DBD, forderte die Überprüfungen der Pflichtablieferungsmengen, die rechtzeitige Herausgabe der Anbaubescheide und – dies nicht zum ersten Male – ein Einheitssteuergesetz. Die Bauern verlangten Steuergerechtigkeit und wollten nach Ertrag und Bonität besteuert werden. Dem wurde entsprochen. Vor allem aber: Die Strafverfolgung bei Nichterfüllung der Ablieferungspflichten wurde eingestellt. Auch die einschränkenden Kreditlinien für Großbauern waren Geschichte, die Bauernbank durfte jedem bei Bedarf kurzfristig Darlehen ausreichen. Du hast der Delegation angehört, die nach dem 17. Juni in Moskau Gespräche mit der sowjetischen Führung führte, um die innenpolitische Krise der DDR zu überwinden. Wie wurdest du Mitglied der Delegation? Anfang August rief mich Walter Ulbricht an. »Sie fahren mit nach Moskau.« Er tat so, als wisse ich, dass am 20. August 1953 eine von Ministerpräsident Otto Grotewohl geführte Abordnung im Kreml erwartet würde. Ich hatte aber keine Ahnung. »Wer fährt noch mit?«, fragte ich. Ulbricht zählte alle mitreisenden Minister und die stellvertretenden Ministerpräsidenten auf – Otto Nuschke für die CDU, Lothar Bolz für die NDPD, Hans Loch für die LDPD und sich selbst für die SED. »Und Sie«, sagte er, »fahren für die DBD.« »Der Parteivorsitzende ist Ernst Goldenbaum«, warf ich ein. »Gut«, reagierte er kurz. »Dann fahren Sie eben als Minister für Land- und Forstwirtschaft. Das ist sowieso besser. Da können wir Sie in Moskau gleich als den jüngsten Minister im ganzen Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe vorstellen …« Die Sowjets holten uns mit zwei Maschinen in Schönefeld morgens vor 6 Uhr ab, die DDR durfte noch keine Flugzeuge haben. Das war den Deutschen 1945 von den Siegermächten untersagt worden. In der ersten Maschine flogen Grotewohl, seine vier Stellvertreter, darunter Walter Ulbricht, Protokollchef Ferdinand Thun und der Sekretär der Regierungsdelegation Ludwig Eisermann. In der zweiten, die jedoch als erste startete, flogen wir anderen. Volkskammerpräsident Dieckmann verabschiedete uns auf der Rollbahn. Es war mein überhaupt erster Flug. Ich war entsprechend aufgeregt. Wir kletterten über eine Art Trittleiter in das Flugzeug. Obgleich wir bei herrlichem Sommerwetter gestartet waren, verdüsterte sich zunehmend der Himmel. Moskau lag in einer Schlechtwetterzone. Wir mussten einen Umweg von etwa 200 Kilometern machen und landeten gegen 13 Uhr auf einem anderen als dem uns genannten Flugplatz. Trotzdem stand dort die Ehrenkompanie, die Grotewohl gemeinsam mit den zur Begrüßung erschienenen Politbüromitgliedern Molotow[Anmerkung 32] und Mikojan[Anmerkung 33] abschritten, nachdem die beiden Nationalhymnen verklungen waren. Nicht nur ich war beeindruckt. Es war die überhaupt erste Reise einer DDR-Regierungsdelegation dieser Größenordnung, die in Moskau empfangen wurde. Es gab bislang nur Staatsvisiten in Warschau und Prag. Selbst Grotewohl schien ziemlich aufgeregt, er hatte noch nicht einmal den Mantel geschlossen, als er die Front abschritt. Protokollchef Thun schüttelte sichtlich genervt den Kopf. Weiß du, ich kenne kaum Berichte über diese Reise, nur die Mitteilungen in den Geschichtsbüchern. Kannst du deine erste Dienstreise, die ja nun wirklich historisch ist, als Augenzeuge ausführlicher schildern? Ich habe zwar später ebenfalls solche Reisen gemacht, aber ich wüsste gern, ob das damals ebenso ablief. Außerdem war ja das Jahr 1953 dramatisch in jeder Hinsicht. Gern. Also zunächst brachte man uns mit schwarzen, schweren Limousinen in die Qartiere, die sieben Passagiere der ersten Maschine, darunter auch Ulbricht, fuhr man nach Saretschje, dem Gästehaus der Regierung vor den Toren der Stadt. Die Prawda, das Zentralorgan der KPdSU, nannte, ohne dass unsere Ankunft mitgeteilt worden war, anderentags in ihrem Leitartikel auf der ersten Seite die sowjetischen Prämissen. Erstens sei Moskau gegen die Westintegration der Bundesrepublik, die beabsichtigte Einbindung mache »die Wiedervereinigung Ost- und Westdeutschlands« unmöglich. Zweitens würden die Westmächte damit gegen die Beschlüsse von Potsdam verstoßen, in denen sie sich zur nationalen Einheit Deutschlands bekannt hatten. Und darum werde man, drittens, »der deutschen Bevölkerung« auch künftig »entsprechend der Übereinkunft zwischen den Regierungen der UdSSR und der Deutschen Demokratischen Republik«– »allseitige Hilfe« erweisen. Das war die argumentative Unterfütterung jener Note, die Moskau kurz zuvor an die Westmächte gerichtet hatte. Darin war die Einberufung einer Friedenskonferenz und der Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland sowie die Bildung einer Provisorischen Gesamtdeutschen Regierung und freie gesamtdeutsche Wahlen vorgeschlagen worden. Drittens schließlich stellte in dieser Note die Sowjetregierung eine Reduzierung der finanziellen und wirtschaftlichen Verpflichtungen, »die mit den Kriegsfolgen zusammenhängen«, in Aussicht, wenn denn … Ehe wir 21 Uhr von Malenkow[Anmerkung 34] im Kreml empfangen wurden, bekamen wir einen Spielfilm gezeigt. Ein Melodram in Schwarzweiß aus dem Jahre 1934, bei dem sich während eines Gewitters eine unglücklich verheiratete Frau in einen anderen Mann verliebte. Was wollten die Sowjets uns damit sagen? Anschließend fuhren wir zum Ministerrat. Wir standen eine Zeitlang in einem Vorzimmer, dann öffneten sich die Flügeltüren. Der sowjetische Ministerpräsident Malenkow schritt auf Grotewohl zu, es begann das große Händeschütteln. Fast das gesamte Politbüro, nahezu identisch mit der Regierung, marschierte auf – von Chruschtschow bis Bulganin, alle da. Nur Berija fehlte. Er sei am 26. Juni 1953 bei der Sitzung des Zentralkomitees unter Vorsitz von Nikita Chruschtschow verhaftet worden, wie man munkelte. Er sei, wie Chruschtschow später informierte, ein »Provokateur in der deutschen Frage« gewesen. Berija habe am 2. Juni bei einer Politbüro-Sitzung die deutsche Wiedervereinigung auf der Basis von Neutralität und Demokratie eingefordert, was ja durchaus der uns bekannten aktuellen sowjetischen Linie entsprach. Aber die anderen hätten dem Ersten Vizepremier und Innenminister vorgeworfen, er würde diese Position als Mittel zur eigenen Profilierung nutzen. Berija war ganz offenkundig im Machtkampf um das Erbe des im März verstorbenen Stalin unterlegen. Das aber hatte uns nicht zu interessieren, wir waren Gäste. Grotewohl stellte jeden einzelnen von uns namentlich vor. Chruschtschow, der mir nur bis zur Brust reichte, stahl Walter Ulbricht allerdings die Pointe, indem er selber bemerkte, ich sei wohl der jüngste Landwirtschaftsminister aller RGW-Staaten. Ja, sagte Ulbricht stolz, ich sei erst 28 Jahre alt. Chruschtschow besaß alle Eigenschaften, die man ihm nachsagte, positive wie negative. Nikita Sergejewitsch war offen, herzlich und direkt, mitunter gab er sich ein wenig einfach und, wenn ihm so war, auch ein wenig schlitzohrig. Man konnte es auch freundlicher sagen: Er war für Überraschungen gut. Wir nahmen an einer langen Tafel Platz, rechts die Russen, links wir. Malenkow saß an der Stirnseite. Erst sprach er, dann Grotewohl. Der bat darum, der DDR die Reparationen ab November 1954 zu erlassen und die SAG-Betriebe in DDR-Eigentum zu überführen. Marschall Bulganin[Anmerkung 35] äußerte sich zu den Besatzungskosten. Er sagte, dass die Versorgung der bei uns stationierten sowjetischen Truppen demnächst zu 75 Prozent aus der Sowjetunion erfolge, was bedeute, dass dadurch »beträchtliche Mengen an Lebensmitteln aller Art für die Versorgung der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik mehr zur Verfügung stehen«. Darüber hinaus erfahre die DDR-Wirtschaft eine weitere Unterstützung dadurch, »dass die Sowjettruppen 30 Millionen Zigaretten in der Deutschen Demokratischen Republik aufkaufen werden. Den Zigaretten herstellenden Betrieben sollte das ein Ansporn sein, die Zigarettenqualität weiter zu verbessern«.[45] Ich glaubte zunächst, der Dolmetscher habe sich verhört, doch nein, Bulganin sagte wirklich derart Banales, und die Russen am Tisch nickten zustimmend dazu. Nach ihm rief Malenkow Mikojan auf. Der für den Handel zuständige Vizepremier stellte der DDR einen Kredit von 485 Millionen Rubel in Aussicht, davon 135 Millionen in Devisen, und diese zu unserer freien Verfügung. Er kündigte ferner zusätzliche Warenlieferungen im Volumen von etwa 590 Millionen Rubel an, Lebensmittel und Rohstoffe. Man würde uns auch »Überplanbestände« abnehmen und dafür mit Rohstoffen zahlen, etwa Baumwolle gegen Schreibmaschinen und Musikinstrumente. Mir war bisher nicht bekannt, dass wir zu viele Schreibmaschinen und Musikinstrumente hätten, aber ich kannte mich da nicht so aus. Sodann kam Mikojan auf die Wismut zu sprechen. Sie sollte, bislang vollständig in sowjetischem Besitz, in eine sowjetisch-deutsche Aktiengesellschaft umgewandelt werden. Dann schlug Malenkow vor, den Wechselkurs zwischen Rubel und DDR Mark amtlich auf 1:1,8 festzulegen, was im Einzelnen der Finanzminister Swerew erläuterte. Danach erklärt Molotow die Absicht, die Mission der UdSSR in Berlin und die der DDR in Moskau in den Rang von Botschaften zu erheben. Der Hohe Kommissar Semjonow solle der erste sowjetische Botschafter in Deutschland nach dem Kriege werden. Semjonow, der mit am Tisch saß, zuckte nicht mit der Wimper. Nach und nach war jeder einmal an der Reihe. Nach jedem Sowjetfunktionär durfte einer von uns entgegnen. So ging es hin und her, und was man nicht klären konnte, müssten anderentags die technischen Kräfte lösen, hieß es dann. Am Ende sprach noch einmal Grotewohl. Er sagte, die Vorschläge der Sowjetunion gingen über die Wünsche der Regierung der DDR hinaus. Nuschke unterstrich, das Entgegenkommen sei von gesamtdeutscher Wirkung, und Ulbricht betrachtete die Opfer der Sowjetvölker als Verpflichtung, dass wir alles zur Mobilisierung unserer Reserven und zur Steigerung der Arbeitsproduktivität unternehmen müssten. Das empfand ich als ein konstruktives Angebot. Malenkow setzte zum Schlusswort an. Er stellte fest, dass die sowjetischen Vorschläge von der Regierung der DDR angenommen worden seien. Auf den 17. Juni ging er allenfalls indirekt ein, als er sagte, er setze auf die positive Wirkung dieser Maßnahmen für den Neuen Kurs. Das war auch schon alles. Ansonsten war er der Auffassung, dass die DDR »Bastion und Hoffnung des ganzen deutschen Volkes« sei, wir trügen »Verantwortung für ganz Deutschland«. Wörtlich sagte er, wie ich meinen handschriftlichen Notizen von damals weiter entnehme: »Die Regierung der UdSSR schätzt die Bemühungen der Regierung der DDR zur Herstellung der Einheit Deutschlands hoch ein.« Es war kurz vor Mitternacht, als sich die Runde auflöste. Am nächsten Morgen wurden wir zum Mausoleum am Roten Platz gefahren, 11 Uhr legten wir dort einen Kranz nieder. Und nachdem wir unserer Mission, die nunmehr Botschaft war, einen Besuch abgestattet hatten, begaben wir uns auf eine touristische Rundreise durch Moskau. Wir besichtigten die Lomonossow-Universität, Metrostationen am Arbat und einiges mehr. Ab 15.30 Uhr durften wir uns, wenn wir denn wollten, auf einen individuellen Einkaufsbummel begeben. 18 Uhr gab Molotow einen Empfang im Kreml. Nach reichlich zwei Stunden brachen wir dort auf. Vorm Haus warteten die Autos auf uns, 20.30 Uhr begann die Zirkusvorstellung mit Karandasch.[46] Er bot eine Szene, die mir einen Kloß in den Hals trieb: Karandasch schlenderte durch einen Park und stieß eine wertvolle Plastik vom Sockel, die aufgrund dieses Missgeschicks zu Bruch ging. Als der Parkwächter nahte, stellte er sich in seiner Verzweiflung selbst aufs Podest. Jede seiner Bewegungen wurde vom Publikum mit Gelächter und Gekreisch begleitet, aber irgendwann merkte der Wächter es doch. »Um Schönheit zu vernichten, braucht man nur einen Augenblick – um sie wieder herzustellen Jahrhunderte«, sagte Karandasch und verschwand. Das klang an diesem Ort und in deutschen Ohren ganz anders als für die Moskauer, die sich sichtlich amüsierten. Am nächsten, dem dritten Tag waren Fachgespräche in den Ministerien angesetzt. Mein sowjetischer Kollege berichtete mir von der Mechanisierung ihrer Landwirtschaft und der Organisation der Staatsgüter, von Massenauszeichnungen für Kolchosbauern und von Agronomen. Der größte Teil seiner Ausführungen betraf die Struktur seines Ministeriums und dessen Verhältnis zur Landwirtschaftsakademie, da schien er sich besser auszukennen. Ich schrieb eifrig mit, was ihm offensichtlich gefiel. Grotewohl und Ulbricht waren noch einmal bei Malenkow, um jene Fragen anzuschneiden, die in der großen Runde ausgespart worden waren. Nicht einmal ansatzweise war dort das Kriegsgefangenenproblem aufs Tapet gekommen. In meinen Notizen findet sich jedenfalls kein Hinweis. »Im engsten Kreise der Regierungsdelegation wird die Kriegsgefangenenfrage von Grotewohl angeschnitten. Das ist kein leichtes Problem«, erklärte später öffentlich Vizepremier Hans Loch, der über die Unterredung bei Malenkow von Ulbricht ins Bild gesetzt wurde. »Wir müssen den Standpunkt der UdSSR anerkennen, die die verurteilten Kriegsverbrecher die Strafe abbüßen lassen will.«[47] Hans Loch, der Parteivorsitzende der Liberalen, warb um Verständnis und verwies auf die Verbrechen, »die faschistische Banditen in den Weiten des sowjetischen Landes begangen haben«. Angesichts der sonstigen Zugeständnisse erschien es ihm »nicht unbedenklich, die Unbescheidenheit noch weiter zu treiben und an Grundsätzliches und Entscheidendes in der sowjetischen Anschauung zu rühren«. Gleichsam zur Entschuldigung für uns Deutsche, an dieser Stelle doch insistiert zu haben, fügte er an: »Das Kriegsgefangenenproblem war durch die hemmungslose amerikanische Hetze zu einer Hypothek geworden, die auf den gesamtdeutschen Beziehungen zur Sowjetunion lastete, und deshalb beschlossen wir einmütig, die Kriegsgefangenenfrage bei den Verhandlungen doch anzuschneiden.« Am Ende wurde das Thema doch mit ins Kommuniqué genommen. Die Formulierungen waren wie bei Verlautbarungen dieses Charakters üblich. »Aufgrund eines Ersuchens der Regierungsdelegation der DDR wurde folgende Vereinbarung getroffen: Es werden nach einem festgesetzten Modus Maßnahmen getroffen, um die deutschen Kriegsgefangenen von der weiteren Abbüßung der Strafen zu befreien, zu denen sie für während des Krieges begangene Verbrechen verurteilt wurden. Hiervon ausgenommen sind Personen, die besonders schwere Verbrechen gegen den Frieden und die Menschlichkeit begangen haben.« Aus dieser Mitteilung im Kommuniqué ist ersichtlich: Die DDR war in der Kriegsgefangenenfrage initiativ geworden, die sowjetische Seite hatte reagiert. Und in der Tat: Wenige Wochen später kamen die ersten nach Hause, das zog sich bis 1954/55 hin. Es gab für diese belasteten und begnadigten Heimkehrer keinen Empfang mit Pauken und Trompeten, wohl aber war auch ihre Aufnahme und Integration in der DDR vorbereitet wie in den Jahren zuvor. 17 Uhr lud die deutsche Delegation in unsere Botschaft, Malenkow und Chruschtschow kamen und etliche andere Politiker und Militärs, all jene, die wir um 22 Uhr im Kreml zur Unterzeichnung des Protokolls über den Erlass der Reparationszahlungen und zum anschließenden Bankett wiedertreffen sollten. Die Sitzordnung war vorgegeben. Ich nahm zwischen Budjonny[Anmerkung 36] Sokolowski[Anmerkung 37] und Platz. An den Uniformröcken der beiden Marschälle hingen Orden in beachtlicher Zahl. Budjonny war dreifacher Held der Sowjetunion, Sokolowski »nur« einfacher. Als kleiner Reserveleutnant konnte ich da nicht mithalten. Aber meine Vergangenheit interessierte die beiden nicht. Budjonny mit seinem kräftigen Schnauzer erwies sich als Original, seine große Popularität wurde mir zunehmend verständlicher. Er war ein Pferdenarr. Für Pferde in der DDR war der Landwirtschaftsminister zuständig. Aha, deshalb also saß ich auf diesem Stuhl, nicht wegen meiner Wehrmachtkarriere. Budjonny hatte sich, wie er mir berichtete, 1921 sogar gegen Lenin durchgesetzt, der alle Gestüte auflösen und Privatpferde nicht dulden wollte. Als Don-Kosak gründete er neue Gestüte, und wie Sokolowski süffisant bemerkte, übertrafen Budjonnys Verdienste als Pferdezüchter inzwischen die des Militärs. Der Wodka ließ die Stichelei milder erscheinen, als sie vielleicht gemeint war. Er wäre schon einmal in Bad Saarow, im Militärlazarett, gewesen, erzählte mir Budjonny weiter, nachdem er merkte, dass ich zum Thema Pferdezucht nicht viel beitragen konnte. Nun ja, sagte ich, da war ich noch im Kriegsgefangenenlager in der Sowjetunion, wir konnten uns darum nicht begegnen. Darauf sagte Sokolowski, manchmal wäre es doch ganz gut, wenn man nicht vor der Zeit aufeinanderträfe. »Na sdarowje!« Am nächsten Morgen, dem 23. August 1953, ging es zurück nach Berlin. Molotow verabschiedete uns auf dem Flugplatz. In Grotewohls Maschine flog der neue Botschafter Semjonow mit. Nach 16 Uhr Ortszeit landeten wir in Berlin, nach fast zehn Stunden Flug. Der Volkskammerpräsident begrüßte uns. Die ganze Regierung war angetreten. Wir waren glücklich und müde. Am nächsten Tag, hieß es, träfen wir uns im Amtssitz des Präsidenten in Schloss Niederschönhausen zur Berichterstattung. Der Termin war ursprünglich erst für den Dienstag vorgesehen, er war also um 24 Stunden vorgezogen worden. Wir saßen um 12 Uhr an dem großen runden Tisch. Der Präsident war bereits im Bilde. Seine Ausführungen aber gaben der Visite in Moskau und den getroffenen Vereinbarungen die staatsmännische Weihe. Ich war beeindruckt. Es stimmten die Proportionen, nicht zu viel und nicht zu wenig Pathos, sachlich trotz allem. Auf einfache, aber überzeugende Weise wertete er die Mission. »Die Völker der Sowjetunion haben am allerschwersten unter den grauenhaften Blutopfern und Verwüstungen gelitten, die der Hitlerkrieg von den europäischen Völkern gefordert hat. Erst wenn wir das bedenken, erfassen wir die ganze Größe der Uneigennützigkeit und Freundschaft, die die Sowjetregierung mit ihren Entscheidungen dem deutschen Volk entgegenbringt. Sie verzichtet auf alle Reparationen. Sie übergibt die Betriebe der sowjetischen Aktiengesellschaften unentgeltlich in das Eigentum der DDR. Sie senkt die Zahlungsverpflichtungen für den Aufenthalt sowjetischer Truppen in der DDR. Sehen wir ab von den normalen Handelsverpflichtungen, so wird die DDR von allen Staatsschulden, die im Gefolge des Krieges entstanden sind, völlig befreit sein«, sagte Wilhelm Pieck sichtlich erleichtert. »Schließlich ist sogar für die Kriegsgefangenen, die wegen begangener Verbrechen verurteilt sind, eine großzügige Regelung vorgesehen, von der nur besonders schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit ausgenommen sind. Darin liegt für uns eine Verpflichtung, den blutbesudelten Faschismus, der deutsche Soldaten zu Verbrechern gegen andere Völker machte, in Deutschland nie wieder hochkommen zu lassen. Das sind wir unserem eigenen Volke und den Völkern Europas schuldig.«[48] Bis 1955 wurden schließlich weitere 25.000 Mann entlassen. Und im Mai 1955 sprachen Chruschtschow und Bulganin – sie kamen aus Genf vom ersten Gipfeltreffen der Siegermächte nach der Potsdamer Konferenz – mit Pieck, Grotewohl und Ulbricht. Und dort stellte man die Frage, was denn nun mit dem verbliebenen Rest wäre. Daraufhin sagte Chruschtschow, als wäre es die einfachste Sache der Welt, dass sich die Experten der DDR und der Sowjetunion zusammensetzen sollten, um eine abschließende Regelung zu treffen. Danach sollte die DDR-Regierung einen Antrag an das Präsidium des Obersten Sowjet richten, dass dieses einen Gnadenerlass beschließen möge. Wie aber ist dann diese Adenauer-Reise überhaupt zustande gekommen? Es stellt sich so dar, als wenn die Initiative von Bonn ausgegangen sei. Das ist völlig falsch. Am 7. Juni 1955 schrieb Nikita Chruschtschow an das ZK der SED in Berlin. »In Anbetracht der neuen Situation, die sich in Europa im Zusammenhang mit dem Inkrafttreten der Pariser Verträge ergeben hat, hält das ZK der KPdSU für zweckmäßig, dass in der nächsten Zeit einige neue Schritte der Sowjetregierung in der deutschen Frage erfolgen, zu denen wir Ihre Meinung erfahren möchten.« Man halte den Zeitpunkt für gekommen, »Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zwischen der UdSSR und Westdeutschland zu unternehmen und dazu der Regierung der Bundesrepublik eine entsprechende Note der Sowjetregierung mit dem Vorschlag der Herstellung diplomatischer und Handelsbeziehungen zwischen beiden Ländern zu überreichen«.[49] Man plane, Adenauer nach Moskau einzuladen. Der Vorgang ist insofern bemerkenswert, als daraus ersichtlich ist, dass erstens die Initiative für die Adenauer-Reise von Moskau ausging und dass die Sowjetunion auf den NATO-Beitritt der Bundesrepublik nicht konfrontativ, sondern weiter verhandlungsbereit reagierte. Und zweitens, dass die SED-Führung über die Moskauer Offerte nicht nur unterrichtet war, sondern auch inhaltlich dazu konsultiert wurde. Die Folge dieses Meinungsaustausches war der Staatsvertrag zwischen der DDR und der UdSSR, welcher am 21. September 1955 – nach Adenauers Abreise – in Moskau geschlossen werden sollte. Er sicherte der DDR die staats- und völkerrechtliche Souveränität und regelte die Stationierung sowjetischer Truppen auf ihrem Territorium.[Anmerkung 38] Sowohl in der Einladung an den Bundeskanzler als auch im Schreiben an die DDR-Führung war das Wort »Kriegsgefangene« nicht enthalten. Wie sollte es auch? Die regulären Kriegsgefangenen waren längst daheim. Auf sowjetischem Territorium befanden sich nur noch verurteilte Kriegsverbrecher. Adenauer reagierte auf die Einladung aus Moskau positiv, verlangte aber die Freilassung von namentlich bekannten 9.626 Personen, die sich noch in sowjetischem Gewahrsam befinden sollten. Chruschtschow informierte auch darüber, und zwar am 14. Juli, die SED Spitze. Man gehe davon aus, dass Adenauer eben dieses Problem auch bei den Verhandlungen aufwerfen werde. »Deshalb möchten wir diese Frage mit Ihnen vor den Verhandlungen mit Adenauer erörtern.«[50] Die Erörterung sah so aus, dass Chruschtschow den Fahrplan vorgab. Aber selbst wenn die Diktion erkennen lässt, dass die Sache in Moskau offenbar schon längst beschlossen war und Berlin allenfalls pro forma um Meinung und Zustimmung gebeten wurde, ist damit bezeugt, dass Adenauers nachträglich dramatisierter Auftritt in Moskau noch eine Spur banaler ausfällt, als er selbst von seriösen Historikern bisweilen dargestellt wird. In Kenntnis der sowjetischen Position und der von Chruschtschow am 14. Juli 1955 der DDR-Führung mitgeteilten Absichten verbietet es sich von selbst, in diesem Kontext von einem besonderen »Verhandlungsgeschick« Adenauers zu sprechen. »In diesem Zusammenhang beabsichtigen wir, 1. während der bevorstehenden Verhandlungen mit dem Kanzler Adenauer über die Herstellung diplomatischer Beziehungen zwischen der UdSSR und der Deutschen Bundesrepublik zu erklären, dass die Frage der ehemaligen Kriegsgefangenen, die für ihre gegen das Sowjetvolk begangenen Verbrechen Strafen verbüßen, von den zuständigen sowjetischen Instanzen geprüft wird und eine günstige Entscheidung dieser Frage zu erwarten ist. 2. Nach einem erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen mit der Regierung der Deutschen Bundesrepublik beabsichtigen wir, 5.614 deutsche Bürger, darunter 3.708 Kriegsgefangene, 1.906 Zivilpersonen und 180 Generale der ehemaligen Hitlerarmee, von der weiteren Strafverbüßung zu befreien und sie entsprechend ihrem Wohnsitz nach der DDR oder nach Westdeutschland zu repatriieren. 3. Wir halten es für erforderlich, 3.917 Personen (2.728 Kriegsgefangene und 1.139 Zivilpersonen) in Anbetracht der Schwere der von ihnen auf dem Gebiet der UdSSR verübten Verbrechen entsprechend ihrem Wohnsitz den Behörden der DDR oder Westdeutschlands als Kriegsverbrecher zu übergeben. 4. Es ist vorgesehen, als abschließenden Akt einen Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR über die Freilassung und Repatriierung der deutschen Kriegsgefangenen und Zivilpersonen, die in der UdSSR Strafen verbüßen, zu veröffentlichen, worin festgestellt werden soll, dass die Freilassung entsprechend eines Ersuchens der Regierung der DDR und der Regierung der Deutschen Bundesrepublik erfolgt.«[50] Insbesondere der letzte Satz ist des Merkens wert. Im Übrigen differiert die hier genannte Gesamtzahl von 9.531 lediglich um 100 zu jener, die Bulganin am 10. September Adenauer nannte, was allenfalls als Indiz dafür gelten kann, dass selbst die sowjetische Führung keine präzisen Angaben besaß, wie viele Gefangene bei ihnen tatsächlich noch einsaßen. Aber an dem Umstand änderte es nichts, dass bereits alles entschieden war, noch bevor Konrad Adenauer seinen Fuß auf sowjetischen Boden setzte. Und zwar entschieden in Absprache mit der DDR-Führung! Adenauers Moskau-Reise hallte nach. Über die BRD-Botschaft in Paris wurde der dortigen Vertretung der UdSSR eine diplomatische Note zugestellt, in der noch einmal bekräftigt wurde, dass die Bundesregierung trotz der in Moskau geschlossenen Vereinbarungen weder den Status quo in Europa als endgültig noch den anderen deutschen Staat als legitimen Vertreter betrachte. Ja, man meinte, Freund wie Feind nach dieser Reise deutlich machen zu müssen, dass weder der Alleinvertretungsanspruch noch die Westintegration aufgegeben werden würde. Parteivorstand und Parteiausschuss der CDU bekräftigten am 17. September: »Durch die Moskauer Verhandlungen hat sich im Verhältnis der Bundesrepublik nicht das geringste geändert. Die Bundesrepublik ist ein treuer und zuverlässiger Partner des Westens.«[51] Das zielt aber nicht nur auf Adenauers Visite. Zur selben Stunde weilte nämlich eine Regierungsdelegation der DDR in Moskau und schloss mit der UdSSR jenen Staatsvertrag, mit dem die DDR auf der internationalen Bühne ein anderes Gewicht erhalten sollte. Walter Ulbricht erklärte danach am 26. September 1955 ziemlich selbstbewusst: »Die Lage in Deutschland hat sich so entwickelt, dass die Deutsche Demokratische Republik der rechtmäßige deutsche Staat ist, dessen Politik die Zukunft verkörpert.«[51]
Hannelore Graff-Hennecke: Er brachte uns Pralinen mit
Hannelore Graff-Hennecke, Jahrgang 1939, ist die Tochter des Bergarbeiters Adolf Hennecke (1905-1975), der in einer Schicht 1948 viermal so viel Kohle brach, wie die Norm es verlangte. Das war der Auftakt der Aktivisten-Bewegung, die seinen Namen trug. Neben dem Sportler »Täve« Schur und dem Kosmonauten Sigmund Jähn gehört Hennecke zu den Ikonen der DDR. Hannelore Graff-Hennecke arbeitete bis zum Rentenalter in Berlin als Lehrerin. Mein Vater lernte Walter Ulbricht im November 1948, wenige Wochen nach der Schicht kennen.[52] Es gab keinerlei Berührungsängste. Am 25. August 1949 erhielt er in Weimar der Nationalpreis 1. Klasse. Anlässlich dieser Auszeichnung fand am Abend ein festliches Essen statt. Bei der Gelegenheit sprachen beide über die Perspektive meines Vaters. »Zu meinen praktischen bergmännischen Erfahrungen benötige ich theoretische bergmännische Kenntnisse«, sagte der 44-Jährige zu Ulbricht. »Ich äußerte deshalb den Wunsch, die Bergakademie Freiberg zu besuchen, um dort die theoretischen Grundlagen für meine künftige Arbeit zu erwerben. Bereitwillig ging Walter Ulbricht darauf ein, und schon im Januar 1950 wurde ein Kursus für Aktivisten des Steinkohlebergbaus eingerichtet, wo ich gemeinsam mit 13 Kollegen die Möglichkeit zum Studium erhielt.«[53] Nach der Auszeichnung mit dem Nationalpreis erreichten meinen Vater nicht nur Glückwünsche und Einladungen, sondern auch unzählige Bitten um materielle Hilfe, da der Nationalpreis mit 100.000 Mark dotiert war. Mein Vater half, wo er konnte. Dabei sondierte er weitere Möglichkeiten, größere Beträge zu spenden, und wandte sich am 30. August 1949 mit einer Anfrage an Walter Ulbricht, den er zum 1. Jahrestag seiner Schicht zu einem Betriebsbesuch ins Karl-Liebknecht-Werk in Oelsnitz eingeladen hatte. Ulbricht antwortet wenig später: »Wegen der von dir vorgeschlagenen Verteilung Deines Nationalpreises haben wir Bedenken. Wir haben zwar nichts dagegen, wenn ein gewisser Teil für ein Jugendheim bzw. Kinderheim gegeben wird, sind aber der Meinung, dass jeder Preisträger den größten Teil der Prämie für seine persönlichen Bedürfnisse verwenden sollte, da sonst der Zweck verfehlt wäre.«[54] Meine Eltern nahmen manchmal an offiziellen Empfängen teilt. Wir Kinder freuten uns immer, wenn sie uns ein kleines süßes »Andenken« mitbrachten. Einmal stand am Morgen nach einem solchen Staatsakt auf dem Frühstückstisch ein großer Kasten Konfekt. Wir jubelten. Süßigkeiten oder gar Schokolade waren eine Rarität. Vater sagte uns, dass ihm die Pralinenschachtel Walter Ulbricht geschenkt habe. »Adolf, du hast Kinder zu Hause, nimm du sie.« Von da an war für uns Kinder Walter Ulbricht der Größte. Das politische Denken und Handeln meines Vaters war bestimmt von der tiefen Überzeugung, dass die Partei, der er seit 1946 angehörte, immer die richtigen Entscheidungen treffen würde. Als 1971 Walter Ulbricht abgelöst wurde, war mein Vater tief erschüttert. Bereits auf der 14. Tagung des Zentralkomitees im Dezember 1970 war Ulbricht wegen Disproportionen in der Wirtschaft scharf kritisiert worden. Eine Mehrheit der Politbüromitglieder hatte bei KPdSU-Generalsekretär Breshnew in Moskau Ulbrichts Absetzung beantragt, auch mit der Begründung, dass er die Vorbereitung des VIII. Parteitages behindere. Auf der 16. Tagung wurde der Machtwechsel dann mit Zustimmung aus Moskau vollzogen und Erich Honecker zum Ersten Sekretär des Zentralkomitees gewählt. Als mein Vater nach der entscheidenden Sitzung nach Hause kam, war er unruhig und hatte das Bedürfnis, darüber mit der Familie zu sprechen. Mit Erich Honecker hatte er keine Probleme. Aber wie Ulbricht, den er als Staatsmann achtete und der ihm oft ein aufmerksamer Gesprächspartner war, beiseite geschoben wurde, empörte ihn. So geht man nicht mit Menschen um, die sich hohe Verdienste erworben haben, sagte er. Über Hintergründe und Interna war auf der Tagung nicht informiert worden. Wir wollten von unserem Vater wissen, ob denn niemand nachgefragt habe und ob die Sache nicht diskutiert worden sei. »Als Mitglieder des Zentralkomitees müsst ihr doch entscheiden, könnt ihr doch etwas bewegen«, meinten wir. »Ihr habt ja keine Ahnung, wie so etwas abläuft«, sagte er aufgewühlt resigniert und in seltener Offenheit. Wir konnten uns damals wirklich nicht vorstellen, dass wichtige Entscheidungen von Einzelnen oder in Moskau getroffen wurden und dass manche Abstimmung nur Formsache war.
Klaus Herde: Kinder- und Jugendsportschulen in der DDR waren Ulbrichts Idee
Klaus Herde, Jahrgang 1925, geboren und aufgewachsen in Breslau, sein Onkel Karl Mache war bis 1933 SPD Reichstagsabgeordneter und Bürgermeister von Breslau. Lehre als Funkmeldemechaniker, 1943 eingezogen zur Luftwaffe, am 20. Juli 1944 bei Erfurt abgeschossen. Lazarettaufenthalt bis Juli 1945. August 1945 Eintritt in die KPD, Neulehrer in Gera, gründete dort die erste Gruppe der Kinderlandbewegung der FDJ. Dann Thüringer Landesleitung der FDJ, 1947 Mitglied des Zentralrats der FDJ. Ab 1951 Ministerium für Volksbildung, Leiter der Hauptabteilung Außerschulische Erziehung. Von 1956 bis 1964 Mitglied der Zentralleitung der damals selbständigen Pionierorganisation »Ernst Thälmann«. Nach deren Reintegration in die FDJ Wechsel zum Fernsehen. Dort bis 1984 Stellvertreter des Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für Fernsehen der DDR, verantwortlich für das Bildungs-, Jugend- Sport- und Kinderfernsehen. Danach Wissenschaftlicher Mitarbeiter. Promotion an der Akademie der Pädagogischen Wissenschaften, »Verdienter Meister des Sports« für seine Leistungen zur Entwicklung des Kinder- und Jugendsports. Klaus, du warst einer der Aktivisten der Kinderlandbewegung der FDJ, die schon 1947 entstanden war, gehörtest zu den FDJ-Funktionären, die am 13. Dezember 1948 den Verband der Jungen Pioniere gründeten und warst Teil der Leitung des Verbandes, noch bevor Margot Feist 1949 Vorsitzende des Pionierverbandes wurde. In den Geschichtsbüchern steht, dass Fridl Hensel-Lewin die erste Pioniervorsitzende vor Margot Feist war. Und so lassen wir es auch stehen. Margot kam erst im Dezember 1949, zum 1. Geburtstag der Organisation, nach Berlin, und übernahm die Leitung. Ich wurde ihr 1. Stellvertreter. Vor mir gab es Karl Morgenstern, den aber schon nach kurzer Zeit Heinz Keßler »wegholte« – Kader waren damals knapp. Vieles lief noch nicht in geordneten Bahnen und Strukturen. Im Dezember 1949 reiste eine Delegation zum 70. Geburtstag Stalins nach Moskau. Der sollten auch zwei von der FDJ angehören. Das waren der FDJ Vorsitzende Erich Honecker und die Pioniervorsitzende Margot Feist, später Honecker. Und da ist es passiert … Walter Ulbricht hielt seine Hand über beide. Gut, wir wollen nicht so sehr über die damaligen Kaderprobleme reden. Du bist, soviel ich weiß, von Hermann Axen, der im FDJ-Zentralrat für Kader zuständig war, 1947 von Weimar nach Berlin geholt worden, um die Kindervereinigung der FDJ mit aufzubauen. War das von ihm oder von dir als Lebensperspektive gedacht? Zu jener Zeit plante man nicht über große Zeiträume. Außerdem habe ich Hermann gesagt, dass ich wieder in die Volksbildung zurückgehe, sobald die Kindervereinigung steht. 1951 wurde ich im Ministerium Leiter der Hauptabteilung Außerschulische Erziehung. Paul Wandel war damals Volksbildungsminister, Else Zaisser Staatssekretär. Ich war faktisch der dritte Mann. In jener Zeit kam ich mit Walter Ulbricht häufiger zusammen. Als Erster Vizepremier war er u. a. zuständig für das Amt für Jugendfragen und Leibesübungen, das von Hannes Keusch geleitet wurde. Der war vorher Sekretär des FDJ-Zentralrats und später Botschafter der DDR in Bulgarien. Wann hast du Ulbricht zum ersten Mal gesehen? Auf dem I. Parlament der FDJ 1946 in Brandenburg. Aber bei allem Respekt: Pieck und Grotewohl waren damals erheblich bekannter und populärer. Ich kann noch nicht einmal sagen, ob Ulbricht dort gesprochen hat. Eine meiner späteren Begegnungen mit Walter Ulbricht war kurios. Das war auch noch vor der Gründung der DDR. In Oberhof fanden die Ostzonenmeisterschaften im Wintersport statt. Wir, d. h. Walter Ulbricht und seine Lebensgefährtin Lotte Kühn, meine Frau und ich und der sowjetische Jugendoffizier von der SMA Thüringen, wollten in das dortige Golfhotel gehen. Doch ein arroganter Schnösel wollte uns nicht reinlassen. Wir gehörten offenkundig nicht zu den betuchten Gästen, die dort immer noch aus ganz Deutschland abstiegen. Der sowjetische Hauptmann Komin schob den Kontrolleur mit dem Mandat der Besatzungsmacht beiseite. Walter sagte den für mich denkwürdigen Satz: »Wir werden unseren Pionieren keinen Frack anziehen, aber denen den Frack ausziehen.« Aus dem Golfhotel wurde später das Pionierhaus »Bruno Kühn«. Bruno Kühn war der Bruder von Walters späterer Ehefrau. Er war in der proletarischen Kinderbewegung Pionierleiter und wurde im Kampf gegen die Nazis ermordet. Solche Namen wurden nach 1990 natürlich getilgt. Wieso wolltest du unbedingt Lehrer werden? Ich hatte vier Geschwister. Zwei starben früh. Ich war der Älteste und für sie verantwortlich. Vater war Kraftfahrer und selten zu Hause. Unsere Mutter arbeitete als Verkäuferin. Da entwickelten sich bei mir gewisse pädagogische Einstellungen und Prägungen. Nach dem berühmten »Friedensflug nach Osten« einer FDJ-Delegation unter Leitung Erich Honeckers 1947 gab es auch eine Reise von Pionierleitern in die Sowjetunion. Ja, das war im Juli 1949. Wir sahen dort ein Pionierlager, das von der Moskauer Metro unterstützt wurde. Die Idee von Trägerbetrieben für Ferienlager fand ich so gut, dass ich sie nach meiner Rückkehr Erich Honecker erzählte, der mich daraufhin gleich zu Ulbricht schickte. Der hörte sich das an und holte den Wirtschaftssekretär Willi Stoph dazu. Gemeinsam erstellten wir eine Liste von 39 Großbetrieben in der sowjetischen Zone, die wir als Unterstützer für die Aktion »Frohe Ferientage für alle Kinder« gewinnen wollten. Und ich brachte auch die Vorstellung eines ständigen Pionierlagers mit, so etwas wie Artek auf der Krim. Ursprünglich wollten wir das in der Berliner Wuhlheide einrichten, aber Erich und Margot fanden den Werbellinsee für Kinder besser geeignet. Dort entstand dann Anfang der 50er Jahre bei Altenhof die Pionierrepublik »Wilhelm Pieck«, die 1952 vom Staatspräsidenten übergeben wurde. Im Nachgang muss ich sagen: Ohne unsere Naivität und den grenzenlosen Optimismus hätten wir so etwas wie die Pionierrepublik und die Zentralen Pionierlager nie begonnen. Man stelle sich doch vor – zehntausende Kinder vier Wochen zusammen in den Ferien, was konnte da nicht alles passieren? Es ist nichts passiert, gottlob. Wir haben nicht nur Glück gehabt, sondern vor allem Pionierleiter mit Liebe zu den Kindern und mit pädagogischem Geschick. In der Sowjetunion lernten wir auch Arbeitsgemeinschaften kennen. Auch das gefiel mir. So entstand die außerschulische Erziehung in der DDR. Als Erstes gründeten wir die Zentralstation der Jungen Naturforscher in Berlin-Blankenfelde. Walter Ulbricht eröffnete sie 1952. Er sprach dort im Palmenhaus. Die Anlage war vierzig Jahre zuvor als Hauptschulgarten angelegt worden. Nebenbei: 1994 wurde die 34 Hektar große Anlage mit den beiden zwölf Meter hohen Gewächshäusern zum Volkspark erklärt und unter Denkmalschutz gestellt. Dann vergammelte das Haus lange Zeit. Erst 2010 eröffnete es der Regierende Bürgermeister nach erfolgter Rekonstruktion mit großem Bohei wieder. Klaus Wowereit lobte überschwänglich den »wunderschönen Glanz« der Anlage, nannte sie »Refugium in der hektischen Großstadt«. Die große Arbeit, die viele Pioniergenerationen in vierzig DDR Jahren dort geleistet hatten, erwähnte er natürlich mit keiner Silbe. Wie hat sich Walter Ulbricht um die Kinder- und Jugendpolitik gekümmert? Ich will das nur aus meiner Erfahrung beschreiben: Aus jedem Gespräch zu diesem Thema mit ihm zog ich Nutzen. Zugegeben, ich ging nur zu ihm, wenn ich ein konkretes Anliegen hatte und eine Entscheidung brauchte, aber es wurde dann immer auch von ihm entschieden oder dorthin delegiert, wo entschieden werden musste. Zum Beispiel die Einrichtung von Arbeitsgemeinschaften, von Kinder-, Jugend- und Sportschulen, Zentralen Pionierlagern, Zentralstationen junger Naturforscher, junger Techniker, junger Touristen … – das alles trug ich ihm nach Abstimmung mit der FDJ mit entsprechenden Vorschlägen vor, und er brachte es auf den Weg. So wurde die ABC-Zeitung gegründet, der Kinderbuchverlag, die Zeitschrift Die Neue Schule … Und er fragte auch. Ich erinnere mich, dass er mich 1956 konsultierte, als es um die Konstituierung der Zentralleitung der Jungen Pioniere ging, damals als die Pionierorganisation selbständig wurde. Er war mit der Arbeit von Schirdewan, der als ZK-Sekretär für diesen Bereich mitverantwortlich war, nicht sonderlich zufrieden. Ulbricht hatte sich schon seinerzeit, 1947/48, in die Diskussion um Struktur und Namen der Organisation der Kinder konstruktiv eingemischt. Wie sollte die Organisation heißen, »Kinderland«, »Kindervereinigung«? Sogar »Junge Freiheit« war im Gespräch (man konnte ja nicht wissen, wer sich später dieses Namens bemächtigte). Die FDJ entschied sich für den Namen »Verband der Jungen Pioniere« – gewissermaßen als eine Abteilung der FDJ. Das behagte ihm nicht so recht, dennoch unterstützte er die Entscheidung der FDJ. Nun aber, Mitte der 50er Jahre, war er der Meinung, dass es besser sei, die Pioniere in einer eigenständigen Organisation zusammenzufassen. Er wollte, um ehrlich zu sein, die Kinderorganisation dem Einfluss von Schirdewan entziehen. Ich wurde gefragt, ob ich die Leitung der dann selbständigen Pionierorganisation übernehmen würde. Ich wollte nicht. So übernahm der 47-jährige Robert Lehmann, den Ulbricht bereits aus der illegalen Arbeit gegen den Faschismus kannte, die Leitung. Seine eigenständige Stellung wurde auch dadurch unterstrichen, dass Robert Mitglied des ZK der SED wurde. Robert Lehmann blieb bis 1964, danach kam Werner Engst. 1971 wurdest du, Egon, Pioniervorsitzender. Als übrigens Ende 1956 über die Herauslösung der Pionierorganisation aus der FDJ, also über die Bildung der Zentralleitung, im Politbüro entschieden wurde, ist Erich Honecker aus dem Sitzungsraum gegangen. Er war dagegen und wollte nicht mitentscheiden. 1964 drängte Horst Schumann, der damalige 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ, darauf, diesen Beschluss wieder rückgängig zu machen. Honecker unterstützte ihn. Die Phase der Selbständigkeit war damit wieder zu Ende. Wir wollten eigentlich über Walter Ulbricht sprechen. Wie sind die Gespräche mit ihm verlaufen, als du noch für die Pionierarbeit zuständig warst? Ich ging mit verschiedenen konkreten Überlegungen und Vorschlägen zu ihm, trug diese vor und erwartete, dass er zustimmte. Wobei ich natürlich den Dienstweg eingehalten habe: Erst ging ich zu Erich, dem FDJ-Vorsitzenden, und der schickte mich weiter zu Walter. Gab es vorher einen Schriftwechsel, Hausmitteilungen etc.? Nein. Die Bürokratie war damals noch nicht so stark ausgeprägt. Wart ihr per Du? Ja. Er redete mich immer mit »Junge« an, nicht etwa, wie gemeinhin üblich, mit »Genosse«. Ich war für ihn »Junge«. Wann habt ihr zum ersten Mal die Idee der Kinder- und Jugendsportschulen diskutiert? Ich glaube 1951. Ich hatte bis dahin davon noch nie etwas gehört. Er sagte: Beschäftige dich mal damit! Er muss da mal von so etwas Ähnlichem in der Sowjetunion gehört haben. Dort hatte man bereits in den 30er Jahren Spezialschulen für sportlich talentierte Kinder und Jugendliche eingerichtet. Gemeinsam mit der FDJ, dem DTSB und der Pionierorganisation wurde dann losgelegt. Bis Ende der 50er Jahre entstanden in der DDR an die zwei Dutzend KJS. Gibt es eine Begebenheit, eine Episode, in der Ulbrichts Verhältnis zum Nachwuchs für dich besonders deutlich wurde? Das war Anfang August 1963. Wir hatten dem IV. Deutschen Turn- und Sportfest eine Pionierspartakiade »vorgeschaltet«, und Ulbricht war zu einem Fußballspiel zusammen mit Sir Stanley Rous, dem Präsidenten der FIFA, erschienen. Es war unerträglich heiß, ich sah, wie er sich ständig den Schweiß von der Stirn wischte. Lotte sagte: »Komm, wir gehen besser.« Doch er winkte ab. »Ich habe den Kindern versprochen, dass ich mir das Spiel ansehe. Also bleibe ich auch bis zum Schlusspfiff.«
Helmut Müller: Und stets stellte er die berechtigte Frage: »Und, was ist das Neue?«
Helmut Müller, Jahrgang 1930, geboren in Reichenberg, heute Liberec, im Januar 1946 Übersiedlung nach Thüringen, Bauarbeiter, 1947 Mitglied der SED, Besuch der Komsomolhochschule in Moskau 1951/52, danach 1. Sekretär der FDJ Bezirksleitung Gera (bis 1955), anschließend bis 1966 Sekretär des FDJ-Zentralrats, ab 1966 SED Bezirksleitung Berlin, von 1971 bis 1989 deren 2. Sekretär. Ulbricht trug bei vielen den Beinamen »Freund und Förderer der Jugend«. Sein Prinzip »Der Jugend Vertrauen und Verantwortung« galt insbesondere für die Kaderpolitik. Unmittelbar nach dem Krieg, auf der ersten Zusammenkunft von KPD-Funktionären – noch die Bilder fanatischer Hitlerjungen vor Augen, die auf die Panzer der Roten Armee und deren Soldaten geschossen hatten erklärte er: »Wir haben das Vertrauen zur deutschen Jugend, dass sie mit Hilfe der erfahrenen Antifaschisten aus der Katastrophe, in die Hitler-Deutschland sie getrieben hat, lernen wird.«[55] Und entgegen der Annahme, die KPD werde dafür eine eigene Jugendorganisation schaffen oder den KJVD wiederbeleben,[55] orientierte er auf die Bildung einer überparteilichen antifaschistisch-demokratischen Jugendorganisation. Dies war eine gleichermaßen mutige wie strategisch richtige Orientierung. Statt die von den Nazis verführten Jugendlichen abzustrafen und auszugrenzen, sollten sie für eine neue Gesellschaft gewonnen werden. Das setzte zwingend voraus, den Verführten bewusst zu machen, einer schlechten, verbrecherischen Idee gefolgt zu sein. Die Jugendlichen benötigten keine Amnestie, wie einige forderten. Gemeinsam mit Pieck (KPD) und Grotewohl (SPD) vertrat Ulbricht den Standpunkt: Nicht die Jugendlichen sind schuld an Krieg und Faschismus, sondern in erster Linie das deutsche Monopolkapital. Es geht daher nicht um eine Amnestie der Jugend, sondern um die Bestrafung der Nazi- und Kriegsverbrecher. Nach meiner Überzeugung gehört es zu den größten Verdiensten Ulbrichts, dass der Antifaschismus die Grundlage für das Handeln aller demokratischen Kräfte im Osten Deutschlands wurde. Ulbricht trat frühzeitig für die Einheit von fachlicher und politischer Bildung der Jugend ein. 1948 verlangte er auf einem Jungaktivistenkongress: »Jeder ein Meister seines Fachs.« Zwei Jahre später sprach er von einem notwendigen Feldzug für Wissenschaft und Kultur: »Jeder Mensch, der schöpferische Arbeit leisten will, muss den Weg nach vorn kennen, sonst gleicht er einem Blinden, der mühsam mit dem Stock den Weg sucht. Daraus ergibt sich, dass jeder fortschrittliche Mensch sich heute mit dem Marxismus-Leninismus vertraut machen muss.«[56] In guter Erinnerung ist mir auch seine Begründung des Gesetzes über die Teilnahme der Jugend am Aufbau der DDR und die Förderung in Schule und Beruf, bei Sport und Erholung auf einer der ersten Sitzungen der Volkskammer. Damit erhielten die Grundrechte der jungen Generation – das Recht auf politische Mitbestimmung, auf Arbeit, Bildung, Freizeit und Erholung, auf dem I. Parlament der Freien Deutschen Jugend 1946 proklamiert Gesetzeskraft. Erstmals in der deutschen Geschichte wurden damit die Rechte und Pflichten der jungen Generation in und gegenüber der Gesellschaft gesetzlich fixiert. Das alles bestimmte auch meinen eigenen politischen Werdegang. Ich hatte damals jedoch keine Ahnung, wie diese strategischen Entscheidungen zustande gekommen waren. Das sollte sich ändern, als ich Einblick in die Arbeitsweise Ulbrichts erhielt. Es war am Abend vor dem V. Parlament der FDJ 1955 in Erfurt.[Anmerkung 39] Der Erste Sekretär des ZK der SED traf sich mit den Sekretären des Zentralrats der FDJ in der Blumenstadt. Obgleich ich erst vom Parlament ins Sekretariat gewählt werden sollte, nahm ich an dieser Runde teil. Mich beeindruckte, wie Ulbricht ungezwungen mit uns umging, was die Atmosphäre spürbar lockerte. Zudem schien er die Probleme junger Leute zu kennen, dennoch fragte er nach und zeigte sich als aufmerksamer Zuhörer. Manches von dem, was wir ihm gesagt hatten, floss in seine Rede ein, die er später hielt. Auf seine wiederholt gestellte rhetorische Frage: Was ist das Neue? lieferte er immer gleich auch die Antwort. Neu sei, dass die Jugend »ein schönes Ziel vor Augen hat: den Aufbau des Sozialismus in der DDR und die Schaffung eines neuen Deutschlands, des einigen, des demokratischen und friedliebenden Deutschlands«. Er lobte die großen Leistungen der FDJ beim Wirken unter der jungen Generation, doch jetzt komme es darauf an, »die ganze Jugend zu guten Patrioten zu erziehen. Das ist noch etwas mehr.«[57] Ihm lag daran, alle Seiten der Tätigkeit der FDJ zu entwickeln, die forcierte politische Aufklärungsarbeit sollte mit einem frohen, bunten Jugendleben verbunden und gestaltet werden. Gleichzeitig, so Ulbricht, müsse die ganze Gesellschaft, die Gliederungen der SED, die Massenorganisationen und die staatlichen Organe, mehr zur Unterstützung der Freien Deutschen Jugend tun. Das Ziel war klar, darin schienen sich alle einig. Nur über den Weg gab es viele kontroverse Diskussionen bis hoch zur SED-Führung. Das zeigte sich auf der 25. Tagung des ZK der SED im Oktober 1955. Das Politbüromitglied Albert Norden kritisierte scharf negative Erscheinungen in der Arbeit der FDJ. Man gewänne nicht selten den Eindruck, sagte er, als ob es auf der einen Seite die FDJ und auf der anderen Seite die Jugend gebe. Er forderte darum, »dass die FDJ endlich einmal was losmache«, offenkundig war sie ihm – sagen wir es salopp – zu lahmarschig. Man solle sich stärker an den Bedürfnissen und Wünschen der Mädchen und Jungen orientieren, mehr Wanderungen, mehr Fahrten, mehr Tanzabende, mehr Sportveranstaltungen, mehr Besuche von Museen etc. organisieren. Es dürfe in Frühjahr, Sommer und Herbst keine Woche vergehen ohne eine Großveranstaltung der FDJ. Norden schlug vor, dass dazu im Zentralrat der FDJ eine Reihe von Referaten geschaffen werden sollte: für Berufsberatung, ein eigener Veranstaltungsdienst, ein Referat für die Organisierung von Heimattreffen, von Ausflügen, Beratungsstellen für Modefragen, für Körperpflege, für Ehefragen, Referate für Technik und Wissenschaft, für Musik, für Literatur, für Brettspiele usw. Die Vorschläge des rhetorisch brillanten Norden fanden den Beifall der meisten Mitglieder und Kandidaten des Zentralkomitees.[58] Nicht jedoch den von Walter Ulbricht. Sicher, manchem stimmte er zu, er hatte das schließlich auch in seiner Rede auf dem V. Parlament gesagt. Doch während er auf eine ganzheitliche Jugendarbeit setzte, die alle Seiten gleichermaßen berücksichtigte, orientierte Norden vor allem auf die Gestaltung einer interessanten Freizeit. Er vernachlässigte offenkundig die politische Überzeugungsarbeit. Ulbricht reagierte darauf, wie man es von ihm inzwischen gewohnt war: konstruktiv. Er mochte es nicht, andere zu kritisieren, wenn nicht klar war, wie die Partei einen beklagten Zustand verändern wollte. Darum entgegnete er, dass eine Änderung der Aufgabenstellung für die FDJ nicht nötig sei. Vielmehr sei zu überlegen, wie der FDJ geholfen werden könne. Er nannte dazu die Bildung von Jugendausschüssen, die sich in den Wohngebieten mit der Organisierung einer lebendigen, interessanten Freizeit beschäftigen sollten. Zur Mitarbeit seien auch Jugendliche zu gewinnen, die nicht in der FDJ organisiert seien. Man müsse Neues in der Praxis studieren. Danach solle das Politbüro zur Situation der Jugend Stellung nehmen.[58] Karl Schirdewan, seit Juli 1953 im Politbüro und als ZK-Sekretär für die Jugendpolitik der Partei und die Anleitung der Parteimitglieder im Zentralrat der FDJ verantwortlich, favorisierte jedoch Nordens Herangehen und veranlasste, dass dessen Rede in der Jungen Welt veröffentlicht wurde.[59] Das wiederum irritierte die FDJ-Führung, dass im Zentralorgan des Jugendverbandes eine Orientierung publiziert wurde, die ganz offenkundig nicht die des ersten Mannes in der Partei war. Um hier Klarheit zu schaffen, war es notwendig, einen prinzipiellen Beschluss der Parteiführung zur Jugendarbeit zu fassen. Dies geschah in einer Sitzung des Politbüros am 24. Januar 1956. Nach hitziger Diskussion wurde das Papier »Der Jugend unser Herz und unsere Hilfe« beschlossen. Diesen Beschluss nahm der Zentralrat der FDJ als Grundlage, um sich mit einem Appell an die Öffentlichkeit zu wenden: »An euch alle, die ihr jung seid!«[60] Darin wurde allen Jugendlichen ein umfangreiches Angebot zum Meinungsaustausch und zur Wahrnehmung ihrer Interessen gemacht. Doch die im Ruf vorgeschlagenen Themen für eine umfassende Aussprache wurden bald durch ein größeres Ereignis, den XX. Parteitag der KPdSU, überlagert. Chruschtschows Enthüllungen »über den Personenkult Stalins und seine Folgen« provozierten auch unter den Jugendlichen heftige Diskussionen und zahllose Fragen, besonders unter Studenten und jungen Angehörigen der Intelligenz. In dieser bewegten Zeit wurde Walter Ulbricht von vielen Seiten scharf angegriffen, nicht nur von jungen Leuten. Zunächst traten die Mitglieder der Parteiführung geschlossen der Hetze gegen Ulbricht entgegen. Schirdewan hob Ulbrichts Leistungen »für die deutsche Arbeiterklasse bei der Schaffung einer Partei neuen Typs, gemeinsam mit Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl und den Mitgliedern des Zentralkomitees, bei dem Ringen um die Einheit der deutschen Arbeiterklasse«, hervor.[61] Die Wahrung der Einheit der Partei und ihrer Führung sei lebensnotwendig, wenn die DDR weiter bestehen bleiben wolle. (Interessant ist, dass Ulbricht in dieser für ihn schwierigen Periode einen bedeutenden Beschluss durchsetzte, der von Zeitgeschichtlern meist ignoriert wird. Darin ging es um »Maßnahmen zur breiteren Entfaltung der Demokratie in der Deutschen Demokratischen Republik«.) Der Streit darüber, wie mit dem XX. Parteitag der KPdSU und dessen Feststellungen umgegangen werden sollte, spitzte sich im Politbüro zu. Fred Oelßner erklärte am 3. Juli 1956 im Politbüro: »Wir haben mit der Auswertung des XX. Parteitages noch nicht richtig begonnen«, so das Politbüromitglied. »Vor allen in der Frage des Personenkults weichen wir aus«, meinte er. »Für uns steht in diesem Zusammenhang die wichtige Frage: Gibt es in der SED Personenkult? Jawohl, es gibt ihn und damit im Zusammenhang ein personelles Regime, das hauptsächlich von Genossen Ulbricht ausgeübt wird.«[62] Diesen Eindruck hatten auch nicht wenige DDR-Bürger. Und ich will auch nicht urteilen, ob dieser Eindruck richtig oder falsch war, begründet oder abwegig. Es ging um eine polische und prinzipielle Frage. Und die lautete: Widersetzt man sich dieser Stimmung oder gibt man ihr nach? Gewinnt die Partei durch Ulbrichts Ablösung, oder würde sie verlieren? Und wäre ein Nachgeben in dieser Frage nicht eine Kapitulation gegenüber jenen Kräften, die keine bessere DDR wollten, sondern deren Beseitigung? Die auch vom Westen beeinflusste und auch forcierte Diskussion bedeutete objektiv keine Stärkung, sondern eine Schwächung der Partei. Ende Juli 1956 kam die 28. Tagung des ZK der SED zusammen, das Plenum trat den Verleumdungen geschlossen entgegen. Wie notwendig dies war, zeigte die Zuspitzung der Lage insbesondere an Universitäten und Hochschulen. Als Reaktion auf die Ablösung der Führung der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP) und die konterrevolutionären Aktivitäten in Ungarn bildeten sich an verschiedenen Fakultäten organisatorische Strukturen mit Bezeichnungen wie »13er Rat« oder »56er Rat«, die zu staatsfeindlichen Aktionen aufriefen. So wurden Unterschriften gesammelt für einen antikommunistischen Appell, in dem es hieß: »Wir rufen jeden Studenten auf, gegen das ausländische Joch sowohl im Westen wie im Osten zu kämpfen. Die letzten Ereignisse in Polen und Ungarn zeigen mit aller Deutlichkeit, dass dieser Kampf nicht aussichtslos sein wird. Studenten, verweigert die Tätigkeit in der kommunistischen Zwangsorganisation FDJ. Nutzt die Gelegenheit der Ausbildung an Waffen der GST. Zieht die Lehren aus dem Volksaufstand vom 17. Juni 1953! Studenten! Gebt den Anstoß zum deutschen Freiheitskampf!«[Anmerkung 40] Auftakt der geplanten Konterrevolution sollte eine studentische Kundgebung am Brandenburger Tor sein. Es war eine Machtprobe, in der es faktisch um Sein oder Nichtsein der DDR gehen sollte. Besonnenheit und Klarheit in der Führung waren gefragt. Ulbricht verfolgte eine Doppelstrategie: Er schickte die Politbüromitglieder Alfred Neumann und Karl Schirdewan in eine Versammlung von Studenten an der Humboldt-Universität. Er wollte die Situation politisch entschärfen, nicht mit den Gewaltinstrumenten des Staates. Falls gegnerische Kräfte jedoch weiter provozieren würden, auch das gab er zu verstehen, würde er notfalls auch mit Gewalt die Arbeiter- und Bauernmacht verteidigen. Mit Ulbrichts Zustimmung sollten vorerst Kampfgruppen der Arbeiterklasse nur Präsenz zeigen und die Eingangskontrolle vor dem Gebäude der Humboldt-Universität übernehmen. Auf diese Weise sollten Provokateure aus Westberlin an der Teilnahme gehindert werden. Schirdewan lehnte diese Maßnahme ab. Er meinte, dass man allein mit den Mitteln der ideologischen Überzeugung durchkomme, er glaubte nicht daran, »dass es sich hier um einen Kampf mit der amerikanischen und englischen Agentur handelt, die von Westberlin aus an der Humboldt-Universität arbeitete«.[63] Im FDJ-Zentralrat erfuhren wir von diesen internen Vorgängen im Politbüro vorerst nichts. Bei den Zusammenkünften Schirdewans mit uns, die zunahmen, spürten wir seine politische Unsicherheit. Woche für Woche wurden von ihm neue, oft sich widersprechende Forderungen zur Arbeit mit der Jugend erhoben. Am 19. März 1957 legte er schließlich einen Grundsatzbeschluss und den Entwurf eines Hochschulprogramms der FDJ vor. Wir Sekretäre des Zentralrates wurden dazu ins Politbüro gebeten. Hoffnungsvoll warteten wir lange im Vorraum, bis wir endlich aufgerufen wurden. Walter Ulbricht teilte uns mit, dass sich das Politbüro verständigt habe und Karl Schirdewan uns nun mitteilen werde, zu welchem Entschluss man gekommen sei. Seine Auskunft war nicht nur kurz, sondern vor allem überraschend. Das Politbüro stimme den Dokumenten nicht zu, sagte Schirdewan. Das bedeutete, seine Linie war abgelehnt worden, das für die Jugendarbeit vorgesehene Politbüromitglied durchgefallen. Die eigentliche Überraschung für uns aber waren die Beschlussvorschläge, die Walter Ulbricht nunmehr unterbreitete. Er empfahl uns, einen offenen und breiten Meinungsaustausch über Grundfragen der FDJ zu organisieren. Den Hochschulgruppen der FDJ solle der Entwurf eines Hochschulprogramms zur freien Diskussion mit den Studenten und Angehörigen des Lehrkörpers übergeben werden. Er empfahl, dass Bezirksdelegiertenkonferenzen der FDJ stattfinden sollten, damit, solcherart demokratisch erarbeitet und legitimiert, der Zentralrat einen Beschluss fassen könne. An diesen Beratungen würden auch Mitglieder des Politbüros teilnehmen.[64] Die Vorschläge Ulbrichts erwiesen sich als zeitgemäß. Die Aussprache mit den Studenten und Professoren führte zu einem Hochschulprogramm, das als Ziel postulierte: »Aufgabe der Universitäten und Hochschulen der DDR ist es, den wissenschaftlichen, technischen und künstlerischen Nachwuchs für die Sache der Arbeiter und Bauern und ihre sozialistische Staatsmacht zu erziehen.«[65] Am 8. April 1957 lud uns Ulbricht zu einer Besprechung. Als wir in seinem Vorzimmer die Mitglieder des Politbüros Friedrich Ebert, Hermann Matern und Alfred Neumann sowie die ZK-Mitglieder Gerhart Eisler und Horst Klemm trafen der Leiter des Sektors Jugend vertrat seinen im Urlaub weilenden Chef Schirdewan –, ahnten wir, dass es um Grundsätzliches gehen würde. Es begann ziemlich harmlos. Ulbricht bemängelte Kleinigkeiten an dem vorliegenden Beschlussentwurf, was einer solch hochrangigen Zusammenkunft nicht bedurft hätte. Dann schockte er uns mit der Bemerkung, offensichtlich sei nicht klar, was die FDJ sei. Lebhaft versuchten wir, darauf Antwort zu geben. Keine unserer Äußerungen schien ihn jedoch zu befriedigen. Als Horst Klemm meinte, dass aus dem bisher Gesagten der Schluss zu ziehen sei, dass »die FDJ eine sozialistische Jugendorganisation« sei, nahm Ulbricht das Wort. Genau darum gehe es, resümierte er. Er habe diese Feststellung schon im Entwurf seines Referates für die 30. Tagung formuliert, sie dann aber wieder gestrichen, weil sie vielleicht nicht verstanden worden wäre. Nun solle der Zentralrat der FDJ dazu Stellung nehmen. Am 12. April 1957 stimmte Ulbricht mit einer Rede auf der Bezirksdelegiertenkonferenz der FDJ in seiner Heimatstadt Leipzig die Öffentlichkeit auf die Entscheidung des FDJ-Zentralrats ein.[66] Wenig später, am 25. April 1957, nahm er an der Tagung des FDJ-Zentralrats teil und erläuterte den Zusammenhang von der perspektivischen Entwicklung des Sozialismus in der DDR und den sich daraus ergebenden neuen Anforderungen an die Arbeit der FDJ. Die Tagung erklärte die Freie Deutsche Jugend zur sozialistischen Jugendorganisation der DDR. Walter Ulbricht ist es zu danken, dass die FDJ in komplizierter Zeit nicht durch Fraktionskämpfe in der SED zerrieben wurde. Er half konstruktiv mit, die FDJ zur sozialistische Massenorganisation der Jugend zu formieren.
Hans Modrow: Mit der Jugend auf glattem Eis
Hans Modrow, Jahrgang 1928, in Pommern Lehre als Maschinenschlosser, mit 17 zum Volkssturm verpflichtet. Ohne je einen Schuss abgegeben zu haben, kam er für vier Jahre in sowjetische Kriegsgefangenschaft. 1949 Rückkehr nach Deutschland, FDJ-Funktionär, Besuch der Komsomol-Hochschule in Moskau 1952/53, von 1954 bis 1957 Fernstudium an der Parteihochschule in Berlin und von 1959 bis 1961 an der Hochschule für Ökonomie. Sekretär des FDJ-Zentralrats in den 50er Jahren, dann 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Berlin-Köpenick, Sekretär der SED Bezirksleitung Berlin bis 1971, Leiter der Abteilung Agitation des ZK der SED bis 1973, dann bis 1989 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Dresden. Von November 1989 bis April 1990 Ministerpräsident der DDR. Abgeordneter des Landtags von Mecklenburg-Vorpommern (bis 1952), der Volkskammer (1958-1990), des Deutschen Bundestages (bis 1994) und des Europa-Parlaments (1999-2004). Ehrenvorsitzender der PDS bis zu deren Aufgehen in der Linkspartei 2007. Die Volkskammer hatte noch provisorischen Status, als am 8. Februar 1950 das erste Gesetz über Jugend und Sport beschlossen wurde. Die DDR sollte zum Staat der Jugend und des Sports werden. Das mit der Jugend ist uns nie so recht gelungen, das mit dem Sport brachte uns Weltgeltung. Mit 17 Millionen Einwohnern die dritte Stelle im Weltsport einzunehmen war und bleibt einmalig und wird auch mit Walter Ulbricht verbunden bleiben. Als mir 1961 der Titel »Verdienter Meister des Sports« verliehen wurde, war das auch eine Anerkennung für die Berliner FDJ, für unsere Initiative bei der Entwicklung ansprechender Formen des Massensports, worauf Ulbricht mehr Wert legte als die Spitze der DDR Sportorganisation DTSB. Wenn ich heute die Massenläufe in New York, London und Berlin verfolge, erinnere ich mich noch an den jährlichen Berlin-Lauf der BZ am Abend in den 50er Jahren, an dem Tausende Schüler und Lehrlinge teilnahmen, und an das Tischtennis Turnier der Tausenden (TTT), das seit 1960 jährlich bis heute ausgetragen wird. Der Olympische Tag der Leichtathletik, 1963 erstmals im Jahn Sportpark abgehalten, kehrte 2002 dorthin zurück, als das Olympiastadion renoviert wurde. Als Internationales Stadionfest (ISTAF) lebt unser Olympischer Tag weiter. Die Jugendpolitik der DDR trägt die Handschrift Walter Ulbrichts und wurde auch zu seinem Sturz missbraucht. 1955 drängte er auf einen Wechsel an der Spitze der FDJ, weil der Jugendverband die Masse der Jugend nicht erreichte. Erich Honecker, bis dahin Vorsitzender der FDJ, wurde zum Studium an die Parteihochschule nach Moskau geschickt. Ihm folgte der 29 jährige Karl Namokel nach, ein gelernter Schiffbauer und bis dahin Sekretär für Wirtschaft in der SED-Bezirksleitung Rostock. 1956 fand der XX. Parteitag der KPdSU statt. Nikita S. Chruschtschow entlarvte die Verbrechen Stalins und sprach vom Personenkult. Es war ein Schock für alle, denen die Sowjetunion als Orientierung diente. Offene Fragen, auch Zweifel, drängten sich auf. Unsicherheiten in der Spitze der Partei führten zu Machtkämpfen, die auch im Zusammenhang mit der Jugendpolitik ausgetragen wurden. Aufgrund unterschiedlicher Positionen ergaben sich auch Freiräume für das politische Wirken unter der Jugend. So wurden in Berlin Jugendforen unter dem Motto »Auf jede Frage eine Antwort« organisiert. Einen festen Platz im Podium hatten die FDJ-Bezirksleitung und die Chefredaktion der Zeitung Junge Welt als Veranstalter. Gerhart Eisler, Chef des Staatlichen Rundfunkkomitees, war ebenfalls dabei. Der antwortete einmal auf eine Frage zu seiner Biografie: »Ihr sollt wissen, auch Kommunisten werden als Bettnässer geboren.« Damit wollte er pointiert deutlich machen, dass niemand vollkommen war. Es gab zwei Foren mit Gerhart Eisler über Jazz. Das Thema war zu jener Zeit politisch gekoppelt an den kulturellen Einfluss der USA, genannt Kulturimperialismus. Eisler stellte die Musik in einen historischen Kontext, ordnete sie in die Geschichte des »schwarzen Amerika« ein und verband das mit eigenen Erlebnissen während seiner Emigration in die USA. Ulbricht hatte zunehmend politische Bauchschmerzen mit dieser Veranstaltungsreihe, er nannte sie schließlich »Eselswiese«. Die Foren wurden eingestellt. Der Blick der FDJ sollte sich stärker auf die jungen Künstlerinnen und Künstler richten. Im Juni 1956 wurde dazu eine Konferenz in Karl-Marx-Stadt durchgeführt. Die Berliner Schriftsteller Heinz Bieler, Jens Gerlach, Heinz Kahlau und Manfred Streubel hatten ihr Auftreten gut vorbereitet. Ihre vier Diskussionsreden klangen wie ein gemeinsames Referat, in dem sie den Jugendverband kritisierten, weil der ihre Interessen nicht ausreichend vertrat. Konrad Wolf, Mitglied des Zentralrats und nachmals Präsident der Akademie der Künste, reagierte darauf in seinem Schlusswort. Von Karl-Marx-Stadt fuhren wir sofort nach Rostock zur 13. Tagung des Zentralrats. Dort erklärte ich, wir würden als Jugendfunktionäre einen großen Fehler begehen, wenn wir uns als Gegner und nicht als Partner der jungen Kulturschaffenden verstünden. Ich ahnte nicht, welche Rolle diese Feststellung zwei Jahre später spielen sollte. 1957 erfolgte eine Neuausrichtung in der Jugendpolitik der Partei. Ulbricht selbst strebte an, was als Widerspruch nicht auflösbar schien. Er orientierte einerseits unverändert auf die Gewinnung eines Masseneinflusses durch die FDJ, also auf wachsende Mitgliederzahlen. Und andererseits wünschte er den politischen Charakter auszuprägen. Die FDJ sollte »sozialistischer Jugendverband« werden, weshalb die politisch ideologische Arbeit ausgeweitet werden sollte. Das war erkennbar ein Spagat. Im Hintergrund liefen scharfe Auseinandersetzungen zwischen Ulbricht und Schirdewan um Kurs und Macht in der Partei. Ulbricht setzte sich durch, im Februar 1958 wurde Schirdewan aus dem ZK der SED ausgeschlossen und aller Funktionen enthoben. Während es bei den Auseinandersetzungen etwa mit Anton Ackermann zu Beginn der 50er Jahre um unterschiedliche Positionen zur Entwicklung des Sozialismus in Deutschland ging, war der Konflikt zwischen Schirdewan und Ulbricht persönlicher Natur, der sich allenfalls als ein Streit um die strategische Orientierung tarnte. Er wurde im Vorfeld des V. Parteitages ausgetragen, und nachdem er in der Partei entschieden war, setzte er sich fort in der Führung des Jugendverbandes, denn Schirdewan war bis dahin als ZK-Sekretär auch für die FDJ verantwortlich. Eine Abrechnung mit der falschen Orientierung Karl Schirdewans in der Jugendpolitik erfolgte im Bericht über die Tätigkeit des Sekretariats und des Büros des Zentralrats. Darin wurde nachgewiesen, dass das Wirken Schirdewans schädlich gewesen sei für die FDJ. Die Tagesordnung lautete zwar »Ergreift die Waffen der Kultur!«, aber Kulturveranstaltungen wie die Jugendforen oder Freizeitvergnügen wie Camping galten als unpolitisch. Die Autoren des Berichtes erinnerten sich des Kongresses junger Künstler in Karl Marx-Stadt und der nachfolgenden Zentralratstagung. Und dass ich die Position von Gerlach, Kahlau, Bieler und Streubel unterstützt hatte – so überzogen sie vielleicht im Einzelnen auch war. Aber sie war prinzipiell richtig, weil sie sich unausgesprochen gegen die nunmehr kritisierte Schirdewan-Linie gewandt hatten. So wurde das zwar nicht formuliert, aber genau so war es gemeint. Nunmehr rückte ich also in den Fokus als vermeintlicher Schirdewan-Mann. Die Auseinandersetzung mit mir erfolgte jedoch nicht im Plenum des Zentralrats, sondern in der SED-Parteigruppe. Letztlich ging es um den Verbleib in meiner Funktion. Dass ich nicht wie Schirdewan in die politische Wüste geschickt wurde, verdanke ich Alfred Neumann, seit 1953 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin und nunmehr ZK-Sekretär, sowie Walter Ulbricht, der Neumanns Personalpolitik billigte. Der V. Parteitag 1958 beendete die Auseinandersetzungen in der SED Führung, die seit 1953 die Partei beschäftigt hatten. Neben Walter Ulbricht, der sich und seine Linie durchgesetzt hatte, war Organisations und Kadersekretär Alfred Neumann der neue wichtige Mann. Nikita S. Chruschtschow, Ehrengast im Präsidium des Parteitages, stärkte in seiner Rede Ulbricht. Dieser präsentierte die »Zehn Gebote der sozialistischen Moral«, die analog den christlichen Geboten – den Wertekanon von atheistischen Sozialisten darstellten und auch für Jugendliche in der FDJ moralisch ethische Richtschnur sein sollte. Es gab bis dahin und auch in der Folgezeit wiederholt persönliche Begegnungen mit Walter Ulbricht, die mir das Bild eines zielstrebig und strategisch handelnden Politikers vermittelten. Als nach der 2. Parteikonferenz 1952 die fünf Länder aufgelöst wurden und 15 Bezirke an ihre Stelle traten, saß ich mehrmals am Tisch von Walter Ulbricht. Bei den Beratungen ging es nicht zuletzt um Kaderfragen, denn die neuen Strukturen verlangten dreimal mehr Personal. Zwischen dem FDJ Vorsitzenden Erich Honecker und mir als Landesvorsitzendem in Mecklenburg gab es keine Übereinstimmung, was die Besetzung der Sekretariate in den neuen Bezirksleitungen betraf. Walter Ulbricht vermittelte und glich aus. Danach ging ich nach Moskau zum Studium und kehrte erst im August 1953 zurück. Unser Streit damals war vergessen, ich wurde als Sekretär des Zentralrats und als 1. Sekretär der FDJ Bezirksleitung Berlin gewählt. Auseinandersetzungen gab es erst wieder 1954, als das 2. Deutschlandtreffen vorbereitet wurde. Friedrich Ebert, Oberbürgermeister von Groß-Berlin, wie es damals offiziell hieß, und Mitglied des Politbüros, folgte den Beschlüssen des Politbüros und den Weisungen Walter Ulbrichts. Der FDJ Vorsitzende Erich Honecker interpretierte manchen Beschluss anders. Und um nicht persönlich anzuecken, wenn er widersprechen wollte, schickte er den 1. Sekretär der FDJ Bezirksleitung vor. Ich musste dann dieses und jenes mit Friedrich Ebert »klären«. Wenn dies nicht in seinem Sinne gelang, kritisierte er mich: Ich hätte als Sekretär des Zentralrats die Beschlüsse der Führung des Jugendverbandes in Berlin durchzusetzen, ich sei nicht der Vertreter von Berliner Interessen in der Führung des Jugendverbandes. Ich erinnere mich lebhaft an Veranstaltungen in den Jahren 1954/55 mit der Berliner Jugend, die Walter Ulbricht in der Sporthalle an der Stalinallee abhielt. Daran nahmen mehr als dreitausend Mädchen und Jungen teil, die dem Ersten Sekretär und Stellvertreter des Ministerpräsidenten Fragen stellten. Es waren Rechenschaftslegungen darüber, wie das Gesetz über Jugend und Sport verwirklicht wurde. Für Ulbricht entsprachen solche Zusammenkünfte seinem Verständnis von sozialistischer Demokratie. Jene, die das in Abrede stellen, sollten sich fragen: Gab es jemals in der Bundesrepublik ein vergleichbares Gesetz? Und: Hat Adenauer auch nur einmal vor jungen Westdeutschen seine Politik vertreten und Rechenschaft abgelegt? Und ich entsinne mich des Winters 1956/57. Der Jugendausschuss der Berliner Stadtverordnetenversammlung hatte nach manchem Streit mit der Administration durchgesetzt, dass Spritzeisbahnen im Stadtgebiet angelegt wurden. Als Bilder in den Zeitungen erschienen, die schlittschuhlaufende Jugendliche zeigten, erreichte mich ein Anruf aus dem Büro Ulbricht. Der Genosse Walter Ulbricht möchte zum Schlittschuhlaufen mit der Jugend eingeladen werden. Wie bitte? Nun, wir baten ihn zur Spritzbahn am S-Bahnhof Treptower Park. Und der Parteichef, bereits jenseits der 60, erschien mit Schlittschuhen und drehte Achten und lief Kurven. Und die Leute auf dem Eis schauten nicht aus der Distanz zu, sondern nutzten die Gelegenheit, sich auch mit ihm zu unterhalten. Bei der Erarbeitung des Berichts des ZK an den V. Parteitag der SED 1958, den Ulbricht vor dem Plenum abgeben sollte, wurde ich gebeten, den Abschnitt über Jugend und Sport zu redigieren. Ich nehme an, dass ich diese Prüfung bestanden habe, denn ich wurde als Kandidat in das Zentralkomitee der SED gewählt. Im Juli 1963 wurde Kurt Turba auf Vorschlag Walter Ulbrichts als Vorsitzender der Jugendkommission beim Politbüro berufen. Wir beide kannten uns nicht nur gut, wir waren miteinander befreundet. Turba, ein Jahr älter als ich, hatte in Jena Geschichte studiert und leitete seit zehn Jahren die Studentenzeitschrift forum, die unter dem Dach des FDJ-Verlages »Junge Welt« erschien. Ulbricht versuchte erneut, die Quadratur des Kreises zu beschreiben und den Grundwiderspruch seiner Jugendpolitik aufzulösen, nämlich den zwischen dem Anspruch, dass die FDJ einerseits Massenorganisation und andererseits Helfer und Kampfreserve der SED sein sollte. Im Auftrag Ulbrichts entwarf Turba gemeinsam mit Heinz Nahke, seinem Nachfolger als Chefredakteur des forum, mit Harald Wessel, Brigitte Reimann und anderen das Jugendkommuniqué »Der Jugend Vertrauen und Verantwortung«, welches die Parteiführung 1963 einstimmig akzeptierte. In jenem Jahr, auf dem VI. Parteitag der SED, war auch das Reformkonzept der sozialistischen Gesellschaft unter der Bezeichnung »Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung« beschlossen worden. Dies fand in Moskau nach dem dort 1964 erfolgten Machtwechsel keine Zustimmung mehr. Im Unterschied zu Chruschtschow duldete dessen Nachfolger Breshnew keine Korrekturen am sowjetischen Sozialismusmodell. Auf dem 11. Plenum des ZK der SED im Dezember 1965 erfolgte die erste massive Kritik an diesem Kurs. Wortführer war Erich Honecker, assistiert von Paul Verner, 1. Sekretär der Bezirksleitung Berlin und Mitglied des Politbüros. Die Vorhaltungen an die Adresse Turbas galten Ulbricht. Man prügelte den Sack, meinte aber den Esel. Mit der Abberufung Turbas sollte Ulbrichts Autorität untergraben werden. Beide, Honecker wie Verner, waren Ulbricht nicht gewachsen, aber als seine Schüler hatten sie gelernt, wie man um die Macht kämpft. 1970 waren sie dem greisen Ulbricht dann überlegen. Auf der 11. Tagung trat Honecker eine Auseinandersetzung mit der Kulturpolitik und die Korrektur der mit Turba verbundenen Jugendpolitik los, es begann der Widerstand gegen die Neue Ökonomische Politik. Übel ist in diesem Zusammenhang die Rolle Günter Mittags. Er hatte, gemeinsam mit Erich Apel, federführend an der Ausarbeitung des NÖS mitgewirkt und dabei seine Macht gestärkt. Als sich das innere Kräfteverhältnis änderte und der Sturz Ulbrichts spruchreif war, stahl er sich in das Vertrauen Honeckers, welches ihm bis 1989 erhalten bleiben sollte. Im Sommer 1966 sprach Erich Honecker als Kadersekretär des ZK mit mir über einen Einsatz als Wirtschaftssekretär im Bezirk Karl Marx-Stadt. Ich war grundsätzlich bereit, diesem Parteiauftrag zu folgen. Als Ulbricht aber davon erfuhr, lehnte er meinen Einsatz in Sachsen mit dem Argument ab, dass es der Berliner Parteiführung schwerfalle, Vertrauen nach innen wie nach außen zu gewinnen. Modrow sei einer, dem man vertraue. Deshalb bleibe er hier, in Berlin. Das Problem mangelnder Akzeptanz (oder Vertrauens) war schon unter den Bedingungen der offenen Grenze insbesondere in Westberlin zu beobachten. Wiederholt, mindestens ein halbes Dutzend Mal, lud Ulbricht den Nachfolger Alfred Neumanns an der Spitze der Berliner Parteiorganisation, Hans Kiefert, mit dem Büro der Bezirksleitung ins Politbüro. Dabei begleitete ich ihn. Die Wirkung der SED in Westberlin war gering, im Ostteil ging es auch nicht so recht voran. Hans Kiefert mühte sich redlich, war jedoch mit seiner Aufgabe überfordert. Der Druck wuchs. Ulbricht sah das und sorgte behutsam dafür, das Kiefert 1963 als Stadtrat für Arbeit in den Magistrat wechseln konnte, ohne Schimpf und Schande, wie das üblicherweise geschah, wenn ein hoher Parteifunktionär seines Amtes verlustig ging. Ulbricht bestimmte Paul Verner zu Kieferts Nachfolger. Dieser sollte sich alsbald mit Honecker verbünden und war kein Mann Ulbrichts mehr. Nachdem Ulbricht als Erster Sekretär zurückgetreten worden war, blieb er aber noch Vorsitzender des Staatsrates. Zu dessen Aufgaben gehörte die Akkreditierung und Verabschiedung von Diplomaten. Bislang wurde dies von der Nachrichtenagentur ADN stets mit einer Bildnachricht vermeldet. Honecker ordnete an, dass dies künftig zu unterbleiben habe. Lotte Ulbricht bemerkte dies natürlich und rief bei ADN an, wo man ausweichend reagierte. Dann rief sie beim zuständigen Abteilungsleiter im ZK an. Das war ich. »Hans, sorg doch bitte dafür, dass das wie gewohnt vermeldet wird.« Nun, die Aufhebung der Order konnte ich so wenig entscheiden wie ich sie verfügt hatte. Ich informierte meinen Chef Werner Lamberz und dieser Honecker, da eine Meldung bei einer konkreten Nachfrage nicht zu vermeiden war. Honecker erfand daraufhin die Funktion des »amtierenden Staatsratsvorsitzenden«, die die Verfassung nicht vorsah. Aber Friedrich Ebert, Sohn des einstigen Reichskanzlers gleichen Namens, übernahm gern die Rolle des Staatsoberhauptes, schon wegen der Kontinuität. Fortan empfing er die Botschafter. So wurde ein neuerlicher Anruf von Lotte Ulbricht überflüssig. Ich erlebte Walter Ulbricht als einen Politiker, zu dem die Widersprüche gehörten, die in seiner Generation kommunistischer Politiker und Funktionäre ausgeprägt waren. Dennoch gehört er für mich zu den bedeutendsten deutschen Politikern des 20. Jahrhunderts. Er hatte an den Fronten des Zweiten Weltkrieges in Agitationseinsätzen gegen den Faschismus geholfen, die deutsche Ehre zu retten. Und dass der Kalte Krieg nicht zu einem Dritten Weltkrieg wurde, ist ihm ebenfalls gutzuschreiben. Das bleibt.
Klaus Höpcke: 1949, 1953, 1963 etc. Ulbricht war stets für Überraschungen gut
Klaus Höpcke, Jahrgang 1933, nach dem Journalistikstudium bis 1960 wissenschaftlicher Assistent an der Karl-Marx-Universität, danach (bis 1962) Stellvertretender Sekretär der Universitätsparteileitung, anschließend 1. Sekretär der Bezirksleitung Leipzig der FDJ. Von 1964 bis 1973 tätig beim »Neuen Deutschland«, danach – bis 1989 – stellvertretender Kulturminister und Leiter der Hauptverwaltung Verlage und Buchhandel. Von 1990 bis 1999 Mitglied des Thüringer Landtages, Mitglied des Ältestenrates der Linkspartei. In meiner linken Hand hielt ich eine leuchtend brennende Fackel, in der rechten einen Brief – so ausgerüstet lief ich an einem Abend im Herbst 1949 in der Mitte einer Straße, die von Berlin Pankow ins Stadtzentrum führte. Um mich herum waren Mitglieder der Freien Deutschen Jugend und viele andere junge Leute aus allen Kreisen der kurz zuvor gegründeten Deutschen Demokratischen Republik. Darunter eine Gruppe Neubrandenburger Oberschüler, zu der ich gehörte. Mit den Fackeln wollten wir die Staatsgründung begrüßen. Und Glück wünschen wollten wir den Frauen und Männern, die bereit waren, in diesem Staat Verantwortung zu übernehmen, und die sich jetzt Unter den Linden am Rande des Demonstrationszuges auf der Ladefläche eines Lastwagens versammelt hatten. Unsere Gratulationen erwiderten sie mit fröhlichen Zurufen und Winken. Wir interessierten uns besonders für herzlichen Blickkontakt mit Wilhelm Pieck als dem Präsidenten unseres neuen Staates. Wir sangen Lieder, riefen Sprechchöre für den Frieden und gegen die Bonner Separatisten, die Deutschland spalteten. Und ich sann während der ganzen Zeit so »nebenbei« – darüber nach, wie der Brief aus meiner Hand in die Hände eines der Menschen auf der Lkw Tribüne gelangen könnte. Wir hatten erfahren, dass Walter Ulbricht besondere Bemühungen um ein Gesetz zur Förderung der Jugend in Gang gebracht hatte. Wir wollten deshalb gerade ihm von unserem Tun und Lassen im kurzen Text einer brieflichen Information berichten. Ich ging auf einen der Wachleute am Lkw zu. Er holte einen von Walter Ulbrichts Mitarbeitern heran, und ich konnte ihm das, was wir in Neubrandenburg aufgeschrieben hatten, aushändigen – zur Weitergabe an WU. Wir berichteten zuerst, was wir in den seit Kriegsende vergangenen Jahren gemacht hatten. Vor allem ging es da um unsere Einsätze zur Enttrümmerung der Innenstadt von Neubrandenburg. Von der waren nur fünf Straßen unzerstört geblieben. Wir beluden Loren mit Steinen aus den Ruinen und sorgten für deren ordentlichen Transport zu Baustoff-Sammelstellen. Wir schilderten auch, wie wir von der Schule aus in Dörfer der Umgebung fuhren, um dort mit Liedern, Zitieren von Gedichten, kabarettistischen Versuchen und Diskussionen zu politischen Streitthemen wie zum Beispiel Oder-Neiße Friedensgrenze an der Meinungsbildung und Kulturentwicklung teilzunehmen. Natürlich kamen wir auch auf Fortschritte im schulischen Unterricht und auf erste Ansätze zu gründlicherer Beschäftigung mit Geschichte, darunter der Geschichte der Arbeiter- und der Jugendbewegung, zu sprechen. Zur ersten Begegnung mit Walter Ulbricht kam es dreieinhalb Jahre später. Ich hatte inzwischen die Schule beendet und in Leipzig ein Journalistikstudium aufgenommen. Am 15. Juni 1953 begann ich mein Redaktionspraktikum bei der Freiheit in Halle. Zwei Tage nach der Arbeitsaufnahme begannen die Unruhen in Betrieben und auf den Straßen. Viele Genossen übernahmen Aufgaben in bestreikten Betrieben. So auch ich. Mein »Arbeitsort« dieser Art waren die Halleschen Kleiderwerke. Mir als damals Neunzehnjährigem fiel es nicht leicht, den z. T. beträchtlich älteren Arbeiterinnen und Arbeitern zu erläutern, dass sie mit den Arbeitsniederlegungen gegen ihre eigenen Interessen handelten. In den Gesprächen über unser Alltagsleben ihres und auch meines – kamen wir uns allerdings näher. Am schwierigsten war es, den Widersinn der Absicht zu überwinden, erst dann mit dem Streiken aufzuhören, wenn aus dem Bunawerk die Bereitschaft zum Streikende verkündet werde. Dort war nach einem zunächst vereinbarten Ende des Streiks ein zweiter Streik gestartet worden. In der brenzligen Situation um Buna und das benachbarte Leuna-Werk entstanden unterschiedliche Vorstellungen für das Handeln. Einige neigten dazu, der massierten Auseinandersetzung aus dem Wege zu gehen. Es war von großer Bedeutung, dass Walter Ulbricht sich entschied, selber in die Leuna-Werke zu fahren und dort an der Klärung der Ursachen und am Finden von Auswegen teilzunehmen. Für seinen Beitrag zur Diskussion, seinen Anteil an der Zwiesprache zwischen Belegschaftsangehörigen und leitenden Genossen war zweierlei charakteristisch: 1. Kritische Betrachtung, ja Verurteilung mangelnder Beachtung von Arbeiterinteressen; 2. Ablehnung von Versuchen, die Auseinandersetzung mit falschen Methoden der Leitung von Arbeitsprozessen im Betrieb in eine Ablehnung der sozialistischen Staatlichkeit in der DDR münden zu lassen. Die Kombination dieser zwei Positionen half nun sehr bei der journalistischen Auswertung von Zusammenkünften dieser Art in der Zeitung: frei von Schönfärberei und Verharmlosung und frei von sektiererischer Zuspitzung und Verschärfung der Konflikte. Aus der Jugendarbeit in Leipzig 1963 eine Episode, die vielen in Erinnerung geblieben ist – wegen ihrer Eigenart: Eine Jugendkundgebung mit Walter Ulbricht in der Kongresshalle des Leipziger Zoos war angesagt. Jugendliche, die um Diskussionsbeiträge gebeten worden waren, lud ich ein, einige Stunden vor Beginn der Veranstaltung in die FDJ-Bezirksleitung zu mir zu kommen. Und da bat ich sie, ihre doch sicher mit FDJ- und Parteisekretären abgestimmten Texte nicht mit in die Kongresshalle zu nehmen. Ich gab einer jeden und einem jeden von ihnen Papier und Schreibgerät (sofern sie kein eigenes dabei hatten), ließ sie ungestört stichwortartige Notizen machen und sammelte die vorgefertigten »Ablese-Reden« ein. Gemeinsam mit Kurt Turba gelang es, Ulbricht für die Idee zu gewinnen, erst die Jugendlichen reden zu lassen, auf dass er zu dem von ihnen Gesagten Stellung nehmen konnte. Es wurde, wie man in den von der Jungen Welt dokumentierten Reden nachlesen kann, ein Abend geistiger Munterkeit junger Leute in der Politik, in welcher der Mann von der Spitze des Staates mit dem, was er zu sagen hatte, wacker mithalten konnte. Ulbricht war nicht zimperlich. Er drängte auf hohes Können im Beruf und auf Neugier in der Aneignung von Wissen über die gesellschaftliche Entwicklung, auf Aktivität im eigenen Wirken einer jeden und eines jeden für Fortschritt in dieser Entwicklung. Er polemisierte gegen die damals in Mode gekommene Neigung in der politischen Bildung, Werke von Klassikern der marxistischen Weltanalyse in »Proben« zu »studieren«, die in Sammelbänden auszugsweise geboten wurden. Er drängte darauf, solche Werke im Original und in Gänze zu lesen und zu diskutieren. Und was das berufliche Können anging, plädierte er dafür, nach höchster Qualität zu streben, auf dass die Formel von der deutschen Wertarbeit wieder volle Gültigkeit bekäme. Zur Freude der meisten im Saal gab er zu verstehen, dass er auf der Seite derer steht, die Musik und Tanz für eine Bereicherung kultureller Vielfalt halten statt sie mit verklemmter Strenge missgelaunt zu hören und die Tanzenden missmutig, ja misstrauisch zu beäugen. Politik ist die Kunst des Möglichen, soll Bismarck gesagt haben. Tatsächlich sind Äußerungen von ihm überliefert, die auf diese Aussage hinauslaufen. Bei Poschinger findet sich in den »Tischgesprächen« die auf den 11. August 1867 datierte Bemerkung: »Die Politik ist die Lehre vom Möglichen.« Und Mitte des Jahres 1897 formulierte Poschingers Tischgesprächspartner den Satz: »Politik ist weniger Wissenschaft als Kunst.« Ende der 60er Jahre des vorigen Jahrhunderts erwogen ein einflussreicher Physiker und ein nicht minder einflussreicher Politiker unseres Landes, der DDR, das geläufige Bismarck-Wort– ohne es mit Urheberangabe zu zitieren– infrage zu stellen. Angesichts der sich wandelnden Gefährdungen und Erfordernisse der Menschheitsentwicklung und im Interesse eines spürbaren Voranschreitens von Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur im eigenen Staat, hielten sie es für an der Zeit, das Politische in seiner Rolle im gesellschaftlichen Leben in veränderter Weise zu begreifen. Der Physiker Professor Dr. Max Steenbeck, damals Vorsitzender des Forschungsrats – sagte: »Die Politik ist heute nicht mehr die Kunst des Möglichen, sondern die Wissenschaft vom Notwendigen.« Der Politiker – Walter Ulbricht, damals Vorsitzender des Staatsrates – zitierte den Satz sympathisierend.[67] Offenbar nervte die beiden etwas, womit auf Gesellschaftsfortschritt erpichte Menschen sich häufig konfrontiert sehen. Im Verhältnis zu dem, was getan werden müsste, um Frieden zwischen den Völkern und Staaten, soziale Gerechtigkeit und ökologisch verantwortungsbewussten Umgang mit Naturressourcen zu sichern, ist die Bereitschaft, entsprechend zu handeln, zu gering. Es versteht sich, dass Steenbeck wie Ulbricht bewusst war: Das profitorientierte Wirtschaften in Ländern der Kapitalmacht, das Agieren der diese Macht stützenden Verbände, Parteien, Parlamente und Regierungen tragen die ursächliche Hauptverantwortung für die das jetzige und künftige Leben auf der Erde bedrohenden Versäumnisse. Sie erkannten aber auch, dass in den Ländern, die eigentlich angetreten waren, aus dem alten System auszubrechen, die bürokratischen Fesseln der Wirtschaftsabläufe und der Gesellschaftsentwicklung an den Versäumnissen beteiligt waren, und zwar nicht irgendwie, sondern ebenfalls ursächlich. Da herauszukommen, strebten sie an. In der praktischen Politik seit Beginn der 60er Jahre durch ein zentralistische Starre überwindendes neues ökonomisches System der Planung und Leitung. Diese Bemühungen wurden jedoch Ende des Jahrzehnts mehr und mehr gebremst. So kann man sich fragen: Handelte es sich bei Steenbecks und Ulbrichts in eben dieser Zeit gesprochenen Worten über die Wissenschaft vom Notwendigen um Gegenwehr gegen das Bremsen? War die Politologie-Meditation eine Art theoretischer Begleittext zu diesen Vorgängen? Die weiterreichenden Fragen lauten: Was konnte in der konkreten Situation und was könnte überhaupt mit der ins Auge gefassten Neubestimmung des Politikbegriffs erreicht werden? Der wissenschaftlichen Erforschung des Notwendigen als Politikbestandteil größere Aufmerksamkeit zu widmen, war ein vernünftiger Ansatz. Aber bei der Gelegenheit ausgerechnet den Bezug aufs Mögliche im Politikverständnis zu tilgen und auf Kunst als Element des Politikmachens verzichten zu wollen, ist in beiden Aspekten ein Irrtum. Denn: Musste und muss nicht gerade die dank wissenschaftlicher Erforschung erwerbbare gründlichere Kenntnis dessen, was notwendig ist, umso größeres Interesse für das Verhältnis von Notwendigem und Möglichem wecken, stärkere Anstrengungen für das Aufdecken realer Möglichkeiten auslösen und das vielgestaltige Ringen für deren Umwandlung in die Wirklichkeit geradezu beflügeln? Könnte es sein, dass Genosse Ulbricht, der Lenin noch persönlich kannte, angesichts des ihm imponierenden Satzes von Steenbeck Lenin einen Augenblick vergessen hat? In Lenins Buch über den linken Radikalismus findet sich eine Erläuterung, die er den britischen Genossen W. Gallacher aus Glasgow, den Ulbricht ebenfalls kannte, in Sachen Politik zu bedenken bat, nämlich: »dass Politik eine Wissenschaft und Kunst ist, die nicht vom Himmel fällt, die einem nicht in die Wiege gelegt wird, und dass das Proletariat, wenn es die Bourgeoisie besiegen will, seine eigenen, proletarischen ›Klassenpolitiker‹ hervorbringen muss, und zwar Politiker, die nicht schlechter sein dürfen als die bürgerlichen Politiker.«[68] Nicht schlechter? Also besser, sagen wir uns da. Schöpferischer Einfallsreichtum gehört dazu, Fantasie für Varianten und Alternativen, spontanes Reaktionsvermögen im Umgang mit Gegebenheiten und Gelegenheiten, Gespür für Stimmungen und Kräfteverhältnisse, einleuchtende Überzeugungskraft, in der nicht zuletzt Sinn für Nuancen zum Zuge kommt, Nuancen in Mentalitäten und Charakteren, Nuancen in Farben, Worten, Tönen und Tonlagen – ein hoher Anteil des Informationsgehalts einer Aussage liegt bekanntlich in der Intonation des Gesagten bzw. zu Sagenden. Vertraute und Verbündete zu gewinnen und mit ihnen etwas als notwendig Erkanntes in Bewegung zu bringen, kann so gut gelingen. Über die zwischen künstlerischem Wirken und politischem Handeln bestehenden Unterschiede, die mit Sorgfalt zu beachten sind, sollten Sozialistinnen und Sozialisten die Ähnlichkeiten der Arbeit in der Politik und in der Kunst nicht gering veranschlagen, sondern als produktive Wechselbeziehung gestalten. Tiefe demokratische und sozialistische Überzeugungen sowie Mut und Beherztheit, sie zu vertreten, sie selber zu leben, kennzeichnen die Frauen und Männer, die im Interesse eines sozial gerechten freien Daseins ihrer Mitmenschen handeln. Politiker des Typs Kapitalmachtsdiener erkennt man daran, dass sie ihre Kunst im Rangeln um Machterwerb, Machterhaltung und Ausschalten politischer Konkurrenten austoben und erschöpfen. Politiker des Typs Volkes Diener charakterisiert demokratische Haltung. Zu deren Bestimmung hat Uwe-Jens Heuer in seinem 1989 erschienenen Demokratiebuch (»Marxismus und Demokratie«) Gültiges formuliert, das er am Schluss seines jüngst erschienenen Glaubensbuchs (»Marxismus und Glauben«) im Selbstzitat wiedergibt. Diese drei Sätze betrachte ich als ein VADEMECUM LINKER POLITIKER. Sie lauten: »Demokratische Haltung fordert Risikobereitschaft, fordert Verantwortung zu übernehmen, nicht für die Taten anderer, sondern für eigene Taten, fordert Einsicht in Mögliches und Nichtmögliches, fordert Lernbereitschaft und Toleranz, das Ertragen von Widersprüchen und Konflikten. Ein Demokrat muss den Mut zur eigenen Meinung haben und die Bereitschaft, die Meinung anderer zu hören und zu durchdenken, zu respektieren, aber auch zu bekämpfen. Er muss den Willen der Mehrheit achten, aber ihm auch widersprechen, wenn er den Interessen der Mehrheit oder auch zu respektierenden Interessen einer Minderheit widerspricht.«
Siegfried Lorenz: Freund der Jugend und des Sports
Siegfried Lorenz, Jahrgang 1930, Volksschule, Mechanikerlehre, Arbeiter- und Bauernfakultät (ABF), Studium an der Karl-Marx-Universität Leipzig, Diplomgesellschaftswissenschaftler, 1945 SPD, 1946 SED, Abteilungsleiter im Zentralrat der FDJ, 1961 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung Berlin, von1963 bis 1990 Mitglied der Volkskammer der DDR, von 1966 bis 1976 Vorsitzender des Jugendausschusses der Volkskammer. Von 1966 bis 1976 Leiter der Abteilung Jugend im ZK der SED, seit 1967 Kandidat und seit 1971 Mitglied des ZK der SED, 1. Sekretär der SED Bezirksleitung Karl-Marx-Stadt von 1976 bis 1989. 1985 Kandidat und von 1986 bis Dezember 1989 Mitglied des Politbüros des ZK der SED. Als ABF-Student hast du im November 1950 an einer Zentralen Konferenz der FDJ teilgenommen, auf der Walter Ulbricht die Jugend aufforderte, einen »Feldzug zur Eroberung von Wissenschaft und Kultur« zu führen. Erinnerst du dich? Es war meine erste Begegnung mit Walter Ulbricht. Ich saß im Präsidium, konnte ihm von dort ins Redemanuskript schauen und verfolgte auch, wie er sich zu jedem Diskussionsbeitrag Notizen machte. Seit der Gründung der DDR war erst ein gutes Jahr vergangen. Die Volkskammer hatte auf seine Initiative hin das »Gesetz über die Teilnahme der Jugend am Aufbau der Deutschen Demokratischen Republik und die Förderung der Jugend in Schule und Beruf, bei Sport und Erholung« beschlossen. Die politische Mitbestimmung der Jugend stand in der Aufmerksamkeit des neuen Staates ganz oben. Zum ersten Mal in Deutschland durften junge Leute mit 18 Jahren wählen. Kritiker meinten, die Jugend sei noch nicht reif dafür. Ulbricht hielt dagegen: Wer mit 18 in den Krieg gezwungen wird, hat auch das Recht, seine Zukunft im Frieden zu wählen. Verwirklicht waren schon das Recht auf Arbeit und Bildung. Jugendarbeitslosigkeit gehörte der Vergangenheit an. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit war für Jugendliche kein Fremdwort mehr. Für mich war auch bedeutsam, dass die Arbeiter- und Bauernfakultäten uns den Weg zu den Universitäten öffneten. Im besten Sinne des Wortes gab es eine großartige Aufbruchstimmung. Unter diesen Gegebenheiten machte Ulbrichts Rede auf mich einen prägenden Eindruck. Anschaulich formulierte er, dass derjenige, der den Weg nach vorn nicht kenne, einem Blinden gleiche, der mühsam mit dem Stock seinen Weg suche. Wichtig war ihm die Einheit von fachlicher und politischer Ausbildung. Und er wetterte gegen jede »Ablenkung vom Studium«. So kritisierte er die häufigen Arbeits- und Agitationseinsätze, bei denen auf Studenten zurückgegriffen wurde und die wir – offen gestanden – mitunter begeistert absolvierten. Er forderte: Keiner habe das Recht, Studenten von Vorlesungen und Seminaren für andere Zwecke abzuberufen. Die Hauptaufgabe, besonders der Kinder von Arbeiter und Bauern, an den Universitäten und Hochschulen sei: Lernen, lernen und nochmals lernen! Das hatte ich nach Ulbrichts Rede verinnerlicht. Mich hat damals erstaunt, was er zum Verhältnis der Studenten zu den bürgerlichen Wissenschaftlern gesagt hat. Manchen Zuhörern, die ein wenig sektiererisch veranlagt waren, hat das gar nicht gefallen. Wie hast du dies aufgenommen? Auch ich habe als 20-Jähriger diese Passagen zwiespältig aufgenommen. Zwar hatten wir an der ABF erfahrene Dozenten, Studienräte der alten Schule mit humanistischer Gesinnung und hohen Fachkenntnissen. Wir verdanken ihnen sehr viel. Durch sie fand ich beispielsweise den Zugang zur klassischen deutschen Literatur und drang mit ihrer Hilfe in die Geheimnisse der Naturwissenschaften ein. Sie schätzten ihrerseits unseren Wissensdrang. Auf der anderen Seite waren uns abfällige Äußerungen von Professoren und Dozenten nicht verborgen geblieben, die das »Eindringen« von uns in ihre akademischen Gefilde keineswegs guthießen. Nach ihrem Verständnis gehörten wir dort nicht hin. Wir begegneten den alten akademischen Gepflogenheiten und Traditionen, die wir zumeist gar nicht so gut fanden und gern durch »proletarische Traditionen« ersetzt hätten, mit gleicher Ablehnung. Doch Ulbricht bremste uns merklich und verlangte von uns, den Professoren und Dozenten, die nicht unsere Weltanschauung teilten, dennoch die notwendige Achtung entgegenzubringen. Trotz ihrer Vorbehalte gegenüber unserer Politik würde die DDR alles tun, auch ihre materiellen Lebensverhältnisse zu verbessern. Selbst wenn heute noch mancher von ihnen bösartige Bemerkungen über uns und über die DDR machte, würden sie in einigen Jahren davon überzeugt sein, dass unser Weg richtig sei. Ulbricht war sichtlich von Optimismus erfüllt. Ich gestehe, dass ich damals das Grundsätzliche beim Umgang mit den bürgerlichen Wissenschaftlern nicht im vollen Umfang erfasst habe. Seit 1954 warst du FDJ-Funktionär in Berlin. Es gab die in der ganzen Republik bekannten Jugendforen »Auf jede Frage eine Antwort« und andere interessante Veranstaltungen. Ulbricht nahm an vielen davon teil. Und er war sportbegeistert. Du hast, wenn ich mich recht erinnere, auch gegen ihn Volleyball gespielt. Wie war er als Sportler? Aktiv und fair. Seine Wurzeln hatte er bekanntlich in der Arbeitersportbewegung. In Berlin entstand zu meiner Zeit der »Treffpunkt Olympia«. Hier trafen Spitzenathleten der DDR mit Jugendlichen zusammen und trieben gemeinsam Sport. An einem dieser Treffen nahmen Walter Ulbricht und Alfred Neumann teil. Beide redeten nicht nur über die Bedeutung des Sports, sondern machten kräftig mit. Alfred Neumann wetteiferte mit dem DDR Meister im Kugelstoßen und schmetterte die Kugel über die für uns damals unerreichbare Weite von über 14 Metern. Walter Ulbricht trat zum Volleyballspiel an. Seine Aufforderung »Jeder Mann an jedem Ort: einmal in der Woche Sport« hat er anlässlich dieses Treffens nicht nur verkündet, sondern auch selbst beherzigt. Im Winter habe ich Walter Ulbricht in Pankow auf der Eisbahn erlebt, wie er gemeinsam mit seiner Frau Lotte seine Runden drehte. In Oberwiesenthal traf ich ihn, als er den großen Hang am Fichtelberg mit Skiern hinabkurvte. Ich weiß, dass er mit dem DDR-Meister im alpinen Skisport, Eberhard »Ebs« Riedel, das Wedeln übte. Ganz ohne Zweifel war für Walter Ulbricht das Sporttreiben von Jugend an ein Bedürfnis. Und wie war das mit den Jugendforen? Walter Ulbricht hatte einen ausgesprochenen Sinn für neue interessante Formen der Jugendarbeit. Er ermunterte uns entsprechend. Allerdings achtete er auch darauf, dass alles in die »richtige Richtung« lief. Als ich auf einer Konferenz der SED über neue Formen der Jugendarbeit sprach, handelte ich mir von ihm einen Zwischenruf ein. Er meinte, neu seien einige unserer Initiativen schon, aber ob sie auch »richtig« seien, bezweifle er. Dazu gehörten auch die Jugendforen, die nicht seinen uneingeschränkten Beifall fanden. Jugendliche standen Schlange, um in den Saal zu kommen, der Zuspruch war riesig. Freilich lebten die Veranstaltungen von solchen Persönlichkeiten wie Gerhart Eisler, der an allen Foren teilnahm und mit Humor und Schlagfertigkeit keine Antwort schuldig blieb. Er wusste selbst Provokationen geschickt zu parieren. Das kam immer gut an. Walter Ulbricht meinte jedoch, dass niemand auf jede Frage eine Antwort haben könne. Man müsse Fachleute gewinnen, die auf thematischen Foren konkrete Antworten auf konkrete Fragen geben würden. Das musste zwangsläufig zu einer inhaltlichen Einengung führen. Und noch ein Faktum veranlasste ihn zur Kritik. Die Grenze in Berlin war offen. So kamen denn auch Besucher aus Westberlin und versuchten die Foren zu stören, indem sie provozierende Fragen stellten und uns Diskussionen aufzwangen, die wir nicht brauchten. Das sollte sich die FDJ nicht gefallen lassen, meinte er. Irgendwann wurden diese zentralen Jugendforen durch thematische ersetzt, was nicht nur ich bedauerte. 1961 waren wir beide 1. Bezirkssekretäre der FDJ, du in Berlin und ich in Rostock. Anfang Juli rief mich Horst Schumann an. Der 1. Sekretär des FDJ-Zentralrats beauftragte mich, dich auf einem Campingplatz im Bezirk Rostock aufzuspüren, wo du mit deiner Familie im Urlaub warst. Du solltest sofort nach Berlin zurückkommen, weil am 14. August 1961 eine Kundgebung mit Walter Ulbricht stattfinden sollte. Wie war das damals? Dass am 14. August 1961 eine Kundgebung auf dem Potsdamer Platz stattfinden sollte, war im Politbüro des ZK der SED beschlossen worden. Dieser Beschluss hat uns mehr als überrascht. Im Sommer 1961 spitzten sich die Ereignisse in und um Berlin zu. Unzufrieden mit der Situation in der DDR und den Verheißungen des Westens folgend, verließen zahlreiche Bürger die DDR. In Berlin hatten wir es mit dem sogenannten Grenzgängerproblem zu tun, d. h. in Westberlin gingen manche Berliner zur Arbeit und im Ostteil der Stadt wohnten sie und profitieren vom Schwindelkurs. Ein Ärgernis, das so manchen Hauptstädter auf die Palme brachte. In dieser Situation fasste man also den Beschluss, eine Jugendkundgebung mit Walter Ulbricht aus Anlass des 90. Geburtstages von Karl Liebknecht abzuhalten. Auf dem Potsdamer Platz hatte Liebknecht 1916 seine bekannte Antikriegsrede gehalten, nach der er inhaftiert und als Vaterlandsverräter verurteilt wurde. Die geplante Veranstaltung beendete nicht nur meinen Urlaub, sondern bescherte mir auch schlaflose Nächte. Der Ort unmittelbar an der Sektorengrenze schien mir nämlich nicht gerade für Kundgebungen geeignet. Wegen der Maßnahmen am 13. August 1961 fiel die geplante Veranstaltung ins Wasser. Im Politbüro-Protokoll aus diesen Tagen heißt es lapidar: »Der Beschluss über die Durchführung einer Jugendkundgebung in Berlin wird aufgehoben.« Später vermuteten wir, dass das Ganze ein Ablenkungsmanöver war. Heute wissen wir, dass die Grenzsicherungsmaßnahmen am 13. August 1961 zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Jugendkundgebung weder Walter Ulbricht noch irgendwem sonst in der Parteiführung bekannt gewesen sein konnten. Die Entscheidung darüber fiel in Moskau in der ersten Augustwoche. In Vorbereitung des VI. Parteitages 1963 hatte Walter Ulbricht sechs FDJ Funktionäre zu sich eingeladen. Er leitete das Treffen mit den Worten ein, er sei ein alter Mann, solle aber auf dem Parteitag auch zur Jugend sprechen. Deshalb wolle er genau wissen, was die Jugend denke und was sie vom Parteitag erwarte. Du und ich waren damals dabei. Zeitzeugen sagen, dass solche Runden zum Arbeitsstil Ulbrichts gehörten. Kannst du das bestätigen? Dieser Arbeitsstil imponierte mir. Seine häufig benutzte Wendung »Sprechen wir ganz offen darüber« machte von vornherein klar, dass es ihm nicht um schöngefärbte Berichte, sondern um Probleme und brauchbare Vorschläge ging. Auch eine Beratung im Sommer 1963 zur Vorbereitung des Jugendkommuniqués verlief nicht anders. Zugegen waren weitere Politbüromitglieder, Minister, Wissenschaftler, Betriebsleiter, Journalisten und wir FDJ-Funktionäre. Ohne Umschweife kam Walter Ulbricht zur Sache und stellte fest, dass die Umstellung der Jugendarbeit nicht zügig genug vorankomme und die Hauptprobleme nicht genügend erörtert würden. In der darauffolgenden Debatte kamen die verschiedenen Sichten zu Problemen der Jugend zur Sprache, die teilweise konträr waren. Ulbricht, der sich auf Zwischenfragen beschränkte, teilte schließlich mit, dass sich das Politbüro erneut mit Jugendfragen beschäftigen werde. Es sei ein Jugendkommuniqué geplant, die Jugendkommission werde direkt dem Politbüro und ihm persönlich unterstellt. Unter Federführung von Kurt Turba, dem Chefredakteur der Studentenzeitung forum, solle eine Arbeitsgruppe einen Entwurf formulieren, der dem Politbüro vorgelegt werden solle. Es fiel auf, dass sich Ulbricht nicht wie das oft üblich war – vorwiegend auf den Parteiapparat stützte, sondern auf Journalisten, vor allem der Jugendpresse, auf Leute aus der Praxis und auf ausgewählte Jugendfunktionäre wie etwa Horst Schumann und auch mich. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung über die weitreichenden Absichten und Vorstellungen von Walter Ulbricht. Sie hingen mit der Ausarbeitung und Einführung des Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung zusammen. Die Jugend hielt er für besonders aufgeschlossen, dieses Reformkonzept zu verwirklichen. Es bedurfte dafür aber eines neuen Stils in der Jugendarbeit, eines höheren geistigen Niveaus, des Erwerbs der erforderlichen Fachkenntnisse und anwendbaren Wissens, Erfindergeistes, der Überwindung von Dogmatismus und Formalismus. Und natürlich einer festen Verbundenheit der gesamten Jugend zum sozialistischen Vaterland und seiner Perspektive. Von Kurt Turba, den ich aus gemeinsamer Arbeit im FDJ-Zentralrat gut kannte, weiß ich, dass er bei der Ausarbeitung des Entwurfs großen Rückhalt bei Walter Ulbricht hatte, in engem Kontakt mit ihm stand und von ihm ermuntert wurde. So entstand das Jugendkommuniqué, das sich von bisherigen Beschlüssen zur Jugend in Sprache und Stil deutlich unterschied und sich direkt an die Jugend wandte. Du hast 1963 auf der Kundgebung der Berliner Jugend im Zentralen Klub der Jugend und Sportler in der Sporthalle an der Karl-Marx-Allee die Eröffnungsrede gehalten, auf der Walter Ulbricht das Jugendkommuniqué begründete. Ja, dort herrschte eine tolle Stimmung. Mehrere Tausend Jugendliche drängten in die Halle, und Walter Ulbricht begann seine Rede mit der Frage, ob die Jugendlichen das Jugendkommuniqué wie er prima fänden. Das Echo war ein begeistertes »Ja«. Er bezeichnete das Dokument in seiner Rede als klar und zielbewusst. Die Partei kenne die Probleme der Jugend und würde sie anpacken. Er betonte mehrfach, die Jugend müsse selbständig denken und schöpferisch arbeiten lernen und sich den sozialistischen Standpunkt selbst aneignen, denn ihr, so zitierte er das Kommuniqué, »werdet in den letzten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts die Herren im Hause sein«. Zugleich verband er das immer mit der Verantwortung, die die Jugend heute übernehmen müsse. Bezugnehmend auf das in Vorbereitung befindliche Neue Ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft forderte er dazu auf, die »objektiven Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung« kennenzulernen, sie auszunutzen und anzuwenden. Wiederholt berief sich Ulbricht auf Beispiele, wie junge Leute ums »Weltniveau« kämpften und technische Neuerungen hervorbrachten, wie sie als »Kapitäne« große Wirtschaftseinheiten erfolgreich führten und in Jugendbrigaden an der Spitze im Wettbewerb stünden. Zugleich enthielt seine Rede viele kritische Töne. So polemisierte er gegen »Reste des Dogmatismus« und »seelenloses Administrieren«. Das müsse überwunden werden. Wiederholt wich er vom vorbereiteten Konzept ab, um auf Fragen zu antworten. So wurde die Rede länger und länger. Für eine Kundgebung zu lang. Am Schluss seiner Ausführungen horchten jedoch noch einmal alle auf, als sich der schon 70-jährige Ulbricht mit der merkwürdigen Bezeichnung bestimmter junger Leute als »Halbstarke« auseinandersetzte. Berliner sagten über solche Jugendliche schnoddrig: »aufn Putz hau’n und nischt in der Birne«. Doch es steckte mehr dahinter. So wurden oftmals Jugendliche abwertend benannt, die in ihrer Lebensweise von der Norm abwichen, sich aufmüpfig und rebellisch verhielten und mit denen es Schwierigkeiten gab. Dahinter verbarg sich eine Facette des Generationenkonflikts. Durch ihre Abstemplung wurde der Zugang zu diesen Jugendlichen erschwert, mitunter verbaut. Ulbricht meinte dazu: »Wir kennen dieses Wort nicht, wir kennen keine Jugendlichen dieses Charakters, wir kennen nur Jugendliche und die Pflicht …, ihnen zu helfen, sich zu entwickeln und vorwärtszukommen.« Das sei die Hauptsache. Einige Zeithistoriker und Zeitzeugen sind heute der Meinung, Ulbricht wäre mit seinen Ideen zur Jugendpolitik auf Widerstand im Politbüro gestoßen. Sie suggerieren, dass eine Fraktion im Politbüro den Geist des Jugendkommuniqués verwässert habe, und sehen einen Zusammenhang zwischen dem Scheitern des Neuen Ökonomischen Systems und der Jugendpolitik. Ist diese Wahrnehmung begründet oder ist sie nicht vielmehr eine nachträgliche Deutung? Solange ich mit der Jugendpolitik befasst war, kenne ich unterschiedliche Meinungen und Vorstellungen darüber, wie junge Menschen am besten zu erreichen seien. Diese Meinungsverschiedenheiten gab es auch zwischen führenden Leuten, deren Biografien mitunter sehr unterschiedliche Erfahrungen und daraus resultierende Schlussfolgerungen aufweisen. Fraktionstätigkeit kann ich darin nicht erkennen, im Übrigen wurde Fraktionstätigkeit in der SED laut Statut mit Ausschluss bestraft. Bei Kurswechseln in der Politik und neuen Herausforderungen kam die Jugendpolitik immer mit ins Spiel, und wir erlebten so manche Wende. Zum damaligen Zeitpunkt, das weiß ich, gab es nicht wenige Stimmen, die beispielsweise die Rolle der FDJ im Jugendkommuniqué als unterbelichtet bezeichneten, woraus später sogar eine Herabminderung der FDJ wurde. In der m. E. richtigen Auffassung, dass Jugendliche nicht nach Äußerlichkeiten Kleidung, Mode, Tänzen oder Frisuren zu beurteilen seien, witterten manche die Gefahr, dass dadurch der »westlichen Unkultur und Dekadenz« Tür und Tor geöffnet würden. Das Thema Jugend und Musik blieb ein Dauerbrenner im Widerstreit. Von der »Beatwelle«, die in den 60er Jahren aus dem Äther über uns kam und bei Jugendlichen großen Anklang fand, hielt Ulbricht zunächst nichts; diese Musik (»die Monotonie des yeah, yeah, yeah«) war ihm suspekt. Dennoch meinte auch er, »der Takt, nach dem die Jugend tanzt, sei ihre Sache, die Hauptsache: sie bleibt taktvoll«. Allerdings kam die Losung »Die Jugend – Hausherr von Morgen« unter den Hammer, weil sie übertrieben sei und die Jugend überheblich mache, möglicherweise einen »Generationskonflikt« provoziere und »die führende Kraft der Arbeiterklasse und ihrer Partei« infrage stelle. Ungeachtet dessen löste das Kommuniqué unter der Jugend einen Aufschwung aus wie lange nicht. Unzählige Treffen von Jugendlichen mit Werkleitern, Ministern, Künstlern und Wissenschaftlern bereicherten das geistige Leben. Neue und vielfältige Formen der Freizeitgestaltung, die den Bedürfnissen Jugendlicher entsprachen, fanden beachtlichen Zulauf. Das Deutschlandtreffen 1964 zeigte eine politisch engagierte, selbstbewusste Jugend, die auch in kultureller und sportlicher Hinsicht bewies, was sie draufhatte. Der Jugendsender DT 64 ging damals auf Sendung und entwickelte sich zum beliebten und meistgehörten Sender der DDR. Diese Entwicklung hat meines Wissens das Politbüro einmütig sehr positiv bewertet. Spätere Auseinandersetzungen zur Jugendpolitik wie auf dem 11. Plenum des ZK Ende 1965 habe ich nach meinem Ausscheiden als 1. Sekretär der FDJ in Berlin Mitte 1965 nicht mehr unmittelbar erlebt. Im Frühjahr 1966 entstand eine Kommission unter Leitung von Horst Sindermann und Kurt Hager, in die ich ebenfalls berufen wurde. Sie hatte einen Politbürobeschluss zu jugendpolitischen Fragen vorzubereiten. Er wandte sich wie eh und je in erster Linie an die Leitungen der Partei, des Staates und der Wirtschaft, der FDJ und weiterer gesellschaftlicher Organisationen. Ohne das Jugendkommuniqué kritisch zu erwähnen oder außer Kraft zu setzen, betonte der Beschluss die »klassenmäßige Erziehung der Jugend« und die Rolle der FDJ als »Helfer und Reserve der Partei«. Der Grundsatz »Der Jugend Vertrauen und Verantwortung« aber blieb unangetastet und galt unverändert. Er wurde sogar weitaus detaillierter und konkreter ausgeführt als in früheren Beschlüssen. Unter Vorsitz von Walter Ulbricht stimmte das Politbüro dem Beschluss ohne Widerspruch einstimmig zu. 1970 besuchte eine Delegation der Jungsozialisten in der SPD unter Leitung von Karsten D. Voigt, dem späteren Außenpolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, die FDJ. Die Abordnung der Jusos wurde von Walter Ulbricht empfangen. Du warst dabei. Karsten Voigt, mit dem ich mich kürzlich über dieses Ereignis ausgetauscht habe, nahm an diesem Treffen teil, obwohl es aus dem Parteivorstand der SPD erhebliche Widerstände gab. Warum empfing Ulbricht die Delegation? Meines Wissens war das die erste Delegation der Jungsozialisten, die in die DDR kam. Ein solcher Schritt war damals noch mutig. Beziehungen zur DDR wurden seit 1949 kriminalisiert. Lehrern und anderen Beamten drohte Berufsverbot, wenn sie in die DDR reisten. Walter Ulbricht hatte vom bevorstehenden Besuch in der Zeitung gelesen und mich daraufhin über die interne Telefonleitung des ZK angerufen. »Was meinst du«, fragte er, »wenn ich die Delegation empfinge?« Einen Moment war ich sprachlos. Weder die FDJ noch die Abteilung Jugend im ZK hatten auch nur daran gedacht, ein Treffen mit dem Staats- und Parteichef zu arrangieren. Ulbricht half mir über meine Verblüffung hinweg. Man müsse alle Kräfte in der BRD, die für Entspannung eintreten, unterstützen, erklärte er. Die DDR müsse Strauß und von Thadden bekämpfen und Brandts Ostpolitik fördern. Man müsse die westdeutsche Bevölkerung für eine gemeinsame Politik des demokratischen Fortschritts gewinnen. Das wolle er mit den Jungsozialisten besprechen, denn die seien sehr aktiv. Ich unterstützte seine Überlegung. Allerdings schlug er vor, die Begegnung weder im Staatsrat noch im Zentralkomitee zu organisieren, sondern sie im Gästehaus an der Spree stattfinden lassen. Wir sollten die Jusos nicht mit einer Einladung in das Haus des ZK in politische Schwierigkeiten bringen. Karsten Voigt bekam dennoch Probleme mit seinen Genossen. Der Parteivorstand der SPD und auch Vertreter des Bundesvorstandes der Jungsozialisten übten ungewöhnlichen Druck auf ihn aus, die Einladung Ulbrichts auszuschlagen. Als alle Argumente nicht fruchteten, meinte man in der Bonner Baracke,[Anmerkung 41] die Delegation könne nicht zu Ulbricht gehen, weil das Treffen am 17. Juni stattfinden solle. Voigt hatte jedoch Mut und setzte sich darüber hinweg. Er war der Meinung, wenn man die neue Ostpolitik der SPD wolle, dann dürfe man die Einladung des Staatsoberhaupts der DDR nicht ausschlagen. Bevor das Treffen jedoch begann, gab es auf unserer Seite noch eine Panne. Günther Jahn, der 1. Sekretär der FDJ, begrüßte Walter Ulbricht am Eingang und fuhr mit ihm im Fahrstuhl. Der blieb stecken. Ulbricht nahm es gelassen, wie Günther später erzählte, und unterhielt sich mit ihm über Mikroelektronik. Das Treffen nach ihrer Befreiung dauerte etwas mehr als zwei Stunden. Meine Eindrücke waren natürlich andere als die von Karsten Voigt. Ulbricht nahm ernst, was in der Verfassung von 1968 verankert war: Die DDR ist der sozialistische Staat deutscher Nation. Für ihn war die nationale Frage nicht abgeschlossen. Er warb für die Politik der DDR auch bei Sozialdemokraten. Er hatte über die Absichten der SPD mit der neuen Ostpolitik keine Illusionen. Ihm war aber alles wichtig, was dem Frieden diente. Das war eine Lehre aus dem Leben des 77-Jährigen. Du hast den Übergang von Ulbricht zu Honecker unmittelbar erlebt. Heutzutage deuten manche, auch einige Autoren in diesem Buch, dies als eine Intrige einer Gruppe um Erich Honecker. Kann man sich die Sache wirklich so einfach machen? Für mich kam dieser Übergang nicht überraschend. Ende der 60er Jahre mehrten sich zusehends die Probleme und Schwierigkeiten bei der wirtschaftlichen Entwicklung der DDR. Auf der 14. ZK-Tagung im Dezember 1970 ergab die Analyse, dass es in der Volkswirtschaft zu Disproportionen gekommen sei und mit Abschluss des Fünfjahrplanes erhebliche Rückstände und Schwierigkeiten in der Versorgung mit Rohstoffen und anderen Materialien aufgetreten waren. Zugleich mehrte sich die Kritik aus der Bevölkerung an der Versorgung und im sozialen Bereich. Diese Erscheinungen wurzelten in der Tatsache, dass die Wirkung ökonomischer Gesetze des Sozialismus unterschätzt oder falsch beurteilt worden war. Öffentlich unausgesprochen blieb, dass bestimmte kühne Zielstellungen von Walter Ulbricht an der Realität gescheitert waren, dass das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft, welches eindeutig die Handschrift von Walter Ulbricht trug, nach sowjetischen Interventionen abgebrochen wurde und dass die deutschlandpolitische Konzeption Ulbrichts nicht mehr die Unterstützung der sowjetischen Führung hatte. Es handelte sich also um mehr als lediglich um eine Intrige einer Gruppe. Es ging um neue Herausforderungen, um die Lösung zahlreicher komplizierter Entwicklungsprobleme und um eine Kurskorrektur, die viel Kraft erforderten und für einen 78-Jährigen eine sehr hohe Hürde darstellten. Die von Ulbricht im ZK vorgetragene Bitte, ihn von seinen Ämtern zu entbinden und die Verantwortung in jüngere Hände zu legen, habe ich deshalb vollauf unterstützt; wie ich überhaupt dem Verbleib in Funktionen bis ins höchste Alter kritisch gegenüberstand. Ich fand den Wechsel notwendig, folgerichtig und rechtzeitig. Wie das im Einzelnen vor sich ging, steht auf einem anderen Blatt. Da habe ich durchaus meine kritischen Anmerkungen. Eine Frage, die ich allen Gesprächspartnern stelle: Wenn du zurückblickst und Walter Ulbricht in die an Konflikten reiche Geschichte des 20. Jahrhunderts stellst: Was möchtest du an ihm hervorheben? Walter Ulbricht und sein Lebenswerk waren nicht vor Irrtümern, Fehlern und schweren Niederlagen gefeit. Dennoch stimme ich mit dem Nachruf aus dem Jahre 1973 überein, in dem es hieß: »Walter Ulbricht ging den Weg eines kämpferischen Kommunisten, der mit all seinen Fähigkeiten und Kräften der Arbeiterklasse und dem werktätigen Volk diente. Sein kampferfülltes Leben war Treue zum Marxismus-Leninismus, war aufopferungsvolle Arbeit für unseren sozialistischen Staat.« Für mich bleibt er der »Freund der Jugend und des Sports«.
Klaus Eichler: »Die Stunde der jungen Ingenieure und Facharbeiter ist gekommen«
Klaus Eichler, Jahrgang 1939, geboren und aufgewachsen in Halle, Chemiefacharbeiter, FDJ 1954, SED 1962, 1. Sekretär der FDJ-Kreisleitung der Leuna-Werke »Walter Ulbricht« (1962-1964). Fernstudium zum Chemieingenieur und Besuch der Parteihochschule »Karl Marx«. Von 1965 bis 1974 1. Sekretär der FDJ Bezirksleitung Frankfurt/Oder, danach (bis 1984) Generaldirektor des FDJ Reisebüros »Jugendtourist« und Fernstudium an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften. Seit 1984 Vizepräsident des DTSB, 1988 in der Nachfolge Manfred Ewalds Präsident. Im Februar 1990 Gründung des Unternehmens Touristik und Kontakt International GmbH (tuk), das er viele Jahre als Geschäftsführer leitete. Das Frühjahr 1963 hatte es in sich. Der lange und harte Winter bis in den April wurde zur großen Herausforderung für die nahezu 30.000 Werktätigen der Leuna-Werke »Walter Ulbricht«. Extreme Minusgrade ließen die Kohle in den Waggons festsitzen, die Saale vereiste. Das Riesenwerk mit seinen hunderten Kilometern Rohrleitungen das sowjetische Erdöl kam noch in Kesselwagen – konnte trotz aller Anstrengungen den Plan im ersten Quartal nicht erfüllen. Für die Volkswirtschaft der DDR ein herber Schlag. Kraftstoffe, Düngemittel, Leime, Kunstharze, Katalysatoren, Caprolaktam für die Herstellung von Kunstfasern, Arzneimittel … sämtlich unverzichtbar. Noch härter traf es die Baustelle Leuna II, ein künftiges petrolchemisches Zentrum der DDR. Mit der Fertigstellung wurde eine sechsmal höhere Arbeitsproduktivität als in den Leuna Werken und mit den Produkten der Anschluss an das Weltniveau erwartet. Die Rückstände waren erheblich, bei der Montage der Bühnen für die Aufnahme der Anlage zur Benzinspaltung sechs Wochen Verzug. Dabei begann das Jahr so erfolgverheißend. Nach intensiver Vorbereitung, der Beratung des Programmentwurfs mit großen Teilen der Bevölkerung, hatte der VI. Parteitag der SED weitreichende Beschlüsse zur gesellschaftlichen und ökonomischen Perspektive der DDR gefasst. Das Programm des Sozialismus fand bei den Werktätigen, besonders bei den rund 8.000 jungen Facharbeitern und Ingenieuren, starkes Interesse und Zustimmung. Verständlicherweise war die hervorgehobene Bedeutung der chemischen Industrie und die bestimmende Entwicklung der Petrolchemie eine begeisternde Perspektive, die unsere Arbeit prägte. Darüber hinaus war es auch nach den Jahren der furchtbaren Erlebnisse des Krieges und der Not die Sehnsucht nach einem Leben in Frieden und sozialer Sicherheit, frei von Furcht vor dem morgigen Tag, nach sinnerfüllter Arbeit und Lebensfreude. Mitten in der Diskussion, wie man mit dem eigenen Anspruch und der fatalen Lage übereinkommen kann und in kürzester Zeit der Terminverzug aufzuholen war, kündigte sich Besuch an: Walter Ulbricht will am 18. April kommen! Der größte Industriebetrieb der DDR besaß naturgemäß die höchste Aufmerksamkeit der politischen Führung des Landes. Deshalb kam Ulbricht regelmäßig vorbei, dies war sein fünfzehnter Besuch in Leuna. Allerdings war der neue Werkdirektor, ein Mittdreißiger, so aufgeregt wie ich, der mit der FDJ auf der »Großbaustelle der Jugend Leuna II« in besonderer Verantwortung stand. Die Arbeiter begrüßten Walter Ulbricht stimmungsvoll, und ihm war die Freude anzusehen, wieder einmal »vor Ort« zu sein. Ohne Pause oder überflüssige Rituale ging es zur Sache. Mich verblüffte, wie er sich unterhielt und zuhörte. Es schien nur so, als folgte er den Auskünften der Leiter aus Höflichkeit, doch seine Fragen zeigten, dass er alles sehr genau im Kopf verarbeitete. »Halten die technischen Kennziffern der neuen Anlagen dem Vergleich zu den Daten der modernsten Betriebe in der Welt stand?« Das konnte pariert werden. Dann haperte es schon. »Wie ist es mit der Kennziffer Arbeitsproduktivität?« Die darauf folgende Diskussion war spannend, ein Streit um die besten Lösungen. Beim anschließenden Rundgang auf der Baustelle gab es eine interessante Begegnung mit Bauleiter Frank Schliephake. Der 24-jährige Diplomingenieur stellte Walter Ulbricht die Takt -und Fließfertigung auf der Grundlage einheitlicher Arbeitsablaufpläne für die Bau- und Montagearbeiten, also das Zyclogramm, vor und artikulierte auch Zweifel und Widerstände. Das gefiel Ulbricht sichtlich. Den anschließenden Meinungsaustausch beendete Ulbricht mit der Bemerkung: »Die Stunde der jungen Facharbeiter und Ingenieure sei gekommen, haben wir auf dem Parteitag gesagt. Hier ist die Bestätigung.« Schliephake, der unserer FDJ Kreisleitung angehörte, sollte im Oktober 1963 in die Volkskammer gewählt werden. An den nächsten Stationen erkundigte sich Ulricht: »Kennen Sie das Zyclogramm, und was meinen die Kollegen dazu?« Eine Brigadier der Zimmerleute, Typ Balla aus Erik Neutschs noch ungeschriebenem Buch »Spur der Steine«, sagte ununwunden: Der Materialfluss stocke zuweilen. Das hörten die umstehenden Oberen nicht so gern, und sie wollen die Sache ein wenig glätten. Ulbricht winkte an. Man solle solche Hinweise ernst nehmen und Vorschläge »mit größter Sorgfalt« beachten. Jeder Werktätige müsse in der täglichen Praxis das Gefühl haben, dass von seiner Mitwirkung, von seinem Einsatz die Lösung der großen Aufgabe abhinge. Und Ulbricht zeigte, dass es dabei um ganz einfache, aber wesentliche Fragen ging. »Wie sind die Unterkünfte? Wie ist die Versorgung der Bauarbeiter? Wie läuft das im Schichtbetrieb?« Die Zimmerleute sagten: Arbeit, Essen und Unterkunft sind in Ordnung, auch der Verdienst sei gut, das aber genügt nicht … Natürlich, der werktätige Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ulbricht verstand sofort, was gemeint war. Wir ernteten einen tadelnden Blick. In der Folge fanden wir Regelungen, wie die zeitweiligen Kollegen an den bedeutenden Kultur- und Sozialangeboten des Betriebes partizipierten. Bei der abschließenden Zusammenkunft bekräftigte Ulbricht den Grundsatz des höchsten ökonomischen Nutzens bei Planung und Leitung der Wirtschaftsprozesse. Die auf der Baustelle geführten Gesprächen hätten ihm gezeigt, dass die Übereinstimmung der materiellen Interessen der Werktätigen und ihrer Arbeitskollektive mit den Interessen der Gesellschaft immer mehr zur Triebkraft der ökonomischen Entwicklung werde. Mehr als einmal begann er einen Gedanken mit der Wendung »Das Neue besteht darin …«, womit er sich als klarer Analytiker auswies, der strukturiert dachte und genau zwischen Wesentlichem und Zweitrangigem zu unterscheiden vermochte. Er benannte Schwerpunkte und hielt sich mit der Abgabe von Urteilen zurück. Er kritisierte nicht, er empfahl, er wies nicht an, sondern schlug vor. Das gefiel mir. In einer Sache jedoch blieb er hartnäckig: Für ihn war der umfassende Aufbau des Sozialismus nicht Aufgabe der Partei, sondern eine Sache aller Werktätigen. Am 30. Juni, zum 70. Geburtstag Walter Ulbrichts, meldete Frank Schliephake Planerfüllung, das Werk erreichte 99,6 Prozent des Produktionsplanes bei sieben Prozent Steigerung der Arbeitsproduktivität.
Harry Nick: Versuch einer durchgreifenden Wirtschaftsreform in der DDR
Harry Nick, Jahrgang 1932, geboren und aufgewachsen in Schlesien, 1945 Übersiedlung ins Mansfeldische, nach dem Abitur Arbeit als Stangenzieher im Walzwerk Hettstedt, Ökonomie-Studium in Berlin-Karlshorst von 1951 bis 1954, danach Tätigkeit an dieser Hochschule, 1959 Promotion, 1965 Habilitation. Mitarbeiter am Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED seit 1962, ab 1964 Dozent, 1967 Professor. Leiter des Forschungsbereichs »Ökonomische und soziale Probleme des wissenschaftlich technischen Fortschritts« am dortigen Institut für Politische Ökonomie bis 1990. Nationalpreis 1979. Zehn Jahre nach Ulbrichts Tod, 1983, verfasste ich die Schrift »Karl Marx und die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR«.[Anmerkung 42] Sie erschien in sieben Sprachen und wurde den Teilnehmern der vom Zentralkomitee der SED anlässlich des 100. Todestages von Marx veranstalteten Internationalen Konferenz überreicht. An dieser Zusammenkunft nahmen führende Vertreter der kommunistischen und Arbeiterparteien teil. Natürlich nutzte die SED diese Gelegenheit, um ihr gesellschaftspolitisches Konzept vorzustellen. Dass meine Arbeit eine Art Diskussionsgrundlage dieser Konferenz sein würde, erwartete die Parteiführung jedoch nicht. Auf solchen Konferenzen hielt man Monologe, keine Dialoge oder gar Debatten ab. Den Teilnehmern sollte damit allenfalls ein Lesematerial mit auf den Weg gegeben werden. Ob es tatsächlich auch rezipiert wurde, entzieht sich meiner Kenntnis: Eine Resonanz auf diese Schrift hat es nicht gegeben – weil es auch keine internationale Debatte über strategische Grundfragen sozialistischer Entwicklung gab. Alle Programme der in den sozialistischen Ländern regierenden Parteien gingen von den Vorstellungen von Marx und Engels über die kommunistische Gesellschaftsformation aus. In der ersten Phase, dem Sozialismus, noch behaftet mit den Muttermalen der alten Gesellschaft, sollte das Prinzip gelten: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner Leistung. In der zweiten Phase, dem Kommunismus, solle das Prinzip gelten: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Gemäß dem sowjetischen Modell war selbstverständlich, dass nach Beendigung der Übergangsperiode – der Überführung des Großteils der Industrie in Volkseigentum und der privaten bäuerlichen Betriebe in genossenschaftliches Eigentum – der Übergang zum Kommunismus beginnen müsse. Walter Ulbricht hatte den Mut, sich dieser Vorstellung zu widersetzen. Die SED verkündete nach Vollendung der sozialistischen Umgestaltung vielmehr den »umfassenden Aufbau des Sozialismus« und später »die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft«. Das war ein deutlicher Affront gegen die KPdSU, an welchem Walter Ulbricht später auch scheiterte. Meine persönlichen Erfahrungen mit Walter Ulbricht betrafen ausnahmslos seine kritischen Äußerungen zu Ausarbeitungen, an denen ich beteiligt war. Sie waren sämtlich folgenreich. Sie zeugten nicht nur von Ulbrichts großem theoretischen Interesse, sondern auch von einem tiefen theoretischen Verständnis und einer soliden marxistischen Bildung. Aber auch davon, dass Walter Ulbricht als Partei und Staatsführer in wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen das entscheidende Wort reklamierte. Dies betraf auch das Recht, sich zu wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen in lehrbuchartiger Manier zu äußern. Zum ersten Mal erfuhr ich das als Mitautor des Buches »Übergangsperiode in der DDR«, das von Dozenten des Instituts Politische Ökonomie an der Hochschule für Ökonomie im Verlag Die Wirtschaft 1962 publiziert wurde. Ein Beauftragter des Genossen Ulbricht teilte uns mit, dass dieses Buch aus dem Handel zurückgezogen würde, weil es einen schwerwiegenden politischen Fehler enthielte, indem es die Bündnispolitik der SED gegenüber privaten Unternehmern verfälsche. Konkret handelte es sich um die Aussage, dass die staatliche Beteiligung an solchen Unternehmen eine Übergangsform zum Volkseigentum darstelle. Dass dieser Satz im Gesetz über die staatliche Beteiligung zu finden war, half uns nicht. Worum es wirklich ging, offenbarte sich im Schicksal eines weiteren Buches, an welchem ich als Autor beteiligt war. Im Jahre 1967 erschien im Dietz Verlag das Buch »Die politische Ökonomie des Sozialismus – ihre Anwendung in der DDR«, verfasst von Dozenten des Instituts Politische Ökonomie des Sozialismus an der Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. Im Buchtitel sollte auch ausgedrückt werden, dass die Autoren sich auf Erfahrungen der DDR stützten und keine allgemeingültige Lehre der politischen Ökonomie präsentierten. Walter Ulbricht meinte, das aus eben diesem Grunde ein solches Werk nicht allein von Autoren eines Instituts verfasst werden dürfe, sondern von den kompetentesten Experten unseres Landes. Um den Autoren entgegenzukommen und dem Eindruck entgegenzuwirken, sie hätten für den Papierkorb gearbeitet, wurden ihre Texte in sehr geringer Auflage mit dem Vermerk veröffentlicht: »Als Manuskript gedruckt«. Inzwischen war ein neues Autorenkollektiv berufen, es stand unter Leitung Günter Mittags, der zusammen mit Erich Apel das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung konzipiert hatte und seit 1966 dem Politbüro angehörte. Wie nicht anders zu erwarten, steuerte Ulbricht das Vorwort bei. Ulbricht setzte hohe Erwartungen in den wissenschaftlich-technischen Fortschritt. Er war davon überzeugt, dass Sozialismus und wissenschaftlich technische Revolution quasi Verbündete seien, die die Entfaltung ihrer Potenziale wechselseitig befördern und die Überlegenheit des Sozialismus demonstrieren würden. Besondere Aufmerksamkeit schenkte er den sich entwickelnden komplexen Systemen flexibler Automatisierung. Sie ermöglichten die Komplettbearbeitung komplizierter Werkstücke bei einer Aufspannung unter Einsatz verschiedener Fertigungsverfahren (Drehen, Fräsen, Bohren u. a.). Das erlaubte die Automatisierung auch in den Bereichen der Mittel-, Klein- und selbst der Einzelfertigung. Bei der Entwicklung und dem Einsatz solch flexibler Automatisierungslösungen für die Materialbearbeitung war die DDR gut vorangekommen. Verständlich darum der Gedanke, dies auch international zu präsentieren. So entstand die Idee einer ständigen Industrieausstellung der DDR, analog der Internationalen Landwirtschaftsausstellung in Leipzig/Markkleeberg. Für diese Exposition wurden auf einem weitläufigen Waldgelände in der Nähe der Berliner Bahnhöfe Wuhlheide und Köpenick Gebäude und Pavillons errichtet. In den ersten Ausstellungen sollten Grafiken und Tabellen mit ausführlichen Erläuterungen gezeigt werden. Zwei Tage vor der geplanten Eröffnung entschied Walter Ulbricht, dass es keine Industrieausstellung geben werde, stattdessen eine »Akademie für Marxistisch-Leninistische Organisationswissenschaft« (AMLO), ein noch aufzuklärendes Konglomerat aus Kybernetik, Operationsforschung, Leitungswissenschaften und Ähnlichem. Die AMLO sollte so etwas wie das wissenschaftliche Zentrum der Modernisierung der DDR-Wirtschaft sein. Die Einrichtung war wie wohl auch die »Systemautomatisierung« ein markantes Beispiel überzogener, wirklichkeitsfremder Vorstellungen der wirtschaftlichen Entwicklung in der DDR. Praktisch bedeutete sie eine Konzentration der Ressourcen auf Spitzentechnologien und eine Vernachlässigung der wirtschaftlichen Modernisierung in der Breite, so lautete auch eine der Begründungen für die Ablösung Walter Ulbrichts durch Erich Honecker 1970. Nach dieser Ablösung war weder von der AMLO noch von der DDR-Industrieausstellung mehr die Rede. In die dafür vorgesehenen Gebäude zogen das Ministerium für Wissenschaft und Technik, dessen Forschungsstelle und andere Dienststellen ein. Das größte Verdienst Walter Ulbrichts war zweifellos der Versuch einer durchgreifenden Wirtschaftsreform, das »Neuen Ökonomischen Systems« (NÖS). Dort zeigten sich besonders deutlich seine Klugheit und Weitsicht sowie seine Vorgehensweise. Im September 1962 war in der Prawda ein Artikel des sowjetischen Ökonomen Jewsei G. Liberman unter der Überschrift »Plan, Gewinn und Prämie« zu lesen. Darin geißelte der Autor die Orientierung der wirtschaftlichen Entwicklung auf das Mengenwachstum (»Tonnenideologie«) sowie die Vernachlässigung von Effizienz und Qualität. Die sowjetische Führung nahm von dieser Kritik keine Notiz. Die Wirtschaftsreformer in anderen sozialistischen Ländern taten es ihr gleich und debattierten weiter über Plan und Markt. Diese Debatten trafen nicht den Kern des Problems, das in einem überholten, ineffektiv gewordenen Wirtschaftsmechanismus bestand. Ulbricht erkannte dies. In der Phase der Industrialisierung, als jeder neue Schornstein auf bislang grüner Wiese als sozialistischer Fortschritt gefeiert wurde und vom wirtschaftlichem Erstarken kündete, war quantitatives Wachstum, vorwiegend extensiv erreicht, durchaus wichtig. Die Entscheidungen über die Standorte für neue Betriebe und die mit ihnen verbundene Infrastruktur wurden aus gesamtwirtschaftlicher Sicht von der Zentrale getroffen. Als Finanzierungsquelle kamen nur staatliche Fonds infrage. Zentrale Wirtschaftslenkung, Planung und Kontrolle hat sich in der Industrialisierungsphase durchaus bewährt. Nach Ende des Bürgerkrieges betrug die sowjetische Stahlproduktion nicht einmal ein Prozent der US amerikanischen. Nach dem Ende des Weltkrieges, 1946, waren es 40 Prozent, 1970 schon 120 Prozent. Inzwischen war aber anderes entscheidend: Wie viel Gebrauchswert – zum Beispiel an Maschinerie – konnte aus einer Tonne Stahl gewonnen werden? Dies verlangte nach einem grundlegenden wirtschaftlichen Wandel, der Veränderung des Reproduktionstyps, dem Übergang zur intensiv erweiterten Reproduktion. Die Modernisierung vorhandener Betriebe aber konnte natürlich am besten innen und nicht von außen geleitet werden. Und zwar in Abhängigkeit von den selbst erwirtschafteten Mitteln. Die sowjetische Führung aber blieb der Idee extensiven Wirtschaftswachstums verhaftet. Das erklärte auch die unrealistischen Ziele des wirtschaftlichen Wettbewerbs mit den USA, wie sie der XXII. Parteitag der KPdSU im Oktober 1961 beschloss. Walter Ulbricht nahm den Artikel Libermans sofort zum Anlass, die Akademie für Gesellschaftswissenschaften zu beauftragen, den ähnlichen Problemen in der DDR-Wirtschaft nachzugehen. Der Auftrag landete in unserem Institut Politische Ökonomie. Unser Lehrstuhlleiter und wir vier Fachrichtungsleiter verfassten nach ausführlichen Gesprächen mit zahlreichen Wirtschaftsfunktionären und Betriebsdirektoren einen Artikel, der unter dem Titel »Prämien für moderne und für veraltete Technik« am 15. November 1962 im Neuen Deutschland erschien. Natürlich konnte nach dem Verständnis Walter Ulbrichts eine so wichtige Sache wie das NÖS nicht in der Verantwortung eines wissenschaftlichen Instituts aus der Taufe gehoben werden. Deshalb wurde im Vorspann zu unserem Artikel angekündigt, dass im Dezember 1962 eine Wirtschaftskonferenz über eine Wirtschaftsreform stattfinden werde, für deren Vorbereitung die Staatliche Plankommission und das Staatssekretariat für Hochschulwesen verantwortlich seien. Zentralkomitee und Regierung übernahmen die weitere Ausgestaltung des NÖS. Die Eigenerwirtschaftung der Mittel für die erweiterte Reproduktion durch die Betriebe und Kombinate sollte eine gesamtwirtschaftliche Steuerung nicht ausschließen. Der Staat würde durch differenzierte langfristige Normative der Gewinnabführung und durch Investitionen eine gesamtwirtschaftliche Strukturpolitik gestalten. Dazu konnten jedoch keine praktischen Erfahrungen gewonnen werden, weil es keine Eigenerwirtschaftung solcher Art gab. Jedes Jahr wurden den Betrieben stets aufs Neue Planaufgaben erteilt und Ressourcen zugeteilt. Das Neue Ökonomische System scheiterte in seiner zentralen Idee aus politischen Gründen. Es hätte bedeutet, dass nicht – wie bislang üblich – 80 Prozent der Investitionen in der Verfügungsmacht des Staates und 20 Prozent in der der Betriebe gelegen hätten, sondern dass dieses Verhältnis hätte umgekehrt werden müssen. Aber eine solch starke Eigenmacht der Betriebe widersprach der zentralistischen Struktur des politischen Systems. Ob Walter Ulbricht dieses System hätte überwinden können und ob er dies überhaupt wollte, ist nicht bekannt. Sein Verhalten auf dem 11. ZK-Plenum im Dezember 1965, das eine Verschärfung der zentralistischen Elemente nicht nur im Kulturbereich zur Folge hatte, lässt dies nicht vermuten. In jedem Falle bleiben die Ideen des NÖS ein wichtiges Rüstzeug bei den Überlegungen für ein Wirtschaftsmodell jenseits des Kapitalismus.
Eberhard Fensch: Das Neue Ökonomische System und die journalistische Arbeit
Eberhard Fensch, Jahrgang 1929, Jornalistikstudium, 1953 Betriebszeitungsredakteur auf der Mathias-Thesen-Werft in Wismar, 1956 Sender Rostock, 1961 Radio DDR, 1968 Mitarbeiter der von Werner Lamberz geleiteten Abteilung Agitation des ZK der SED. Als Stellvertretender Abteilungsleiter zuständig für das Fernsehen und den Hörfunk der DDR. Eberhard Fensch lebt seit den 90er Jahren auf Usedom. Meine erste persönliche Begegnung mit Walter Ulbricht hatte ich 1963, also vor etwa fünfzig Jahren. Deshalb kann ich mich auch nicht mehr an das Datum erinnern, aber wohl an die Atmosphäre, in der unser Gespräch stattfand. Ich war damals Leiter der Wirtschaftsredaktion von Radio DDR, also in einer Funktion, in der ich mit dem Staatsoberhaupt der DDR, außer bei dessen Messerundgängen in Leipzig und dort auch nur im Begleitertross, nicht in Kontakt kam. So war ich denn auch überrascht, als ich eines Tages eine Einladung zu einem Treffen mit Walter Ulbricht im ZK der SED erhielt – zu einem »Gedankenaustausch über aktuelle Wirtschaftsfragen«, wie ich las. Schon dies war ungewöhnlich, denn an eine direkte Aussprache mit ihm konnte sich keiner der etwa fünfzehn Berufskollegen verschiedener Medien, die gleich mir eine Einladung bekommen hatten, erinnern. Anders, als ich vermutete, ging es bei diesem Treffen denn auch zu. Keine Spur von Protokoll oder Distanz. Und ich erlebte, im Gegensatz zu seinem Image, einen ausgesprochen lockeren und aufgeräumten Walter Ulbricht. Er sagte, er wolle uns zunächst über eine bevorstehende grundlegende Weichenstellung in der Wirtschaftspolitik der Partei informieren, über das Projekt eines Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft der DDR. Zwar habe sich die Planwirtschaft, insbesondere die Gesamtplanung der volkswirtschaftlichen Prozesse, grundsätzlich bewährt, es sei aber den Betrieben viel zu wenig Eigenverantwortung und Entscheidungsbefugnis eingeräumt worden. Das vor allem solle verändert werden, denn vor Ort entscheide es sich nun mal besser als fernab an zentraler Stelle. Auch müsse die Tonnenideologie überwunden und durch eine stärkere Orientierung auf die Effizienz der Arbeit ersetzt werden. Nicht die Menge, schon gar nicht die allein, sei die entscheidende Kennziffer, sondern die Arbeitsproduktivität. Diesen Geist auf allen Ebenen des wirtschaftlichen Lebens – von der Brigade bis in die Ministerien und in die Staatliche Plankommission durchzusetzen sei jetzt die wichtigste Aufgabe in der politischen Arbeit der Partei und natürlich auch der Medien. Dafür wolle er uns gewinnen, das sei sein Anliegen bei dieser Beratung, und er forderte uns auf, dazu ungeschminkt unsere Meinung zu sagen. Damit aber rannte er bei uns Journalisten offene Türen ein, denn wir waren ja ständig in den Betrieben unterwegs, wussten also, wie überfällig ein Kurswechsel hin zu mehr Produktivität und Selbständigkeit der Betriebe war. So gab es denn von uns auch nur Zustimmung, angereichert mit konkreten Beispielen und Belegen für die Richtigkeit der beabsichtigten Maßnahmen. Auch ich meldete mich zu Wort. Das hieße aber auch, sagte ich, dass öffentliche Kritik an falschem Verhalten für uns Journalisten nicht länger tabu sein dürfe, wenn unser Wirken Nutzen bringen solle. Zu meiner Überraschung bejahte Ulbricht dies ausdrücklich und öffnete uns damit zumindest eine Zeitlang mehr Spielräume für einen wirksamen Wirtschaftsjournalismus. Was allerdings wieder endete, als Anfang der 70er Jahre mit dem Ausscheiden Walter Ulbrichts aus der aktiven Politik zu meinem großen Bedauern auch das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung nicht mehr fortgeführt wurde. Unabhängig davon aber war diese Beratung für uns Journalisten außerordentlich anregend und inspirierte unsere Redaktion zu einer ganzen Reihe von neuen Sendeformen. So zu der Aktion »Aus dem Groschen die Mark«, eine Reportagereihe zur Effektivitätsproblematik mit ausgesprochen kritischen Beiträgen, Dokumentationen wie »Ist Schöpfertum das Privileg einer Elite?«, gemeinsam mit führenden Soziologen der DDR, oder »Ist der Wettbewerb eine Pflichtübung?«, gemeinsam mit dem FDGB. Oder szenische Porträts von Vorreitern der Effektivitätsbewegung unter dem Motto »Bezeugt und protokolliert«. Außerdem die Gesprächsrunde »Sprechstunde Zukunft«, gemeinsam mit dem Fernsehen der DDR. Und schließlich das Fernsehspiel »Die Unbequemen« aus meiner Feder, das eine breite Diskussion in den Betrieben auslöste. Es war die produktivste Zeit meines journalistischen Schaffens. Ich verdanke dies nicht zuletzt Anregungen, die ich von Walter Ulbricht bekam.
Günther Jahn: Das NÖS ist Beweis für die Reformfähigkeit des Sozialismus
Günther Jahn, Jahrgang 1930, 1946 FDJ und SED. Nach dem Abitur in Erfurt Ökonomiestudium in Jena und Berlin. Tätigkeit in der Abt. Planung und Finanzen im ZK der SED, zwischenschenzeitlich eine Aspirantur und Promotion zum Dr. rer. oec. mit einer Arbeit zu Wirtschaftsräten und sozialistischer Rekonstruktion in der DDR-Industrie. 1965/66 Leiter der Arbeitsgruppe »Sozialistische Wirtschaftsführung«. 1966 wurde er 2. Sekretär und 1967, als Nachfolger Horst Schumanns, 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ (bis 1973). Sein Nachfolger wurde Egon Krenz. Von 1976 bis 1989 1. Sekretär der Bezirksleitung Potsdam der SED. Abgeordneter der Volkskammer von 1967 bis 1990, dem ZK der SED gehörte er von 1967 bis 1989 an. Ein sonniger Werktag im Frühling 1963. Wie gewohnt sitze ich etwas überpünktlich an meinem Schreibtisch im Zimmer des Leiters der Arbeitsgruppe »Sozialistische Wirtschaftsführung« im Zentralkomitee. Das Telefon klingelt, es ist das Sekretariat Ulbricht, ich solle bitte 8 Uhr beim Ersten Sekretär sein. Ich nehme meine Dienstkladde, ein gebundenes Schreibbuch im Din-A4-Format, dessen Benutzung in solchen Fällen Vorschrift ist und als Vertrauliche Verchlusssache (VVS) gilt. Ich eile von der vierten in die zweite Etage. Seine Sekretärin empfängt mich freundlich lächelnd, ein gutes Omen. Sie geleitet mich in seinen Arbeitsraum, vorbei an einem großen Tisch mit etwa 50 Büchern, den aktuellen Neuerscheinungen aller DDR Verlage. Dann stehe ich erstmals vor ihm: meinem höchsten Chef im zentralen Parteiapparat. Knappe Begrüßung mit Handschlag. Ich wundere mich, dass mein direkter Vorgesetzter, ZK-Sekretär Günter Mittag,[Anmerkung 43] nicht anwesend ist. Also wird das ein Gespräch unter vier Augen. »Ich habe dich zu mir gebeten«, beginnt Walter Ulbricht, »damit du mich über den Stand des Neuen Ökonomischen Systems informierst und wie es damit weitergehen soll.« Ich bin erleichtert. Bei diesem Thema stehe ich einigermaßen im Stoff und muss eine Blamage nicht fürchten. Zunächst berichte ich, dass wir gemeinsam mit der Abteilung Planung und Finanzen eine Vorlage ans Politbüro einreichen werden. Darin schlagen wir die Einberufung einer gemeinsamen Wirtschaftskonferenz des ZK und des Ministerrates vor. Danach sei ein mehrtägiges Seminar mit allen verantwortlichen Wirtschaftskadern der zentralen und der bezirklichen Leitungsebenen in Rostock-Warnemünde vorgesehen. Dieses Seminar solle dann in allen Kreisen Fortsetzung finden. Und demnächst würde ein Zentralinstitut für sozialistische Wirtschaftsführung beim ZK der SED eröffnet, dessen Leitung Prof. Dr. Helmut Koziolek übernehmen wird, ein international anerkannter Wissenschaftler, der sich besonders auf dem Gebiet des Nationaleinkommens einen Namen gemacht habe. Ich wage noch die Anmerkung, dass Genosse Koziolek kürzlich in einem Vortrag vor Parteiaktivisten erklärt habe: »Leider ist bei einigen Leitern der Ideenreichtum beim Bescheißen größer als beim ökonomischen Fortschritt.« Ulbricht nickt, und ein Lächeln kreist um seinen Spitzbart, als hätte er bei der Erschaffung des Sandmännchens Modell gesessen. Vermutlich weil ich (und ihm gegenüber überflüssigerweise) die Führungstätigkeit als erstrangigen Faktor überbetone, merkt er an: »Für die Schulung habe die Numerierung der Teilkomplexe aus methodischen Gründen ihre Berechtigung. Das aber ist die Theorie. In der Praxis kommt es darauf an, alle Komplexe gleichzeitig und nicht nacheinander einzuführen. Nur so wird daraus ein ordentlich funktionierendes System. Darin besteht die Führungskunst.« Im Herbst 1964 findet schließlich das mehrtägige Seminar zum NÖS statt. Die Leitung liegt bei Günter Mittag, für die inhaltliche Gestaltung ist die Arbeitsgruppe sozialistische Wirtschaftsführung verantwortlich, für die Organisation die Abteilung Verkehrs- und Verbindungswesen des ZK. Am Abend jedes Seminartages unterrichtet Mittag dienstbeflissen Ulbricht per Telefon. Die Wirtschaftssekretäre der Bezirksleitungen, Kombinatsdirektoren, Parteiorganisatoren, die Chef der Bezirksplankommissionen, die Bezirksbaudirektoren und die anderen Seminarteilnehmer zeigen sich interessiert und aufgeschlossen. Allerdings scheint sich ein Schatten über die Veranstaltung zu legen, als durchsickert, dass am Ende von ihnen eine Art schriftliche Prüfung abzulegen sei, was diese gestandenen Persönlichkeiten mit Recht für eine Zumutung halten. Sie sollen wie Schüler examiniert werden und Fragen beantworten, etwa: »Was ist ein optimaler Plan?« Das war Mittags Idee, und der 38-Jährige hält lange an dieser Absicht fest. Doch irgendwie gelingt es mir dann doch, ihn zur Rücknahme dieser Entscheidung zu bewegen. Dieses Gefecht soll sich jedoch als überflüssig erweisen. Das Seminar wird vorzeitig beendet und Mittag von Ulbricht nach Berlin beordert. Den Grund für den Abbruch liefert die Nachricht, dass in Moskau Chruschtschow[Anmerkung 44] überraschend – »aus gesundheitlichen Gründen« – von all seinen Funktionen zurückgetreten und durch Breshnew[Anmerkung 45] ersetzt worden ist. Es dauert nicht lange, bis wir merken, dass sich der Wind dreht und uns in Berlin mächtig ins Gesicht zu blasen beginnt. Und das in dem Moment, als wir uns anschicken, nach der theoretischen Ausarbeitung des neuen Systems dieses in der Praxis umzusetzen. Mir kommt es damals so vor, als wäre das Rennen um das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung bereits beim Start abgebrochen worden. Das Widersinninge besteht darin, dass das NÖS nunmehr mit den gleichen Argumenten attackiert wird, mit denen es zunächst begründet worden war. So heißt es beispielsweise jetzt, dass dem Sozialismus jeglicher Automatismus wesensfremd sei, und je höher das sozialistische Bewusstsein, desto besser sei dies für die sozialistische Gesellschaft und deren Wirtschaft. Dieser Gemeinplatz ist durch das NÖS nie in Zweifel gezogen worden. Die Angriffe aus Moskau richten sich insbesondere auf den Komplex der aufeinander abgestimmten ökonomischen Hebel, wobei absichtsvoll ignoriert wird, dass diese nur ein Element des Systems und mit den anderen Bestandteilen verzahnt sind. Das ist keine Basis für eine wissenschaftliche Diskussion. Die Abkehr vom NÖS wird durch zwei Fehlentscheidungen forciert, an denen sein Erfinder ungewollt mitwirkt. Walter Ulbrichts Orientierung, die Kybernetik in die Wirtschaftsführung und selbst in die Parteiarbeit einzubeziehen, kommt nicht nur überraschend für die Wirtschaftskader und Parteifunktionäre, sondern ist auch überzogen. Mit dem Wesen der Kybernetik, den Kategorien und Kriterien kann kaum einer etwas anfangen. In die Unwissenheit mischen sich auch Verunsicherung und Sorge um den eigenen Arbeitsplatz; die instinktive Ablehnung überträgt sich auch auf das ganze Konzept des NÖS. Als im Juni 1966 der Kaderchef des ZK-Apparates, Fritz Müller, auf einer Mitarbeiterversammlung erklärt, dass gegenwärtig und künftig Parteiarbeiter »auch ohne kybernetisches Wissen dringend gebraucht« würden, gibt es Beifall. Und die zweite Fehlleistung besteht wohl in der Kreation der Formel vom »Überholen ohne einzuholen«. Ich weiß, wie das gemeint ist, dass, simpel gesagt, wir nicht alles nachmachen sollen, was der Westen macht, und im Kern ist das auch richtig. Aber die Wendung liefert Anlass für Hohn und Spott bei Freund wie Feind und diskreditiert objektiv Ulbricht und das NÖS. Freilich wäre das vermeidbar und wohl auch reparabel gewesen, wenn denn Günter Mittag, der ein feines Gespür für sich drehende Winde besitzt, nicht eigene Interessen verfolgte. Er forciert die Bildung großer Wirtschaftseinheiten, von Kombinaten, die er sich faktisch politisch persönlich unterstellt. Das ist die beste Organisationsform für eine Kommandowirtschaft, die ja genau das Gegenteil von dem darstellt, was das NÖS will. Und an die Stelle einer wissenschaftlichen Führungstätigkeit treten alsbald Mittags »Erzählseminare«, auf denen Kombinatsdirektoren von Mittag abgekanzelt und zum Verfassen von Verpflichtungserklärungen, Erfolgsmeldungen und Ergebenheitsadressen genötigt werden. Auf dem VIII. Parteitag 1971 fällt der Begriff »Neues Ökonomisches System der Leitung und Planung« nicht ein einziges Mal. Es hat dieses Konzept nie gegeben, obgleich es doch zwei Parteitage zuvor von den meisten Delegierten, die auch jetzt wieder im Saal sitzen, beschlossen worden war. Im Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees erklärte Ulbrichts Nachfolger: »Wir kennen nur ein Ziel, das die Politik unserer Partei durchdringt: Alles zu tun für das Wohl des Menschen, für das Glück des Volkes, für die Interessen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen. Das ist der Sinn des Sozialismus. Dafür arbeiten und kämpfen wir.« Etwas anderes hat auch Walter Ulbricht nicht gedacht und getan. Nun heißt es, die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik würde die Menschen nicht auf später vertrösten (»So wie wir heute arbeiten, werden wir morgen leben«), sondern sie würden die sozialistischen Früchte ihrer Arbeit schon heute genießen können (»Ich leiste was – ich leiste mir was«). Wie sich alsbald zeigt, wird mehr konsumiert, als wir uns hätten leisten können. Und die Schere zwischen Ertrag und Verzehr geht stetig weiter auseinander. Ob die Entwicklung bei vollständiger Durchsetzung des NÖS entschieden anders verlaufen wäre, kann nur spekulativ beantwortet werden. Die Vorstellung, dass die »Politik der Hauptaufgabe« – die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik erfolgreich gewesen wäre, wäre sie vom NÖS flankiert und stimuliert worden, hat etwas Verlockendes. Diese Chance gab es nicht. So gilt denn die Binse: Niemand kann um Sieg oder Platz kämpfen, wenn er nicht zum Wettkampf zugelassen wird. Walter Ulbrichts besondere Stärke bestand darin, sich mit Wissenschaftlern zu beraten. Viele von ihnen waren an der Ausarbeitung des NÖS beteiligt. Einer, der eher bescheiden und unauffällig im Hintergrund wirkte, hieß Dr. Wolfgang Berger.[Anmerkung 46] Seit Bestehen des zentralen Parteiapparates, seit 1953, war er der wirtschaftspolitische Berater des Ersten Sekretärs, zuvor hatte er die Abteilung Planung und Finanzen des ZK geleitet. Ulbricht war Initiator und Chefarchitekt des NÖS, Berger war Vordenker und Ideengeber. Ich kannte Berger seit 1954 aus gemeinsamer Arbeit. Nachdem wir uns aus den Augen verloren hatten, meldete er sich im Sommer 1991 bei mir. Er kam aus seinem kleinen Dorf bei Königs Wusterhausen zu mir nach Potsdam herüber. Er war sichtlich von Krankheit gezeichnet. Wir beide seien so ziemlich die letzten Kenner des NÖS, sagte er, deshalb müssten wir darüber auch berichten. Wozu, fragte ich, der Kopf ist ab, die Frisur interessiert niemanden mehr. Wolfgang Berger widersprach. »Das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung gehört erstens zur Parteigeschichte, und zweitens ist es Ausdruck für die Reformfähigkeit des Sozialismus – selbst wenn es die Reformunwilligen und Reformgegner verhinderten. Es aufzuschreiben sind wir Walter Ulbricht schuldig!« Da hatte er gewiss recht.
Kurt Fenske: Als Internationalist wollte Ulbricht einen starken, kreativen RGW
Kurt Fenske, Jahrgang 1930, 1946 FDJ und SED, Mitglied der Landesleitung Sachsen der FDJ, danach Studium der Wirtschaftswissenschaften in Leipzig und an der Hochschule für Ökonomie in Berlin (bis 1954), politischer Mitarbeiter im ZK der SED von 1956 bis 1959. Von 1957 bis 1963 Fernstudium an der Technischen Universität in Dresden, Abschluss als Diplom-Ingenieurökonom, Promotion 1969, Tätigkeit in verschiedenen Außenhandelsbetrieben in unterschiedlichen Funktionen, so im AHB Nahrung, dort 1959 Stellvertretender Generaldirektor, von 1962 bis 1967 Generaldirektor des AHB Elektrotechnik. Seit 1967 Stellvertretender Minister für Außenhandel, ab 1985 Staatssekretär und Erster Stellvertreter des Ministers für Außenhandel. Von 1967 bis 1990 Abgeordneter der Volkskammer. Erstmals bin ich Walter Ulbricht auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1963,[Anmerkung 47] nach meinem Ökonomiestudium, begegnet. Im Anschluss an den Messerundgang durch die Ausstellungen der Elektroindustrie fand eine Beratung mit den Generaldirektoren der Industrie und des Außenhandels sowie den zuständigen Genossen des Staatsapparates für diesen Industriezweig statt. Das war ein offener Gedankenaustausch zum wissenschaftlich-technischen Stand der Produktion. Ich gehörte zu den jüngsten Teilnehmern der Beratung. Mich beeindruckte, mit welcher Logik in der Gedankenführung der damals 70-Jährige seine Überlegungen vortrug und zur Diskussion stellte. Er erwies sich als gut informiert und erstaunte mich, dass er auch gut zuhören konnte und durch Nachfragen die Argumente der anderen bekräftigte oder ihnen widersprach. Dieser Beratung schloss sich eine lebhafte Debatte über die von Ulbricht definierten strategischen Ziele an. Ein erfahrener Außenhändler erzählte dabei von einem Gespräch Ulbrichts mit Chruschtschow vor einigen Jahren. Es ging darin um die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen zur Entwicklung der Mikroelektronik. Die sowjetische Seite hatte zu verstehen gegeben, dass sie diese Dringlichkeit nicht sehe. Ulbricht glaubte, den Grund der Ablehnung erkannt zu haben: »Nikita, schau mal hinter und neben dich: alles alte Männer! Glaubst du, dass sie die moderne Datenverarbeitung noch verstehen?« Die Reparationsansprüche der UdSSR waren als ein gewisser Ausgleich für die entstandenen Kriegsschäden begründet. Sie belasteten die sich unter schwierigen Bedingungen herausbildende Volkswirtschaft der DDR in einem außerordentlichen Maße. Es ist inzwischen bekannt, dass Walter Ulbricht schon im Februar 1946 bei Stalin nachsuchte, die Demontagen einzustellen. Diese und andere Interventionen Ulbrichts führten zu keiner Änderung der sowjetischen Reparationsansprüche gegenüber der DDR. Erst im August 1953, nach den sozialen Unruhen am 17. Juni, erfolgte eine Korrektur. In einem Regierungsabkommen wurde erklärt, dass die Reparationsleistungen der DDR am 31. Dezember 1953 als beglichen gelten sollten. Walter Ulbricht zeigte sich in dieser schwierigen Nachkriegszeit als ein energischer Organisator und als Ökonom von besonderem Format. Gemeinsam mit Heinrich Rau und Bruno Leuschner entwickelte er unter kompliziertesten Bedingungen die Konturen und Prinzipien einer dem Volke dienenden wirtschaftlichen Entwicklung. Er stand an der Spitze der kreativen Kräfte der SED, die sich auf ein dynamisches Wachstum der Volkswirtschaft konzentrierten. Die Lösung einer solchen wahrhaft gigantischen Aufgabe erforderte die Ausbildung einer jungen Generation von Ökonomen. Mit seinem 1949 veröffentlichten Lehrbuch für den demokratischen Staats- und Wirtschaftsaufbau schuf Walter Ulbricht eine wirkungsvolle Grundlage für die Ausbildung einer Generation von Ökonomen, die in den 60er Jahren erfolgreich das Neue Ökonomische System der DDR mitgestalteten. Wie für jede andere Volkswirtschaft war auch für die der SBZ und der DDR der Außenhandel ein wichtiges und unter den Bedingungen der ersten Nachkriegsjahre auch ein besonders kompliziertes Element der volkswirtschaftlichen Prozesse. Bedingt durch die Reparationsverpflichtungen unterstand die Abwicklung des Außenhandels bis 1954 der Kontrolle der SMAD. In den ersten Jahren nach 1945 wickelten vor allem private Betriebe mit den Westzonen und anderen westlichen Staaten kaum nennenswerten Handel ab. Die ersten Kompetenzen auf diesem Gebiet wurden deutschen Organen 1947 übertragen. Im Jahr 1949 begann der Aufbau des Außenhandels der DDR. Im September 1951 wurde die volle Verantwortung für den Außenhandel an die nach Warengebieten gegliederten Außenhandelsbetriebe übergeben. Damit wurde begonnen, den Außenhandel der DDR nach sowjetischem Vorbild zu organisieren und das Außenhandelsmonopol durchzusetzen. 1954 wurden die Kontrollen durch die sowjetischen Organe beendet. Die Initiativen der Verantwortlichen, auch die des Generalsekretärs der SED, zielten darauf, dass die DDR ihren internationalen wirtschaftlichen Verpflichtungen nachkam und durch eine schrittweise Verbesserung der Außenhandelstätigkeit die wirtschaftliche Potenz des Landes erhöhte. Zu Beginn der 60er Jahre drängte Ulbricht darauf, die Zusammenarbeit der Außenhandelsorgane mit den Exportbetrieben zielgerichtet zu verbessern. Die in jener Zeit begonnene Entwicklung des Neuen Ökonomischen Systems stellte auch dem Außenhandel neue Aufgaben. Ulbricht forderte auf dem VII. Parteitag 1967, dass der Außenhandel schneller wachsen solle als die Industrieproduktion. Bis dahin hatte die DDR das ökonomische System der sowjetischen Außenhandelsorganisation übernommen, wonach ausschließlich dem Ministerium für Außenhandel unterstellte Betriebe berechtigt waren, Verträge zu Export und Import abzuschließen. Dabei galt das Prinzip, dass eine Warenart nur von einem Außenhandelsbetrieb vertrieben werden durfte, womit ausgeschlossen war, dass sich zwei Außenhandelsbetriebe gegenseitig Konkurrenz machten. Diese Außenhandelsbetriebe »kauften« die Waren bei DDR-Exportbetrieben zu Inlandspreisen und verkauften sie im Ausland zu Weltmarktpreisen. Der Staat glich die Differenz zwischen diesen Preisen aus. Dadurch schirmten die Außenhandelsunternehmen die Exportbetriebe zwar von Einflüssen des Weltmarktes ab, aber es war wenig ökonomisch, Waren auf dem Weltmarkt unter den Herstellungspreisen zu verkaufen. Walter Ulbricht beschäftigte sich intensiv auch mit dieser Problematik, holte kritische Meinungen ein und veranlasste, dass das System korrigiert wurde, ohne das staatliche Außenhandelsmonopol aufzugeben. Auf Basis seiner Überlegungen wurde im Dezember 1967 im Politbüro ein grundlegender Beschluss zur Umgestaltung des ökonomischen Systems im Außenhandel gefasst. Gleichzeitig erhielten die Exportbetriebe einen Exportplan, welcher mit dem Plan der Außenhandelsbetriebe abgestimmt wurde. Somit verlagerte sich die Verantwortung für die Exportproduktion und den Export auf die Betriebe. Ausgewählten Kombinaten – etwa im Schiffbau, dem Petrolchemischen Kombinat Schwedt, Carl Zeiss Jena wurden die zuständigen Außenhandelsbetriebe direkt unterstellt. Tatsächlich verbesserte sich im Ergebnis dieser ökonomischen Regelungen die Zusammenarbeit von Produktion und Außenhandel. Die Weltmarktfähigkeit der Produkte verbesserte sich jedoch nicht. Volkswirtschaftlich begründete Entscheidungen auf allen Ebenen machten es in der zweiten Hälfte der 60er Jahre erforderlich, die Umrechnung der DDR-Mark in Auslandswährungen so zu gestalten, dass die Produzenten von Exportwaren und die Verbraucher von Importwaren den volkswirtschaftlichen Aufwand und Nutzen erkennen konnten. Deshalb wurden dazu zwei grundlegende Entscheidungen getroffen: Im Jahr 1968 wurde das Verhältnis von Mark der DDR zum transferablen Rubel,[Anmerkung 48] und damit der Erlös der Betriebe bei der Exportproduktion, neu festgelegt. Zu diesem Zweck wurde für den gesamten Export der DDR in die sozialistischen Länder die Summe der Betriebspreise der Exportwaren festgestellt und ins Verhältnis zur Summe der Exporterlöse (RGW-Preise[Anmerkung 49]) gesetzt. Bei der Festlegung des Verhältnisses der Mark der DDR zu den kapitalistischen Währungen konnte diese Methode jedoch nicht angewendet werden. Aus einer Vielzahl von Gründen blieb es dabei, dass eine Mark der DDR einer D-Mark West entsprach. Dieses Verhältnis hatte Bedeutung für eine Vielzahl von praktischen Fragen im Verhältnis zur Bundesrepublik, etwa für die Berechnung von Alimenten, Erbschaften usw., aber auch der Kosten für den Autobahnbau, der Autobahngebühren und anderes. Das betraf alle finanziellen Transfers zwischen beiden deutschen Staaten, aber auch den Vergleich von Preisen und Löhnen usw. Um zu gewährleisten, dass auch beim Außenhandel in das nichtsozialistische Ausland den Exportbetrieben der volkswirtschaftliche Aufwand erstattet wird, wurden Preisaufschläge (= Preisausgleich) den Preisen in DM hinzugefügt. Die Berechnung erfolgte analog der Berechnung bezüglich des transferablen Rubel. Die Kurse für die Umrechnung der Mark der DDR in Dollar und andere kapitalistische Währungen erfolgte auf der Basis der tatsächlichen Kursverhältnisse der D-Mark zu diesen Währungen. Da der Kurs der Mark der DDR zum transferablen Rubel und für eine Valuta Mark nach unterschiedlichen Kriterien festgelegt wurde, konnte es nach diesen Entscheidungen auch keinen einheitlichen Außenhandelsplan mehr geben. Die Abhängigkeit des Ostteils Deutschlands vom Handel mit den Westzonen war wesentlich größer als umgekehrt. Das ergab sich aus vielen Gründen, u. a. aus dem Umstand, dass die Rohstoffbasis für die Produktion des Osten Deutschlands im Westen lag, insbesondere hinsichtlich metallurgischer Lieferungen aus dem Ruhrgebiet, dass im Gegensatz dazu der Westen aber auf die Liefermöglichkeiten der westlichen Welt zurückgreifen konnte, wenn bisher aus dem Osten kommende Lieferungen nicht erfolgten. Der Wiederaufbau im Osten Deutschlands verlangte wesentlich stärker den innerdeutschen Handel als der Westen für seine Entwicklung. So konnte es nicht überraschen, dass der Westen den sogenannten innerdeutschen Handel von Anfang an als Instrument im Kalten Krieg nutzte. Anfang 1947 wurde der erste Handelsvertrag zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands geschlossen, das sogenannte Mindener Abkommen. Der Osten lieferte vor allem Getreide, Kartoffeln, Zucker und Textilien. Zwei Drittel der westlichen Lieferungen bestanden aus Eisen und Stahl. Die Umfänge dieser Lieferungen betrugen weniger als 20 Prozent der Warenflüsse vor dem Krieg. Steinkohle wurde nur noch in sehr geringen Mengen geliefert. Mitte 1948 stoppte der innerdeutsche Handel vollständig. Die Westmächte hatten mit der separaten Währungsreform und der Einführung der DM in den Westsektoren Berlins die Sowjetunion zur Sperrung der Wege nach und von Westberlin veranlasst, worauf der Westen mit einer propagandistisch aufgeblasenen Luftbrücke reagierte und eben mit der Unterbrechung des innerdeutschen Handels. Dieser wurde erst mit Abschluss des Jessup-Malik Abkommens[Anmerkung 50] im Mai 1949 wieder aufgenommen. Einen Tag nach Gründung der DDR erfolgte dann eine befristete Regelung der Handelsbeziehungen zwischen beiden deutschen Staaten dort als »Währungsgebiete« bezeichnet–, die im September 1951 in ein befristetes Abkommen (»Berliner Abkommen«[Anmerkung 51]) umgewandelt wurde. Inhaltlich wurden die Handelsbeziehungen durch Warenlisten bestimmt, mit denen die Westseite festlegte, was importiert und was von der DDR exportiert werden durfte. Über diese Warenlisten gab es in der »Treuhandstelle für Interzonenhandel« zwischen den Beauftragten beider Seiten oft heftigen Streit. Vor allem westdeutsche Mittelständler fanden meist an ihren Behörden vorbei – Wege, um trotz fehlender Aufnahme ihrer Produkte in die Warenlisten mit den DDR-Außenhandelsbetrieben Geschäfte zu machen. Der Anteil des Handels mit der Bundesrepublik am Gesamtaußenhandel der DDR war eher gering, er betrug weniger als zehn Prozent. Für die BRD war dieser Handel vor allem ein politisches Instrument, um Einfluss auf die Politik der DDR auszuüben. Tatsächlich nutzten die BRD-Behörden oft gezielt die Steuerungsinstrumente des innerdeutschen Handels, um der DDR Wirtschaft bewusst zu schaden, indem wichtige, vereinbarte Warenlieferungen– etwa Walzstahl und Roheisen verweigert wurden. Aus rein politischen Gründen wurde am 30. September 1960 das gültige Berliner Abkommen durch die BRD »vorsorglich« gekündigt. Wiederum aus politischen Gründen wurde dann zum Jahresende mitgeteilt, dass der Handel fortgesetzt wird. Das zeigte, wie wenig berechenbar der innerdeutsche Handel für die DDR war. Hinzu kam im Januar 1961: Die BRD-Seite hatte einseitig eine Widerrufsklausel zu diesem Handelsabkommen festgelegt. Damit schuf Bonn die juristischen Voraussetzungen, um »wichtige Lieferungen« in die DDR stoppen zu können. Als Reaktion darauf forderte Ulbricht, die Volkswirtschaft der DDR »störfrei« zu machen. Diesem Umstand verdankte ich eine Moskau-Reise. Fritz Selbmann wurde beauftragt, mit der sowjetischen Seite darüber zu verhandeln, welche zusätzlichen Lieferungen aus der UdSSR bezogen werden können. Damit gleich die entsprechenden Importverträge abgeschlossen würden, nahm man einige Generaldirektoren von Außenhandelsbetrieben mit. Da Selbmanns Bemühungen jedoch wenig erfolgreich waren, konnten wir Generaldirektoren uns in aller Ruhe den Schönheiten der Stadt widmen. Ergiebiger waren die Ergebnisse zur Störfreimachung in der DDR-Industrie. Auch wenn es sich zumeist um teure Lösungen handelte, die Abhängigkeit wurde verringert. Auf der anderen Seite stiegen ab 1963/64 unsere Exporte in kapitalistische Länder. Auf Drängen der DDR konnten in den 60er Jahren die Hemmnisse im innerdeutschen Handel durch zähe Verhandlungen mit der BRD gemindert werden; Bonn ließ die Widerrufsklausel fallen. Von Bedeutung war die Vereinbarung eines Swings,[Anmerkung 52] der den gegenseitigen Warenaustausch beschleunigte. Bis 1972 verdoppelte sich das Handelsvolumen (im Vergleich zu 2,1 Milliarden D-Mark im Jahr 1960). 1972 wurden 5,3 Milliarden erreicht. Als Reaktion auf den westeuropäischen Integrationsprozess und den Marshall-Plan war im Januar 1949 der RGW gegründet worden. Das war mehr eine politische Demonstration als ein politisches Konzept. Das Gründungsdokument wies dem RGW weit reichende Verantwortung für die Planung zu, doch das Papier wurde nie ratifiziert. Tatsächlich ging es um eine Organisation der bilateralen Zusammenarbeit der beteiligten Staaten mit gleicher Wirtschaftsordnung und gleichen politischen Interessen. Von gleichberechtigten Vertretern sollten wirtschaftliche Erfahrungen ausgetauscht, gegenseitige technische Hilfe und der Austausch von Rohstoffen, Nahrungsmitteln und Maschinen sowie Ausrüstungsgegenständen organisiert werden. In der Folge wurden einige Entscheidungen zum Außenhandelsregime vereinbart, zum Beispiel auf der II. Tagung im August jene, dass dem Handel in den folgenden Jahren die Preise des Jahres 1949 zugrunde gelegt werden würden. An diesem Prinzip wurde auch während und nach dem Preisauftrieb infolge des Koreakriegs 1950-1953 festgehalten. Außerdem wurden die allgemeinen Lieferbedingungen für den Handel zwischen den Betrieben des RGW erarbeitet. Entscheidungen über eine gemeinsame Wirtschaftsplanung wurden jedoch nicht getroffen. Die DDR war 1950 dem RGW beigetreten. In den Jahren 1951 bis 1953 fanden keine Ratstagungen statt. 1954 wurden zwischen den RGW-Ländern die Großinvestitionen abgestimmt und 1955 die Zusammenarbeit durch die Koordinierung der Fünfjahrpläne 1956 1960 festgelegt. Auf der VII. Tagung des RGW-Rates im Jahr 1956 wurde die Tatsache kritisiert, dass auf der einen Seite die RGW-Staaten auf Lieferungen aus den kapitalistischen Ländern angewiesen waren, und andererseits die Hälfte der im RGW produzierten Maschinen technisch veraltet und faktisch für die Halde produziert worden waren. Danach begann eine systematische Arbeit der Organe des RGW, die in der Ausarbeitung und Bestätigung des Statuts des RGW im Dezember 1959 gipfelte. Mit diesem Statut wurde die bisherige Praxis festgeschrieben. Der organisatorische Rahmen wurde festgelegt, mit dem Exekutivkomitee und den ständigen Kommissionen zu einzelnen Arbeitsgebieten. Die Entscheidungskompetenz des RGW wurde nicht verändert: Die RGW Organe konnten lediglich Empfehlungen geben, verbindlich wurden die Entscheidungen erst nach der jeweiligen nationalen Zustimmung. Die nationale Souveränität der RGW-Länder wurde somit nicht angetastet. Tatsache aber ist: Die unzureichende Wirksamkeit des RGW behinderte das schnelle wirtschaftliche Wachstum der DDR. Die UdSSR war die Existenzbedingung der DDR. Sie sicherte seit 1957/58 die grundlegende Rohstoffversorgung der DDR. Daher bemühte sich Walter Ulbricht in vielfältiger Weise, die wirtschaftliche Zusammenarbeit beider Staaten zu verstärken. Ein Beispiel dafür war seine Forderung nach einem Zusammenwachsen der Wirtschaft der UdSSR und der DDR vom Februar 1962. Zu diesem Zweck sollten Fachleute der DDR bei Gosplan[Anmerkung 53] mitwirken und den Prozess beschleunigen. Es wurde sogar eine »Wirtschaftsgemeinschaft« zwischen der UdSSR und der DDR gefordert. Es ist davon auszugehen, dass es Walter Ulbricht vor allem darum ging, für eine schnelle Entwicklung der Produktion in der DDR die dafür erforderlichen Rohstoffe zu erhalten und das große wissenschaftliche Potenzial der UdSSR zu nutzen, um möglichst rasch auch das technische Niveau der DDR-Produktion zu erhöhen. Mit gleicher Zielstellung wurde von der DDR seit 1960 im RGW eine bessere Koordinierung bzw. Zentralisierung der Wirtschaftspolitik durch den Rat gefordert. Weitere Anstrengungen galten der besseren Rohstoffversorgung und der Entwicklung der Spezialisierung, der Forschungskooperation und der Standardisierung innerhalb des RGW. Die DDR wollte die Verantwortung des RGW bei der Entwicklung der ökonomischen Zusammenarbeit stärken und die internationale Arbeitsteilung der sozialistischen Länder vertiefen. Auf der XIV. Tagung des RGW im März 1961 hat Walter Ulbricht dazu seine Gedanken und Forderungen dargelegt. Er hoffte darauf, dass »bis 1980 das sozialistische Lager die wichtigsten kapitalistischen Länder hinsichtlich des Niveaus der Arbeitsproduktivität in allen entscheidenden Wirtschaftszweigen überholen« werde. Deshalb kritisierte er die fehlende Bilanzierung des Bedarfs an spezialisierten Erzeugnissen, die fehlende Koordinierung von Export und Import solcher Waren und die Tatsache, dass für die im RGW vereinbarten Spezialisierungen keine kommerziellen Verträge abgeschlossen wurden. Mit Blick auf Rumänien stellte er fest, dass einige RGW-Länder nur ein Nebeneinander und kein Miteinander anstrebten und sich darum einer effektiven Koordinierung und Bündelung der Kräfte verweigerten. Die Position der DDR war vom Bewusstsein gekennzeichnet, dass eine beschleunigte Entwicklung ihrer Industrie eine verlässliche Arbeitsteilung mit den Partnern im RGW verlangte. Das war kein nationaler Egoismus, sondern auch Ausdruck der Überzeugung, dass die Gemeinschaft nur durch das Erstarken der nationalen Volkswirtschaften gewinnen würde. Die im Juni 1962 von der XVI. Ratstagung beschlossenen »Grundprinzipien der internationalen sozialistischen Arbeitsteilung« definierten zwar die Rechtsbeziehungen im RGW, hielten aber zu wichtigen Themen die Entscheidung offen. Das größte ungelöste Problem hatte Chruschtschow im August und November 1962 thematisiert, als er vorschlug, alle RGW-Länder durch einen gemeinsamen Plan zu einigen und dafür ein zentrales Planungsorgan zu schaffen. Die DDR unterstützte diesen Vorschlag, andere RGW-Länder, etwa Rumänien, sprachen sich dagegen aus. Im Mai 1963 machte Ulbricht in einem Briefentwurf den Vorschlag, dass man zunächst beginnen sollte mit gemeinsamen Planungen »großer Investitionen und Ausrüstungen« auf dem Gebiet der Petrolchemie, der Kraftwerke, der Metallurgie, der Elektrotechnik und Elektronik sowie des Bauwesens. Der für RGW-Fragen verantwortliche stellvertretende Ministerpräsident Bruno Leuschner erhielt Kenntnis, dass ein vom Exekutivkomitee des RGW vorgeschlagener Bericht diese Vorschläge verwässerte, und informierte darüber die DDR-Regierung. Die Vertreter Rumäniens und Bulgariens hatten in ihrer praktischen Arbeit im RGW weitgehend die in den Dokumenten festgelegten Ziele missachtet und praktisch alle Vorschläge zur Vertiefung der ökonomischen Zusammenarbeit abgelehnt. Der Hauptgrund wurde im April 1964 öffentlich. Das ZK der rumänischen Arbeiterpartei hatte seine Bündnispartner wissen lassen, dass es »Eingriffe in die nationale Planungshoheit auch als solche in die politische Souveränität betrachtet«. Ulbricht flog daraufhin nach Bukarest, um die rumänische Führung zu überzeugen, dass eine gemeinsame Planung auch in ihrem Interesse läge. Vergeblich. Damit war die Diskussion zur Bildung eines gemeinsamen Planungsorgans beendet. Ein weiteres Thema der Tätigkeit des RGW in der Folgezeit betraf die Forderungen einiger RGW-Länder, Vereinbarungen zum gemeinsamen Handel zu verändern. Diese Diskussion wurde auch in Vorbereitung des Komplexprogramms geführt. Dazu wurden viele, zum Teil kaum verständliche Vorschläge gemacht: Ein Teil des gemeinsamen Handels solle auf der Basis freier, also konvertierbarer Devisen erfolgen, eine »eigene Preisbasis« müsse erarbeitet werden, es sollten Preiserhöhungen vorgenommen werden, die fern der Preise auf dem kapitalistischen Weltmarkt waren. Selbst eine Teilkonvertibilität des transferablen Rubel stand zur Diskussion. Die Durchführung dieser Vorschläge hätte zu einem marktwirtschaftlich orientierten System der Zusammenarbeit geführt. Diesen Vorschlägen war gemeinsam, dass sie im Widerspruch zum inneren System der Planung aller RGW-Länder standen bzw. grundlegende Veränderungen der nationalen Planungssysteme notwendig gemacht hätten. Die stabilen Handelsbeziehungen wären gestört worden, nicht zuletzt: Alles wäre mit Belastungen der DDR verbunden gewesen. Seine Meinung zu den Vorschlägen ließ Ulbricht 1968 Breshnew wissen: »Voraussetzung für eine stärkere Steuerung der internationalen Arbeitsteilung über die Zirkulationssphäre ist die engere Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem Gebiet, einer Währungskonvertibilität des transferablen Rubel muss die Warenkonvertibilität vorangehen.« An anderer Stelle sagte er: »Aber die Frage beginnt nicht bei der Frage des Handels und des Außenhandels, sondern bei den Fragen der Arbeitsproduktivität, des Standes von Wissenschaft und Technik, der Selbstkosten, des Weltniveaus und der Marktfähigkeit, des Niveaus der wirtschaftlichen Führung und einer exakten wirtschaftlichen Rechnungsführung.«
Günter Herlt: Künstler lieben nun mal die Kuh, die aus der Reihe tanzt
Günter Herlt, Jahrgang 1933, gelernter Zimmermann und Maurer, absolvierte die Arbeiter- und Bauern-Fakultät (ABF) in Weimar, um Architektur zu studieren. Er kam aber zum Rundfunk und sollte vier Jahrzehnte als Journalist für Hör- und Fernsehfunk der DDR arbeiten, darunter als stellvertretender Chefredakteur der Aktuellen Kamera und als Korrespondent des DFF in der Bundesrepublik. In den 80er Jahren verantwortete er die Fernsehreihe »Alltag im Westen«. Seit den 90er Jahren schreibt er. Seine publizistische Tätigkeit begann er als Kolumnist der von der edition ost bis 1996 herausgegebenen Wochenzeitung »Berliner Linke«. Wenn von Walter Ulbricht die Rede ist, fallen mir drei Begegnungen ein. Die erste war ungewollt und unerlaubt. Ich saß als Radioreporter im Ü-Wagen. Der Toningenieur testete die Mikrofone zur Live-Übertragung einer Kundgebung im tiefsten Winter. Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht kamen gerade auf die Tribüne. Walter brubbelte: »Ganz schön kalt! Gut, dass mir meine Frau noch den Schal mitgegeben hat!« Worauf Wilhelm Pieck gestand, dass er besonders dicke Unterhosen anhabe. Zwei belanglose Bemerkungen, die niemand draußen mitbekam. In meinen Ohren als gelernter Zimmermann klang es vertraut und sympathisch, dass da zwei ehemalige Tischler neben ihrem dicken Amt die gleiche dünne Haut wie alle anderen besaßen. Außerdem dachte ich: Wo Bauleute regieren, die wissen, mit wie viel Mühe und Geld bei Wind und Wetter ein Haus entsteht, da hat auch der Frieden ein gutes Zuhause. Die zweite Begegnung war sehr offiziell. Zur Leipziger Herbstmesse 1969 wurde in der Halle des Maschinenbaus der DDR die erste Datenfernübertragung vorgeführt. Wochenlang hatten Experten in Berlin und Moskau, Leipzig und Kiew an diesem Schlüsselprojekt zur weiteren ökonomische Integration im Verband der Bruderländer gebastelt: Eine technische Zeichnung in Kiew wird vom Rechenzentrum in codierte Daten verwandelt und geht als Steuerungsbefehl an die Werkzeugmaschine in der Messehalle. Das galt damals als technische Sensation. Ich hatte den Vorgang auf dem Bildschirm zu moderieren. Pünktlich erschien in der Halle die komplette Parteiführung mit Walter Ulbricht. Die Regie sagt: Achtung, wir starten! Ich erkläre den Vorgang und rufe die Außenstellen. Kiew meldet den Abgang der Signale. Das Rechenzentrum Karl Marx-Stadt bestätigt den Eingang, und einige Sekunden später surrt der Datenschreiber in der Messehalle. Das Papierband, das er ausspuckt, zeigt aber keine codierte Daten, sondern einen Klartext in Großbuchstaben: »Wir grüßen den Ersten Sekretär des ZK der SED, Genossen Walter Ulbricht, und wünschen unseren deutschen Freunden viel Erfolg bei der Erfüllung des Fünfjahrplanes!« Im Hintergrund springt die Maschine an. Ich nehme den Streifen und überreiche ihn gleich an den Adressaten. Ulbricht freut sich. Die Leute in der Halle klatschen. Die Sache ist gelaufen! Die beteiligten Minister klopften sich und mir auf die Schulter. Später wurden zwei Dutzend Orden »Banner der Arbeit« nachgereicht. Bei dem anschließenden Empfang flüsterte der leitende Ingenieur: »Großartig, wie du die Panne bei der Datenfernübertragung überspielt hast!« Ich fragte: »Welche Panne?« »Na, du hast doch gesehen, dass keine technischen Daten aus Kiew ankamen? Wir hatten noch die ganze Nacht geknobelt, aber keine kompatible Computersprache für diesen Auftrag gefunden. Dann fiel uns die Grußadresse als Notlösung ein, und die kam aus Karl Marx-Stadt und nicht aus Kiew, weil die Leitungen inzwischen zusammengebrochen waren.« Günter Mittag stellte sich trotzdem auf’s Podest. Potjemkin hätte salutiert. Ich weiß bis heute nicht, ob Walter Ulbricht etwas geahnt hatte, oder genau so getäuscht wurde wie alle anderen. Zur dritten Begegnung kam es Ende der 60er Jahre im Gebäude des Staatsrates. Ulbricht hatte den Fernsehintendanten Heinz Adameck angerufen und um ein Gespräch gebeten. Weil Adameck dachte, es ginge um ein Interview vor der Kamera, nahm er mich mit. Ulbricht hatte aber kein Interview im Sinn, nur eine Nachfrage. Daraus wurde ein »Arbeitsessen« zu viert: Walter und Lotte, Adameck und ich. Die beiden wollten wissen, warum so viele Werke der Fernsehdramatik mit ihren Themen und Konflikten so weit von den Spitzenleistungen des Landes und seinen Schrittmachern entfernt seien. Adameck erklärte, dass die Autoren viel im Stillen grübelten, meist abseits lebten, wenig Einblick hätten. Die Generaldirektoren und Forschungsleiter der Kombinate seien auch nicht sehr gesprächig. Und weil von der Idee bis zum Fernsehfilm allemal ein bis zwei Jahre vergingen, brauchten die Schöpfer einen ziemlichen Weitblick, um die Millionen Produktionskosten für einen Film nicht in den Sand zu setzen … Lotte erzählte, was sie schreiben würde, wenn sie schreiben könnte. Walter schlug vor, Exkursionen mit ausgewählten Autoren und Regisseuren zu organisieren, damit sie Feuer fingen. Er würde uns einige Türen und Panzerschränke aufschließen lassen, damit die Künstler einen Blick in jene Zukunft werfen könnten, die schon begonnen habe. Und darüber sollten sie dann schreiben und künstlerisch berichten. Ich beteiligte mich an einer Exkursion auf dem Lande. Da ging es um die automatisierte Großproduktion von Milch: zweitausend Kühe, Fütterung in individuellen Portionen per Computer, Reinigung und Melken auf Knopfdruck, mit nur zwei Leuten im klimatisierten Stall – einer am Melkkarussell und einer in der Steuerungswarte. Nach dem Gang durch die Seuchenschleuse, geduscht und in steriler Ganzkörperverkleidung wie in einem Operationssaal, marschierten wir zur Besichtigung. Die Kühe wurden per Signal aus ihren Boxen gerufen, formierten sich in stoischer Gelassenheit zum Gänsemarsch Richtung Melkanlage. Doch eine Kuh blieb plötzlich stehen, blickte zur Seite, sah eine offene Stalltür, schwenkte ab und trabte ins Freie. Der Chef der Milchfabrik war entsetzt. Doch die ganze Künstlertruppe war entzückt und spendete der »Abweichlerin« Beifall. Sie war der Held und lieferte das Thema – wie immer in der Kunst. Was hätte Walter Ulbricht gesagt, wenn er das miterlebt hätte? Und was erst Lotte!
Bernd Uhlmann: Ein moderner Mensch: ein sozialistischer Unternehmer
Bernd Uhlmann, Jahrgang 1939, Sohn einer tradionellen erzgebirgischen Unternehmerfamilie, Mitglied der NDPD seit 1962, Studium an der Karl Marx-Universität Leipzig von 1969 bis 1973, Abschluss als Diplomjournalist, Abteilungsleiter beim Sekretariat des Hauptausschusses der NDPD und Berater beim Vorsitzenden der NDPD. Mitglied des Büros des Zentralrats der FDJ von 1967 bis 1976, Vizepräsident der Freundschaftsgesellschaft DDR Finnland und Mitglied des Präsidiums der Freundschaftsgesellschaft DDR Großbritannien. Mein Vater hieß Carl Uhlmann, und er war Unternehmer. In der Erzgebirgsgemeinde Gornsdorf gab es ab 1500 Bergbau, dann kamen nach hundertfünfzig Jahren die Leine-, dann die Bortenweber, weil der Berg nichts mehr hergab, und weitere hundert Jahre später ließen sich die ersten Strumpfwirker im Dorf nieder. Die Textilindustrie entwickelte sich sprunghaft, nachdem der Ort ans Eisenbahnnetz angeschlossen worden war. Gornsdorf wurde ein Strumpfwirkerdorf. Und ich wuchs in einer Strumpfwirkerfamilie auf. Mein Urgroßvater, einst Handwerker auf der Walz, hatte mit einer Maschine begonnen und das Unternehmen begründet, die Fabrik wuchs und entwickelte sich, und 1945/46 wurde ein erheblicher Teil der Maschinen als Reparationsgut demontiert. So wurde zwar Platz für Umsiedlern, aber ein Teil der Hallen stand leer. Vater wurde Komplementär. Das heißt, der Staat stieg in die Firma mit ein, und Vater stellte mit Hilfe des Investors und eines Partners die Produktion um, denn Strümpfe gab es genug, aber die Elektronik war im Vormarsch. Also verlegte er sich auf die Produktion elektronischer Bauelemente. Auf der Frühjahrsmesse in Leipzig, im März 1963, präsentierte er sich erstmals mit den Erzeugnissen des Elektrogerätewerkes Gornsdorf. Am 7. März machte Ulbricht seinen obligatorischen Rundgang. Und blieb an diesem Stand stehen. Ulbricht ließ sich alles zeigen und erklären, und der dabeistehende Werkleiter Werner Hofmann berichtete auch über die Betriebsgeschichte und den Unternehmer, der nun die Produktion umgestellt habe. Ulbricht hörte aufmerksam zu und sagte: »Sie sind ein moderner Mensch, Sie gefallen mir.« So stand es denn anderentags im Neuen Deutschland und auch die von Ulbricht nachgereichte Begründung. »Was Sie getan haben, hat große Bedeutung. Wir werden in verschiedenen Produktionszweigen nicht einfach die vom Kapitalismus übernommenen Produktionen weiterführen können, weil sich die Absatzlage verändert hat. Wir müssen also zu neuen, modernen Produktionen übergehen. Man sieht, die frühere Einstellung der Unternehmer hat sich bei uns geändert. Sie sind jetzt moderne Menschen geworden und gehen zur Elektronik über.« Da ich zur selben Zeit in Leipzig studierte, traf ich am Abend meinen Vater, der sich dabei eines Auftrags entledigte. Ulbricht habe ihm zum Abschied gesagt: »Grüßen Sie alle Gornsdorfer.« Und da auch ich einer war, grüßte mich mein Vater von Walter Ulbricht. Dessen Feststellung, dass mein Vater ein »moderner Mensch« sei, veranlasste das Zentralorgan, Lieselotte Thoms[Anmerkung 54] nach Gornsdorf zu schicken. Ihr Beitrag (»Der moderne Mensch«) erschien am 13. April 1963 in der Kulturbeilage auf der Seite, die mit »Die gebildete Nation« überschrieben war. Der Text besitzt das idealistische Pathos jener Jahre, aber er macht die Motive deutlich und den Zeitgeist erlebbar, der in den 50er, 60er Jahre Unternehmer wie meinen Vater bewegte, sich der »neuen Zeit« anzuschließen. Und deshalb soll der exemplarische Beitrag nachfolgend in großen Teilen wiedergegeben werden: »Eigentlich geht es hier um zwei moderne Menschen: Sie heißen Carl Uhlmann und Werner Hofmann, sind gute Freunde und haben auf der Leipziger Messe Brüderschaft getrunken. Das hätte wiederum Werner Hofmann noch vor wenigen Jahrzehnten nicht für möglich gehalten, denn damals trennte die beiden eine tiefe Kluft, waren sie einander feind, auch ohne sich persönlich zu kennen«, so beginnt die Autorin dramatisch. »Beide sind im Erzgebirge geboren. Das war das einzige, was sie gemeinsam hatten. Denn Werner Hofmann war das Kind eines Chemnitzer Strumpfwirkers, der um ein paar Lohnpfennige immer wieder erbittert gegen seinen Unternehmer kämpfen musste und schließlich doch immer den kürzeren zog. Carl Uhlmann hingegen kam als Sohn eines Gornsdorfer Strumpffabrikanten zur Welt. Die Firma C. A. Uhlmann beherrschte und bestimmte damals das Leben in Gornsdorf. So sehr, dass man allgemein sagte, die Gornsdorfer Kinder werden auf Strümpfen großgezogen. Doch nicht an den Füßen trugen sie diese Strümpfe, sie gehörten ihnen nicht einmal. Gemeint waren die großen Strumpfpacken, Paar für Paar von den Eltern in mühsamer Heimarbeit gewirkt und groß genug, ein Kind darauf zu betten. Was der Fabrikant zahlte, reichte knapp zum Leben, geschweige denn für ein Kinderbett.« Das schien dann der Autorin doch zu simpel, zu schwarz und weiß und darum relativierte sie: »Mancher wird sagen, auch die Uhlmanns hätten einmal klein angefangen. Aber als sich der Großvater Carl die erste Maschine kaufte, sagte er: Die muss täglich 24 Stunden laufen. Hatte Carl seine zwölf Stunden daran gearbeitet, musste seine Frau aufstehen und ihr Teil übernehmen. Hart gegen sich und andere – so hat C. A. Uhlmann 1878 seine Firma gegründet und mit der Zeit aus der einen Maschine und der Arbeit anderer viele Maschinen, aus dem ersten Fabrikgebäude dann in den 20er Jahren einen ganzen geschlossenen Betriebskomplex gemacht, der hinfort in voller Größe auf den Briefbogen prangte und den Kunden in der weiten Welt das solide sächsische Unternehmen auch auf diese Weise vor Augen führte. Vom Großvater ging der Betrieb auf den Vater, von diesem auf Carl Uhlmann über. So konnte eigentlich auch die Familie Uhlmann sagen, sie sei ›auf Strümpfen groß geworden‹, nur dass es nie an einem Kinderbett fehlte in der Uhlmannschen Villa, dicht bei der Fabrik. Die Villa stand auf einer kleinen Höhe, gleichsam ein Symbol für die Position ihrer Bewohner. Als mittlere Fabrikanten und Kaufleute eng mit den Stätten der Produktion verbunden, waren sie doch ›oben‹, und die anderen waren ihnen untertan. Sie waren die Kapitalisten, jene die Arbeiter, sie die Ausbeuter, jene die Ausgebeuteten. Es führte keine Brücke über diese Kluft. Als Carl Uhlmann England bereiste, sich dort seine ersten Sporen als Kaufmann verdiente und eifrig strebte, genau in die Fußstapfen von Vater und Großvater zu treten, wurde der um acht Jahre jüngere Arbeitersohn Werner Hofmann Mitglied der sozialdemokratischen Jugendorganisation ›Rote Falken‹, weil er einmal ein besseres Leben führen und freier sein wollte als sein Vater. Das neue Leben begann 1945, und Werner Hofmann fühlte sich ganz in seinem Element. Kaum aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt, wurde er Mitglied der SED, lernte Elektromechaniker, studierte, wurde Bereichsleiter im Messgerätewerk Zwönitz und 1959 Werkleiter des volkseigenen Elektrogerätewerkes Gornsdorf, das jetzt das Leben und die Entwicklung des Ortes und seiner Umgebung bestimmte. Auch Carl Uhlmann war aus dem Krieg nach Gornsdorf zurückgekehrt. Ihm aber schien es, als sei nun alles aus. Die Demontage der Fabrik war schmerzlich, doch es blieb noch einiges, um wieder neu anzufangen. In der ›roten Fabrik‹, wie das ältere Gebäude im Unterschied zu den anderen grauen Betriebsbauten genannt wurde, begann die Firma C. A. Uhlmann wieder mit der Strumpfproduktion. Die übrigen Häuser vermietete man an einen volkseigenen Textilbetrieb, der später vom Elektrogerätewerk abgelöst wurde. Ja, jetzt herrschten die Arbeiter, jetzt schliefen ihre Kinder in richtigen Betten, und allmählich kam ein Wohlstand in ihre Häuser, in ihr Leben, von dem die Strumpfwirker von damals nie zu träumen gewagt hätten. Wer wollte es ihnen verdenken, wenn sie mit den früheren Herren nicht gerade zart umgingen? Zwar gehörten die Uhlmanns nicht zu den Großkapitalisten, sie wurden nicht enteignet und verjagt wie jene, die Faschismus und Krieg über die Welt gebracht hatten. Deshalb stand Carl Uhlmann dem jungen demokratischen Staat, in dem er lebte, nicht gerade feindlich, aber doch mit tiefem Misstrauen gegenüber. Als dieser Staat 1952 den Sozialismus auf seine Fahnen schrieb, dachte er: Jetzt werden sie uns auch bald die Luft abdrehen. Eines Tages schien es fast, als sollte er recht behalten, doch da war es die Arbeiterpartei selbst, die gewissen Überspitzungen beim sozialistischen Aufbau Einhalt gebot und erklärte, die Arbeiter-und-Bauern-Macht lege Wert auf die Produktion der privaten Betriebe, die den Bedarf der Menschen nach guten Waren befriedigen helfen. Das schien Carl Uhlmann noch ein Widerspruch, doch er griff nach jeder Möglichkeit, das Bestehen seines Betriebes zu sichern. Der Staat half ihm sogar dabei. Für bestimmte Spezialartikel, die C. A. Uhlmann herstellte, erhielt er staatliche Subventionen. Inzwischen war der Sohn Bernd herangewachsen, ging zur Oberschule und brachte stets die besten Noten heim. In alten Zeiten wäre es ganz selbstverständlich gewesen, dass er auch den Beruf seiner Väter ergriffen hätte. Aber er hatte eine ganz andere Begabung und andere Interessen. ›Ich möchte Journalist werden‹, sagte er zum Vater. Der wurde ein wenig traurig, wenngleich er sich an der Begeisterung des Jungen freute. Aus diesem Zwiespalt fragte er: ›Und in unserer Branche? Wäre das nichts?‹ ›Ach, das liegt mir nicht‹, meinte Bernd leichthin. ›Was habe ich da schon für eine Perspektive.‹ So bewarb sich Bernd bei der Journalistischen Fakultät in Leipzig zum Studium. Aber vorher musste er noch ein ›praktisches Jahr‹ absolvieren. In welchen Betrieb sollte er gehen? Das günstigste war schon das Elektrogerätewerk, es lag ja direkt vor der Haustür. Bernd machte die Arbeit im Betrieb Spaß, er verstand sich gut mit seinen Kollegen und half nebenbei tüchtig mit, eine Kulturgruppe der Jugend zu organisieren. Es war gerade die Zeit, da Werner Hofmann Werkleiter des Elektrogerätewerkes wurde. Carl Uhlmann allerdings schüttelte manchmal den Kopf. Da war nun der Sohn des Unternehmers in der Fabrik, in der einst Vater, Großvater und Urgroßvater über die Arbeiter geboten und die heute von einem Arbeitersohn geleitet wurde, selber Arbeiter geworden, damit ihn die Arbeiter dann zum Studium delegieren können – es war eine zu verzwickte Sache und besser, man dachte gar nicht weiter darüber nach. Doch seine Umwelt zwang Carl Uhlmann recht oft zum Nachdenken. Da hatten die Arbeiter ihren Sozialismus aufgebaut, und man war ganz unversehens mit hineingeraten. Er brauchte nur aus dem Fenster zu blicken, dann hatte er täglich das beste Beispiel dafür vor Augen: das Elektrogerätewerk. Aus dem Nichts war es innerhalb weniger Jahre zu einem Betrieb mit 1.300 Beschäftigten geworden und hatte die Elektrotechnik, einen ganz neuen Industriezweig, in diese Gegend gebracht. Das reckte sich gewaltig, nahm alle Gebäude und Räumlichkeiten des früheren Fabrikkomplexes ein. Und mitten im Gelände, in der roten Fabrik und in dem kleinen Verwaltungsgebäude am Werktor saß der private Unternehmer Carl Uhlmann, produzierte Strümpfe wie eh und je und dachte – halb bewundernd und halb zornig: Am liebsten würden die mich hier auch noch heraus haben. ›Die‹ hätten tatsächlich die rote Fabrik noch gut gebrauchen können, denn mittlerweile hatte das Elektrogerätewerk schon auf vier weitere Ortschaften, wo frühere Textilbetriebe frei wurden, seine ständig wachsende Produktion ausgedehnt. Auch in der Textilindustrie änderte sich ja manches. Andere Textilfabrikanten hatten staatliche Beteiligung aufgenommen und waren gut dabei gefahren. Aber mit der Strumpfproduktion war das noch etwas komplizierter. Mit dem Siegeszug der nahtlosen Strümpfe konzentrierte sich die Produktion immer mehr auf die Rundstrickautomaten in den großen volkseigenen Betrieben, das war dort rentabler. Carl Uhlmann bemühte sich vergeblich um eine staatliche Beteiligung. Wäre er an Stelle des Staates, er hätte auch kein sonderliches Interesse gehabt, in dieses Geschäft einzusteigen. Das verstand er als Geschäftsmann schon ganz gut. Und wenn er weiterdachte, dann hätte dieser Staat doch eigentlich zufrieden sein müssen, wenn so ein Privatunternehmer, der der Wirtschaft wenig nützt, ganz langsam und friedlich einging. Da sagten sie, der Sozialismus hat Platz für alle aber in seiner Branche würde das wohl doch nicht mehr lange gehen. Bei solchen Überlegungen lockte der Weg, den einige Strumpffabrikanten vor ihm gegangen waren, auch Carl Uhlmann manchmal gleisnerisch zum Betreten. Da war die 200 Jahre alte Firma ›Elbeo‹, Louis Bahner aus Oberlungwitz, die sich jetzt in Mannheim und Augsburg etabliert hatte, auch der ›Strumpfveteran‹ Werner Uhlmann – mit C. A. Uhlmann nur dem Namen nach verwandt – saß jetzt in Westdeutschland. Und da war vor allem Margaritoff, der Mann, der sich vom Strumpfschieber der Nachkriegszeit zum Millionär und Chef der Opal-Strumpfwerke in Schleswig Holstein emporgeschoben hatte. Vor einigen Jahren noch schätzte sich Carl Uhlmann glücklich, ihn zu seiner persönlichen Bekanntschaft zu zählen. Es war etwas Märchenhaftes um diesen Margaritoff. Er war der Mann, der seit Jahren die Schönheitsköniginnen in Westdeutschland ›kürte‹, die zwar als ›Miss Germany‹ proklamiert, aber in gewissen Kreisen nur ›Opal-Miss‹ genannt wurden. Er richtete sich für runde zwei Millionen Mark in Hamburg eine Alstervilla – Stilmöbel in den Gesellschaftsräumen, heizbarer Swimmingpool im Keller – ein, und wenn die Alsterdampfer daran vorüberfuhren, erklärten die Fremdenführer den gaffenden Touristen: ›Und hier, meine Herrschaften, wohnt Deutschlands Perlon-König Margaritoff.‹ Von ihm und den anderen las Carl Uhlmann manchmal in der westdeutschen Textil-Fachzeitschrift, die er abonniert hatte. Ich würde drüben kein allzu großes Unternehmen aufmachen, mehr so einen mittleren soliden Betrieb, dachte er bei dieser Lektüre. ›Man könnte aber dann gleich mit Rundwirkmaschinen anfangen. Denn die Umstellung von Cotton Wirkmaschinen auf Rundwirkmaschinen hatte auch in Westdeutschland die Situation in der Branche verändert. Der Unterschied bestand nur darin, dass dort 1960 bereits 35 kleinere und mittlere Strumpffabrikanten ruiniert worden waren, darunter auch der Namensvetter Werner Uhlmann. Die Großen fraßen die Kleineren, da war es wieder das Wolfsgesetz, unter dem einst sein Vater und Großvater gezittert hatten. In der Erinnerung an die Vorfahren pflegte Carl Uhlmann solche Überlegungen mit dem Gedanken zu beenden: Von Gornsdorf gehe ich nicht weg, ich bin nun einmal hier aufgewachsen. War es nicht doch mehr als das Heimatgefühl, das ihn hier hielt? War ihm der ganze Reklameballon, der in Westdeutschland um die Strümpfe aufgeblasen wurde, nicht ein wenig unheimlich? ›C. A. Uhlmann hat nie Reklame gemacht. Die Reklame liegt im Produkt‹, pflegten Vater und Großvater zu sagen. So hatte auch er es von ihnen übernommen. Hier, in den volkseigenen Betrieben, sagten sie: ›Meine Hand für mein Produkt.‹ Das war ein guter Grundsatz, mit dem man einverstanden sein konnte. Hier, in der Deutschen Demokratischen Republik, gab es keinen Konkurrenzneid und Konkurrenzkampf, und an diesen angenehmen Zustand hatte er sich schon sehr gewöhnt. Und schließlich war da noch der Junge, der Bernd. Er hatte Freude am Studium, gehörte zu den besten seiner Seminargruppe, war Mitglied der FDJ und wäre mit solchem Schritt des Vaters gewiss nicht einverstanden gewesen. So meinte Carl Uhlmann schließlich,drüben ist das Leben vielleicht in manchem angenehmer, hier aber sicherer. Immerhin ist schon fast die halbe Welt sozialistisch, und ihnen scheint nun einmal die Zukunft zu gehören. Und er tat ganz von selbst sein Teil, um die Deutsche Demokratische Republik vom Westen unabhängiger zu machen. Er stellte auf seinen Wirkmaschinen einen Artikel her, der vorher importiert werden musste und in der Fachsprache ›Netzbeinkleid‹ heißt. Es sind dies jene durchbrochenen Gebilde, von denen man nicht genau weiß, ob sie die schönen Beine leichtbekleideter Tänzerinnen eigentlich ver- oder enthüllen. Machte Carl Uhlmann sich seine Gedanken, so hatte sein ›Mieter‹, das Elektrogerätewerk und dessen Werkleiter Werner Hofmann nicht weniger zu überlegen. Der Bedarf an Bauelementen für die Nachrichtentechnik wuchs und wuchs. Für 1963 sah der Plan wiederum eine Steigerung vor, und Werner Hofmann wusste nicht, woher die Arbeitskräfte nehmen. Ihm machte das Wachstum des Neuen Kopfzerbrechen, Carl Uhlmann war das Herz schwer durch das Absterben des Alten. Doch der Weg, diese Gegensätzlichkeit schließlich in einen gemeinsamen Strom münden zu lassen, war schon gewiesen. Bereits auf der 3. Parteikonferenz hatte Walter Ulbricht im Hinblick auf die Privatunternehmer gesagt: ›Selbstverständlich gibt es Betriebe, die unnötige Waren produzieren – sogenannte Überplanbestände. In diesen Fällen ist es notwendig, sachlich zu prüfen, welche Umstellung der Produktion erfolgen kann. Das kann nicht auf bürokratische Weise geschehen.‹ Werner Hofmann erinnerte sich im Spätsommer 1962 nicht mehr genau an diese Worte, doch er blickte wiederholt aus dem Fenster auf das benachbarte rote Fabrikgebäude. Mehr als genug Platz böte es der neu hinzukommenden Produktion, die für die Wirtschaft notwendiger war, als das, was dort jetzt produziert wurde. Da kam ihm eine Idee. Freilich kannte er bisher keinen Fall, in dem geschehen wäre, was er jetzt vorhatte. Aber gleichviel: Dann sind wir eben die ersten! Bei diesem Gedanken klopfte er schon an die Tür des Uhlmannschen Kontors und kam ohne viel Umschweife mit seinem Vorschlag heraus: ›Wir müssen einen Teil unserer Produktion abgeben, es geht um Flachsteckverbindungen, die wir verlagern müssen. Da möchte ich zuerst Ihnen als Hausherrn das Angebot machen: Wollen Sie die Strümpfe aufgeben, diese Produktion übernehmen, und dann als halbstaatlicher Betrieb arbeiten?‹ Ein guter Geschäftsmann beherrscht seine Miene. Carl Uhlmann fragte knapp und sachlich nach einigen Einzelheiten, sagte nicht ja und nicht nein, sondern erbat sich drei Tage Bedenkzeit. ›Also bis Sonnabend. Und denken Sie daran, die neue Produktion liegt im Wert wesentlich höher als Ihre jetzige. Trotzdem würden Sie mit Ihren Arbeitskräften auskommen.‹ Damit ging der Werkleiter und ließ den Unternehmer in einem heftigen Durcheinander von Gefühlen und Überlegungen zurück. Die Strümpfe einfach aufgeben, wo die Firma seit fast 85 Jahren besteht? Mit der alten Familientradition brechen? Das war kaum denkbar. Wenn aber meine Fabrikation nun wirklich keine Perspektive mehr hat? Elektronik dagegen wäre eine Sache der Zukunft. Aber umstellen mit meinen Arbeitskräften, meistens ältere Leute? Was würden sie sagen, wenn es heißt: Abschied nehmen von den Strümpfen? Was würden Vater und Großvater dazu meinen? Vielleicht: Man muss mit der Zeit gehen … ›Man muss mit der Zeit gehen‹, lächelte Carl Uhlmann, als er am Sonnabend dem Werkleiter Werner Hofmann sein Ja-Wort gab. ›Gratuliere‹, sagte der, als sei er tatsächlich auf einer Hochzeit, ›dann können wir gleich anfangen. Passen Sie auf, wir beide werden das Kind schon schaukeln.‹ Von da ab hielt die Sache Carl Uhlmann ständig in Atem. Da musste die Umstellung mit dem Rat des Kreises geregelt werden, das machten sie gemeinsam. Da half das Elektrogerätewerk einen Saal auszuräumen, einige Maschinen wurden im Nebenraum zusammengerückt, andere wurden zu Schrott, aber für Abschiedsschmerzen war keine Minute Zeit. Die westdeutsche Textil Fachzeitschrift konnte jetzt auch abbestellt werden. Gerade in einer der letzten Nummern hatte gestanden, dass der Perlonkönig Margaritoff mit einem gewaltigen Krach in Konkurs gegangen war. Nachdem sie die kleinen verschluckt hatten, fraßen sich jetzt die großen Haie gegenseitig auf. Carl Uhlmann konstatierte es mit einer gewissen Befriedigung – er hatte doch dem Besseren sein Ja-Wort gegeben, damals schon und heute erst recht. Nun begann die Umschulung der Belegschaft. Fünf Arbeiter und Arbeiterinnen der Firma hielten Einzug in den Meinersdorfer Zweigbetrieb des Elektrogerätewerkes, der gegenwärtig noch die Flachsteckverbindungen produzierte, und wurden dort angelernt. Das sprach sich mit Windeseile in der Gegend herum. ›Ich kann mich im Augenblick vor Anrufen aus Geschäftskreisen nicht retten‹, seufzte Carl Uhlmann in einem Gespräch mit dem Werkleiter. ›Alle sind interessiert, alle fragen: Wie soll das ablaufen? Was produzierst du? Was gewinnst du da? Hoffentlich haben sie dir nicht den Schwarzen Peter zugeschoben!‹ ›Den bestimmt nicht‹, lachte Werner Hofmann. Aber da stand der Augenblick kurz bevor, an dem Carl Uhlmann doch glaubte, er habe jetzt den Schwarzen Peter in der Hand. Anfang Dezember kam Heiner Drechsele, der kaufmännische Direktor des Elektrogerätewerkes, zu ihm und sagte: ›Herr Uhlmann, wir bestätigen jetzt die Verträge für 1963. Auch Sie müssen Ihre Verträge unterschreiben.‹ ›Unterschreiben? Ich? Wo überhaupt noch nichts da ist?‹ Entgeistert starrte Carl Uhlmann auf die Papiere. Jetzt legen sie dich doch rein, dachte er. Zunächst fragte er das Vertragsgericht– dort warnte man ihn vor dem Unterschreiben. Dann rief er seinen Notar an. ›Kommt gar nicht in Frage!‹ sagte der. Schließlich kam es zur Verhandlung. Sie saßen fast bis Mitternacht in C. A. Uhlmanns Kontor: Werner Hofmann und die Mitarbeiter vom Rat des Kreises, Carl Uhlmann und seine Rechtsberater. ›Meine Herren, Sie müssen doch verstehen: Ich habe fünf Mann seit drei Tagen in der Umschulung und weiter nichts, kann mir überhaupt noch nicht richtig vorstellen, wie das alles laufen soll, und da soll ich mich festlegen auf eine Produktion, die das Vierfache dessen ausmacht, was mein Betrieb bisher im Jahr geleistet hat?‹ ›Aber wir unterstützen Sie doch in jeder Weise. Sie können am 1. Januar mit der Produktion beginnen‹, hielten ihm die anderen entgegen. ›Zunächst stellt Ihnen das Werk die wichtigsten ingenieurtechnischen Kader, einen Technologen und einen Gütekontrolleur zur Verfügung‹, redete Werner Hofmann dem Zögernden zu. ›Dann kommt jetzt ein sehr tüchtiger junger Meister zu uns, den überlassen wir gleich Ihnen.‹ Nichts half. Carl Uhlmann spielte seinen höchsten Trumpf aus: ›Und wer zahlt die Vertragsstrafe, die ich aufgebrummt bekomme, wenn ich den Plan nicht erfülle?‹« So ging es denn in der Schilderung von Lieselotte Thoms dramatisch hin und her, am Ende wurde unterzeichnet. »Dann kam der Tag der Begegnung mit Walter Ulbricht. Werner Hofmann erklärte dem Vorsitzenden des Staatsrates, was sich seit dessen Besuch in Gornsdorf vor zwei Jahren dort alles geändert hat. Ganz selbstverständlich gehörte Carl Uhlmann mit dazu. Vor zwei Jahren, ging es dem durch den Kopf, durfte ich nicht dabeisein. Da habe ich hinter dem Fenster gestanden und gesehen, wie Walter Ulbricht daran vorbeiging. Beinah hätte er über diesen Erinnerungen die Vorstellung verpasst. Er hörte gerade noch rechtzeitig Walter Ulbricht fragen: ›Wo ist er denn?‹ ›Er steht neben Ihnen!‹ sagte Werner Hofmann. ›Sie sind ein moderner Mensch, Sie gefallen mir! Was Sie getan haben, hat große Bedeutung‹, sagte Walter Ulbricht. Dieses Wort hat, wie zu Beginn gesagt, allerlei Furore gemacht. Aber am meisten beeindruckt war Carl Uhlmann eigentlich von etwas anderem. Im Gespräch fragte Walter Ulbricht ihn: ›Da produzieren Sie wohl in dem roten Gebäude?‹ Er nickte ganz entgeistert: ›Das wissen Sie noch?‹ Später sagte er zu seinemSohn Bernd, mit dem er in Leipzig zusammen war: ›Ich hätte nie für möglich gehalten, dass ein Mann, der soviel im Kopf haben muss, sich noch nach zwei Jahren an unsere rote Fabrik erinnert.‹«
Horst Sölle: Gepäckarbeiter auf dem Bahnhof, dann Außenhandelsminister
Horst Sölle, Jahrgang 1924, nach Rückkehr aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft Eintritt in die SPD, 1946/47 Besuch der ABF in Leipzig, danach Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Leipziger Universität. Anschließend Instrukteur im Ministerium für Verkehrswesen, schließlich Abteilungsleiter für Handel, Versorgung und Außenhandel des Zentralkomitees der SED. Von 1963 bis 1965 Staatssekretär im Ministerium für Außenhandel und innerdeutschen Handel, danach bis 1986 Minister. Von 1986 bis 1989 als stellvertretender Ministerpräsident, zuständig für die Zusammenarbeit der DDR mit dem RGW. Von 1963 bis 1976 Kandidat, danach bis 1989 Mitglied des ZK der SED. Seit dem Jahre 2000 befindet sich Horst Sölle in einem Seniorenheim in Zeuthen. Horst, vom Gepäckarbeiter zum Minister – eine interessante, aber durchaus nicht einmalige DDR Biografie. Fangen wir mit der Frage an, wie es dazu kam, dass du 1950 gleich nach dem Studium Instrukteur im Ministerium für Verkehrswesen geworden bist? Mein Vater war bei der Deutschen Reichsbahn, da wollte ich auch zur Bahn. Er war in der SPD. Ein Grund dafür, dass ich im August 1945 nach der vorzeitigen Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft (ich war völlig entkräftet und krank) ebenfalls dieser Partei beitrat. Eine innere Beziehung hatte ich zu ihr nicht. Deshalb habe ich auch die Vereinigung mit der KPD aktiv mitgetragen. 1946 wurde ich Mitglied der SED. Nach meiner Bewerbung bei der Bahn wurde ich zunächst Gepäckarbeiter auf dem Leipziger Bahnhof, d. h. ich beförderte mit einer Eidechse Koffer, Taschen und anderes Reisegut. Dass ich gleich nach meinem Studium ins Ministerium berufen wurde, hing damit zusammen, dass die junge Republik überall Kader brauchte. Das Verkehrsministerium, das nach der Gründung der DDR entstanden war, freute sich, dass mit mir ein »Fachmann« kam. Doch nach etwa anderthalb Jahren wurde ich ins Ministerium für Außenhandel delegiert. Deine Geburtsstadt ist auch die von Walter Ulbricht. Wann hast du ihn zum ersten Mal getroffen? In den 40er Jahren, als ich noch in Leipzig arbeitete und studierte, sah ich ihn ein paar Mal auf öffentlichen Veranstaltungen. Er hat mich durch die Konkretheit seiner Reden beeindruckt. Später, als ich im ZK arbeitete und dort auch Mitglied war, sah ich ihn nicht nur öfter, sondern sprach mit ihm. Mitte der 50er Jahre, als Heiner Rau Minister für Außenhandel und Innerdeutschen Handel wurde – was er bis zu seinem Tod im Frühjahr 1961 blieb – schickte mich Ulbricht dorthin. Von Heinrich Rau, einem erfahrenen Gewerkschafter und Kommunisten, der im Spanischen Bürgerkrieg auf der Seite der Republik kämpfte, habe ich viel gelernt, vor allem Menschenführung. Seit ich im Ministerium für Außenhandel arbeitete, traf ich Ulbricht immer bei den Rundgänge auf der Frühjahrs- und Herbstmesse in Leipzig. Du hast seit 1963 dem ZK als Kandidat angehört. Gibt es von damals Erinnerungen? Ich habe auf dem VI. Parteitag 1963 zur Diskussion gesprochen. Walter Ulbricht unterbrach mich mit der Bemerkung: »Das ist unser neuer Außenhandelsminister.« Ich war aber damals lediglich Staatssekretär. Minister war seit 1961 Julius Balkow. Das Interessante: Dieser hatte fünf Jahre zuvor auch als stellvertretender Minister begonnen. Ulbricht wollte mit seinem Zwischenruf wohl auf meine mögliche Perspektive hinweisen. Jedenfalls haben das damals die Mitarbeiter des Ministeriums so verstanden. Aber offen gesagt: Für Walter Ulbricht war in Außenhandelsfragen damals weniger der Minister und sein Stellvertreter oder Staatssekretär Ansprechpartner, sondern Ernst Lange. Dieser leitete bereits seit Jahren die Abteilung Handel und Versorgung im Zentralkomitee (später Handel, Versorgung und Außenhandel). Der hatte die größere Erfahrung. Außenhandel war zudem in den 60er Jahren wichtig, aber nicht das wichtigste Feld. Da ging es vor allem um die Störfreimachung unserer Volkswirtschaft, also um die Reduzierung der Abhängigkeit von Lieferungen aus dem Westen. In der Vergangenheit war die Wirtschaft der DDR immer wieder unter Druck der BRD geraten: So hatte Ende 1960 Bonn kurzfristig das Handelsabkommen mit der DDR zum gekündigt. Solche politisch absichtsvollen Angriffen auf die wirtschaftliche Entwicklung unserer Republik mussten minimiert werden. Wir Außenhändler hatten dafür sorgen, dass wir bei verlässlicheren Partnern Waren und Rohstoffe bekamen. Wie hast du Ulbricht als Staats- und Parteichef wahrgenommen? Er war ein Souverän im positiven Sinne. Das Dilemma begann, als er alt und krank wurde. Wenn er eine feste Meinung zu einer Sache hatte, konnte man davon ausgehen, dass er sich vorher belesen und mit Fachleuten beraten hatte. Er war sehr kritisch. Schönfärberei mochte er nicht. Hast du Ulbricht auf Auslandsreisen begleitet? Hier habe ich ein Foto vom Staatsbesuch in Ägypten, auf dem du zu sehen bist. Nein, nein, ich bin auf keiner Auslandsreise Ulbrichts dabei gewesen. Jenes Bild aus Ägypten zeigt den Hinterkopf eines Mannes, den eine Zeitung in der Bildunterschrift fälschlich als meinen bezeichnete. Es handelte sich aber um Herbert Weiß, zu jener Zeit Stellvertretender Außenhandelsminister wie ich. Mich interessieren die Messerundgänge Walter Ulbrichts. Waren das nur Fototermine an den Ständen? Nein, er führte inhaltliche Gespräche. Die Rundgänge waren keine Protokollveranstaltungen, sondern in der Regel Erfahrungsaustausche, wie sowohl die Innen- als auch Außenversorgung geleitet werden müssen. An den Ständen von BRD-Firmen stellte er am häufigsten die Frage – ich habe sie noch heute im Ohr: »Was haben Sie für Konzeptionen?« Damit meinte er natürlich deren deutschlandpolitische Überlegungen. Und daran knüpften wir dann bei unseren Besuchen auf der Hannover-Messe an. Die Hannover Messe ist ja bekanntlich 1947 als Antwort auf die Leipziger Messe in der Sowjetischen Besatzungszone gegründet und dann bewusst als Konkurrenz zur DDR-Messe entwickelt worden. Dazu warb man nicht wenige Messeleute aus Leipzig ab. Kannst du dich erinnern, wie Ulbricht zu Willy Brandt stand? Positiv und aufgeschlossen. Er sah in ihm einen Sozialdemokraten, der Widerstand gegen Hitler geleistet hatte. Dass er Regierungschef in Bonn wurde, nahm er als etwas Neues in der Entwicklung der Bundesrepublik. Ulbricht hielt ihn für einen wichtigen Faktor bei der von ihm angestrebten Normalisierung der Beziehungen zwischen der DDR und der BRD, als die Frage nach Herstellung der deutschen Einheit oder einer Konföderation nicht mehr stand. Ich komme zu meinem Ausgangspunkt zurück: Du bis innerhalb weniger Jahre vom Bahnhofsarbeiter über den Hochschulabsolventen zum Stellvertretenden Ministerpräsidenten der DDR aufgestiegen. Wie war das möglich? Natürlich hing das ursächlich mit den Bedingungen in der DDR zusammen, dass man – es war ja keine Phrase – der Jugend Vertrauen schenkte und ihr große Aufgaben übertrug. Fördern und fordern war Praxis. Speziell bei mir war es so, dass ich als 39-jähriger ZK-Instrukteur 1963 ins Ministerium geschickt wurde, um im Außenhandel der DDR als Staatssekretär das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung umsetzen zu helfen. Aber irgendwann kamen wir mit dem NÖS an einem Punkt, wo es so nicht mehr weiterging. Die Betriebe reklamierten bald alle Erlöse für sich bzw. die Entscheidung über deren Verwendung, so dass letztlich für den Staatshaushalt nichts mehr übrigblieb. Das wäre zu regeln gewesen, aber man machte daraus ein Fiasko und lastete es Ulbricht an, der sich in seiner letzten Lebensphase befand. Das hielt ich für unfair. Als Minister für Außenhandel der DDR warst du doch auch diesen restriktiven Maßnahmen der NATO unterworfen: Wer dienstlich in den Westen wollte, musste das in Berlin im Travel Board Office beantragen. Bis 1970. Ja. Aber ich war wohl der erste DDR Bürger, der das bewusst nicht mehr mitmachte. Ich fuhr einfach zur Hannover-Messe, ohne dass ich eine Genehmigung bei den Westalliierten einholte. In dieser Zeit musste man manchmal auch völlig unkonventionelle Wege gehen, um die Interessen der DDR zu vertreten. Aber du hast Recht: Man schikanierte uns, wo man konnte. Der DDR sollte überall geschadet werden. Du kennst ja auch den Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe von innen. Was war am RGW gut, was war schlecht? Schlecht war die Existenz des Kapitalismus. Er schadete nicht nur uns, sondern allen sozialistischen Ländern. Der RGW war ein wichtige Einrichtung, um die Wirtschaft der sozialistischen Länder zu koordinieren und auch die Angriffe des Westen abzuwehren. Der richtige Versuch, eine auf gemeinsamen politischen Interessen fußende wirtschaftliche Gemeinschaft zu entwickeln, scheiterte aber auch an den nationalen Interessen einzelner Mitgliedsstaaten. Der Westen vermochte es, mit seinem Geld den Egoismus zu forcieren, indem er bilaterale Beziehungen zu den einzelnen Staaten entwickelte und sich diese dadurch eigene Vorteile versprachen. Man wollte lieber harte, konvertierbare Währung, mit der man auf dem Weltmarkt alles kaufen konnte – ohne zu begreifen, dass man sich dadurch in Abhängigkeit begab, der man kaum mehr entkam. Innerhalb des RGW funktionierten allenfalls – und in der Gorbatschow-Zeit selbst das mit Einschränkungen – die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der DDR und der UdSSR. Wir jedenfalls nahmen die von uns eingegangenen Verpflichtungen immer sehr ernst. Zudem: Ohne die Rohstoffe aus der UdSSR wäre die DDR-Wirtschaft nicht lebensfähig gewesen. Mein Partner in der Sowjetunion war Außenhandelsminister Nikolai S. Patolitschew. Ein großartiger Mensch. Wir hatten ein ausgezeichnetes Verhältnis. Er sagte einmal: Unsere Verbündeten können in der Wirtschaft experimentieren wie sie möchten. Wenn es schiefgeht, sind noch immer wir zum Helfen da. Aber bei uns darf nichts passieren. Walter Ulbricht war ein Könner bei der Koordinierung nationaler und internationaler Interessen.
Herbert Weiz: Ohne Fortschritt in Wissenschaft und Technik gibt es auch keinen gesellschaftlichen Fortschritt
Herbert Weiz, Jahrgang 1924, nach Rückkehr aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft am 1. Januar 1945 Einritt in die KPD. Von 1946 bis 1949 Studium an der Friedrich Schiller-Universität Jena, Promotion, Tätigkeit im Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes Thüringen. Danach, von 1951 bis 1953, Abteilungs- bzw. Werkleiter des VEB »Optima« Büromaschinenwerk Erfurt, bis 1955 Leiter der Hauptverwaltung Leichtmaschinenbau im Ministerium für Maschinenbau, bis 1962 1. Stellvertreter des Werkleiter im VEB Carl Zeiss Jena und Mitglied des Forschungsrates der DDR, anschließend bis 1967 Staatssekretär für Forschung und Technik. Fernstudium an der Technischen Hochschule Dresden und 1955 Abschluss als Ingenieur-Ökonom. Mitglied des ZK der SED von 1958 bis 1989. Seit 1963 Abgeordneter der Volkskammer, ab 1967 stellvertretender Vorsitzender des Ministerrates und von 1974 bis 1989 Minister für Wissenschaft und Technik. Du bist Absolvent der Arbeiter-und Bauern-Fakultät in Jena. Diese Vorstudienanstalten, wie sie von 1946 bis 1949 hießen, hat Walter Ulbricht mit auf den Weg gebracht. Welche Rolle spielten sie aus deiner Sicht? Eine ganz wesentliche bei der Brechung des sogenannten Bildungsprivilegs. Die ABF ermöglichte jungen Menschen, die aus Kreisen kamen, in denen der Zugang zu Hochschulen und Universitäten bis dahin aus finanziellen Gründen nicht denkbar schien, eine angemessene Qualifikation. Die Arbeiter-und-Bauernfakultäten bestanden bis 1963, ich war einer der rund 30.000 Absolventen. Ich habe dort nach zwei Jahren das Abitur gemacht, das war 1948, dann mit dem Studium der Wirtschaftswissenschaften begonnen. Die Entwicklung der »neuen Intelligenz« in der DDR erfolgte zu großen Teilen über die ABF. Und dass Ulbricht darauf maßgeblich Einfluss genommen hatte, wurde mir bewusst, als ich ihn kennenlernte. Bildungsfragen hatten bei ihm immer einen sehr hohen Stellenwert. Dass damals, während des Studiums in Jena, noch Klassenkampf an der Universität herrschte, habe ich selber erfahren. Die Studenten mit bürgerlicher Herkunft nannten uns abschätzig »Mistgabelstudenten« und ließen sich mit »Sie« und »Herr Kommilitone« anreden. Mit einem von ihnen musste ich einmal eine Seminararbeit anfertigen, und er bestellte mich zu sich. Dort wurde ich von der Polizei erwartet. Man hatte ihn kurz zuvor verhaftet, denn er arbeitete in einer Gruppe, die sehr aktiv gegen die neue Ordnung wühlte. Man hielt mich für ein Mitglied dieser Gruppe und steckte mich, obgleich doch Mitglied der Partei, in eine Zelle. Irgendwann haben sie mich aber entlassen und sich bei mir entschuldigt. Wann hast du zum ersten Mal mit Ulbricht zu tun gehabt? Anfang der 50er Jahre, ich war einer von 21 Werkleitern volkseigener Betriebe, die sich gegenüber dem DDR Präsidenten verpflichtet hatten, binnen eines Jahres ihren Betrieb rentabel zu machen, also aus den roten in die schwarzen Zahlen zu führen. Ich meine persönlich. Das war später, auf einem Plenum, da war ich noch bei Zeiss, also in der zweiten Hälfte der 50er Jahre. Ulbricht erklärte in seiner Rede, dass Zeiss den neuen Rechner ZAR-1 produziere. Aber das traf nicht zu. Der Rechner war erst in der Entwicklung. In der Pause ging ich zu ihm: »Genosse Ulbricht, das stimmt nicht, was Sie da gesagt haben, das darf nicht in die Zeitung.« In der nächsten Pause holte er mich zum Gespräch. Warum ich ihn vorhin darauf angesprochen habe, wollte er wissen. – Weil ich für die Wahrheit sei und nicht wolle, dass sich die Partei blamiere, antwortete ich. Das habe ich sehr gut gemacht, sagte er. »Wir müssen immer offen und ehrlich sein. Und so sollten wir es künftig miteinander halten. Selbst wenn die Wahrheit unangenehm ist oder sogar schmerzt.« Das war der Beginn einer engen Beziehung. Als ich dann in Berlin war, rief er selber regelmäßig bei mir an, um sich nach diesem oder jenem zu erkundigen. Als das zum ersten Mal geschah, meldete meine Sekretärin, Ulbricht aus dem Ministerium – wir hatten einen Mitarbeiter dieses Namens – habe mich zu sprechen wollen, worauf sie ihm beschied, dass ich jetzt für ihn keine Zeit habe. Der Irrtum klärt sich rasch auf. Kurz, sie konnte sich nicht vorstellen, dass Walter Ulbricht einfach so bei mir anrief. »Sag, ich habe hier gelesen ...« oder »Ich habe die und die Information bekommen ...«, begann er meist. »Was meinst du dazu?« Das gefiel mir, es zeigte mir, wie intensiv er sich mit wissenschaftlichen und technischen Fragen beschäftigte und wie stark sein Interesse an diesen Themen war. Oder ich erinnere mich der Vorbereitung eines Parteitages. Es war Sommer, er zog sein Jackett aus und stellte sich vor unserer Arbeitsgruppe und erklärte, was er in von uns für seine Bericht brauchte. Sein konzeptionelles Denken überzeugte mich, man muss in der Wissenschaft weit vorausdenken, und das konnte er. Er hat mir in dieser Hinsicht sehr imponiert. So wie unter Ulbricht wurden später nie wieder wissenschaftliche Grundlagen und angewandte Forschung gefördert. Er hatte begriffen: ohne wissenschaftlich-technischen Fortschritt gibt es keinen gesellschaftlichen Fortschritt. Im Krisenjahr 1953 warst du, noch keine 30 Jahre alt, Werkleiter des VEB »Optima« Büromaschinenwerk Erfurt. War das ein großer Betrieb? Etwa 4.000 Werktätige. Wie hast du dort den 17. Juni erlebt? Offen gestanden: Ich war völlig überrascht, weil ich glaubte, dass in unserer Belegschaft alles in Ordnung sei. Ich war in einer Sitzung und bekam die Mitteilung, dass sich die Arbeiter und Angestellten auf dem Betriebshof versammelt hätten und streikten. Zunächst nahm ich an, dass sie mit meiner Leitungsarbeit nicht einverstanden seien. Ich ging auf den Hof, auf dem gerade gebaut wurde, kletterte auf einen Schutthaufen und rief: »Was wollt ihr von mir, was habe ich falsch gemacht?« »Von dir wollen wir nichts, riefen sie. Wir sind nicht mit der Politik in Berlin einverstanden, die Regierung soll zurücktreten!« Es kamen auch einzelne Rufe »Ulbricht muss weg!« Ich nehme das zur Kenntnis, sagte ich, aber nun sollten sie wieder an ihre Arbeit gehen. Den Betrieb verlasse niemand – es sei denn über meine Leiche! Dann habe ich mich vors Werktor gestellt. In dem Moment fuhren sowjetische Panzer vor. Ein Offizier rief auf Deutsch, was hier los sei. (Später erfuhr ich, dass die Belegschaften des Funkwerkes und des VEB Schwermaschinenbaus bereits auf der Straße marschierten.) Der Russe forderte mich auf mitzukommen, um angeblich die Lage mit mir zu besprechen. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass ich erstens die Sache im Griff habe, und zweitens, dass das falsch verstanden werden könnte, wenn sie mich mitnehmen würden. Der Offizier ließ sich jedoch nicht irritieren und brachte mich zur Kommandantur. Dort wurde ich befragt, wie ich die Lage einschätze. Die Leute seien vernünftig, versuchte ich ihnen begreiflich zu machen, man müsse nur ordentlich mit ihnen reden. Darum sollten sie mich besser gehen lassen. Inzwischen aber forderten die Arbeiter in meinem Betrieb nicht mehr, dass Ulbricht und die Regierung wegmüsse, sondern dass die Russen ihren angeblich verhafteten Werkleiter Weiz freilassen sollten. Da merkten die Sowjets auch, dass sie einen Fehler begangen hatten und brachten mich zurück. Auf dem Werkhof wurde ich mit Beifall wie ein Held begrüßt. Ich bedankte mich und wiederholte meine Bitte: Geht an die Arbeit! Wenn wir besser leben wollen, geht das nur mit ordentlicher Arbeit. Das verstanden sie und nahmen die Arbeit wieder auf. Wie erklärst du dir die massive Ablehnung von Ulbricht damals? Ich glaube, dass das in erster Linie die Folge massiver Hetze aus dem Westen war. Ulbricht war ein sehr kluger, weitdenkender Politiker, ich habe ihn persönlich sehr geschätzt. Aber er hatte einen gravierendes Manko: die Sprache. Und das hat der Gegner gnadenlos ausgenutzt und ausgeschlachtet. Er machte es wie immer: das ganze Feuer auf die wichtigste Person richten, denn damit hofft man die ganze Bewegung empfindlich zu treffen. Denken wir an Liebknecht/Luxemburg, Lenin, Thälmann … Der Gegner war in dieser Hinsicht vielleicht klüger als die meisten von uns: Er begriff sehr früh, dass Ulbricht der überragende politische Kopf in der DDR war. Und deshalb musste er weg. Selbst in der Partei blieb die permanente Hetze nicht ohne Wirkung. Viele Genossen, die Ulbricht gar nicht kannten, plapperten diesen Unsinn vom machthungrigen, unbelehrbaren Dogmatiker, dem autoritären Herrscher und Diktator von Moskaus Gnaden nach. Ulbricht pflegte ein sehr gutes Verhältnis zu Wissenschaftlern, die zur Elite der deutschen Naturwissenschaftler gehörten, etwa den Physiker Max Volmer,[Anmerkung 55] dem , Peter Pionier der Quantenmechanik, Nobelpreisträger Gustav Hertz[Anmerkung 56] Adolf Thiessen[Anmerkung 57] und andere. Worauf gründeten diese Beziehungen? Er hatte ja nicht nur zu den genannten und anderen Personen ein positives Verhältnis, sondern zur Wissenschaft insgesamt. Meine erste Aufgabe in Berlin bestand darin, im Herbst 1962 eine Sitzung des Forschungsrates zu den Aufgaben von Wissenschaft und Technik vorzubereiten, auf der Ulbricht sprechen wollte. Alle Forschungsratsmitglieder etwas über 100 Personen – wurden eingeladen, wir kamen im Ministerrat in einem großen Saal zusammen, ich leitete die Tagung. Die Rede hinterließ einen großen Eindruck bei allen, die Wissenschaftler waren sichtlich angetan von Ulbricht, manche geradezu begeistert. Es war, wie ich im Nachgang fand, von Ulbricht eine sehr kluge Entscheidung, vor diesem Gremium aufzutreten. Er löste sich oft von der Rede, machte Bemerkungen wie diese, dass er es wie die Königin Juliane der Niederlande halte: Wenn die wissen wollte, was das Volk denkt und bewegt, fragt sie nicht ihre Berater, sondern die Betreffenden selbst. Darum konsultiere er, wenn er wissen wolle, wie es um Wissenschaft und Technik und deren Fortschritt im Lande und in der Welt bestellt sei, eben »Sie, meine Damen und Herren«, und nicht seine Berater. Das war keine Rangeschmeiße, sondern entsprach seinem inneren Bedürfnis. Und das spürten die Leute. Er sagte auch ohne Scheu, wenn er etwas nicht verstand, und fragte nach. Er war da ganz entspannt und offen. Ulbricht bestellte mich oft zu sich unter Umgehung des Dienstwegs, wofür mich Günter Mittag kritisierte, weil ich ihn darüber nicht informiert hatte. Wieso ich ihn fragen müsse, ob ich zu Ulbricht gehen dürfe oder nicht, hielt ich dagegen. Darum gehe es doch gar nicht, sagte er beleidigt, er müsse eben darüber informiert sein. Was war der Grundtenor von Ulbrichts Rede? Dass Wissenschaft und Technik von entscheidender Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung der DDR sei. Du hast Ulbricht beim Besuch auf dem Weißen Hirsch begleitet. Dort führte seit 1955 Manfred von Ardenne[Anmerkung 58] sein privates Forschungsinstitut, das er mit den 100.000 Rubeln, die er 1953 mit dem Stalin-Preis erhielt, aufgebaut hatte. Ja, das war eine interessante Reise. Wir wurden in die Villa des 1957 verstorbenen Friedrich Paulus[Anmerkung 59] in Oberloschwitz bei Dresden einquartiert. Ulbricht wollte zwei Dinge klären. Erstens hatte ihm Ardenne etwas geschickt, wovon ich nichts wusste, darüber wollte er mit ihm sprechen. Und zweitens hatte er Klaus Fuchs[Anmerkung 60] einbestellt. Der wollte einen Kernbrennstoffzyklus in der DDR aufbauen und anschließend zu Schnellen Brüter übergehen. Das Schlimme war, dass er in Dresden bereits erste Maßnahmen eingeleitet hatte. Das war für die DDR eine unmögliche Sache. Ulbricht war auf das Gespräch mit Fuchs bestens vorbereitet, er war völlig im Bilde, schließlich arbeitete die Frau von Klaus Fuchs bei ihm als Sekretärin. So rigoros habe ich ihn selten erlebt. Das komme überhaupt nicht in Frage, sagte er, bei allem Verständnis dafür, dass wir die energetische Basis der DDR ausbauen müssen: Das übersteigt unsere Möglichkeiten. Aber auch aus politischen Gründen können wir das nicht machen. »So geht das nicht, lieber Genosse, ich ruiniere nicht die DDR«, sagte Ulbricht. »Das kommt überhaupt nicht in Frage.« Aber, so lenkte er ein, er würde demnächst wieder nach Moskau fahren. Fuchs solle ihm ein Konzept machen, wie wir die Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auf dem Gebiet der Kernenergie entwickeln könnten. Das tat Fuchs, und er saß dann mit mir in jenem Sonderzug, der die Delegation nach Moskau brachte. Er legte mir das Konzept vor, was Ulbricht von ihm verlangt hatte, und ich sah, dass er gleichsam durch die Hintertür – wieder diesen Brennstoffzyklus in der DDR einführen wollte. Mir standen die Haare zu Berge. Wie kriegte ich das Problem gelöst? Klaus Fuchs, mit dem ich befreundet war und den ich wegen seiner Vergangenheit außerordentlich schätzte, war ein eigenwilliger Dickkopf, der würde nicht davor zurückschrecken und sein Papier den Sowjets auch ohne Ulbrichts Segen präsentieren. Komm, Klaus, sagte ich, das ist eine gute Konzeption, darauf sollten wir einen trinken. Nun muss man wissen, dass wir beide keinen Alkohol vertrugen. So »vergaßen« wir, was gefordert war, dass er seine Unterschrift unter das Papier setzte. Im Schreibbüro in Moskau habe ich dann sein Konzept ohne die von mir gestrichenen Passagen noch einmal abschreiben lassen und sie dann Walter Ulbricht gegeben. Der bemerkte die fehlende Unterschrift. Ich redete mich heraus und sagte, dass wir, also Klaus und ich, die Konzeption gemeinsam geschrieben hätten. Was ja irgendwie ja auch stimmte. Und Ulbricht gab das Papier an Chruschtschow. Aber du wolltest etwas über den Besuch Ulbrichts bei Ardenne erzählen. Ich muss da etwas korrigieren. Entgegen umlaufenden Darstellungen, die behaupten, das Ulbricht den Baron über die Maßen geschätzt habe, war dies keineswegs so. Er hatte ein durchaus freunschaftlich-kritisches Verhältnis zu ihm. In der Materialsammlung über seine Ablösung ist ein Zitat aufgeführt, demzufolge Ulbricht gesagt haben soll, wenn er wirklich wissen wolle, was im Lande los sei, frage er nicht den Parteiapparat, sondern Manfred von Ardenne. Damit wollte er, wenn es denn verbürgt ist, vermutlich den Parteiapparat ärgern, mehr steckte nicht dahinter. – Ich habe an allen Gesprächen zwischen den beiden auf dem Weißen Hirsch teilgenommen. Ardenne wollte eine staatliche Beteiligung an seinem Institut haben. Er wurde ohnehin schon materiell und finanziell ziemlich protegiert, ich behaupte, dass andere Institute, hätten sie soviel bekommen wie der gute Baron, dann wären sie vielleicht sogar besser gewesen. Denn um Ardennes Institut, machen wir uns nichts vor, wurde ein übertriebener Wirbel gemacht, Ardenne war ein guter PR-Mann in eigener Sache. Unter den Forschungsratsmitgliedern lehnten nicht wenige Ardenne ab. Steenbeck[Anmerkung 61] sagte: Ja, er ist ein guter Techniker, hat auch Ideen, aber er ist kein Wissenschaftler. (Wegen dieser Einwände wurde Ardenne auch nicht als Mitglied in die Akademie gewählt.) Walter Ulbricht lehnte eine staatliche Beteiligung ab, er sah sofort den Pferdefuß. Ihm war bekannt, dass Ardenne nie nach Grundsätzen wirtschaftlicher Rechnungsführung arbeitete. Das Institut wäre ein Fass ohne Boden geworden. Ardenne solle alle solche Fragen mit mir besprechen, sagte Ulbricht, aber sein Institut bliebe privat. Walter Ulbricht sagte mir im Anschluss dieser Begegnung: Fahr mal die Zuwendungen langsam zurück. Und warum muss der Baron keine Steuern zahlen? Vergleichbare Einrichtungen sind von diesen Verpflichtungen auch nicht befreit. Also kurz gesagt, ihm schmeckte es zunehmend weniger, dass Manfred von Ardenne derart hofiert wurde, wie es geschah. Später, nach der Wende, wurde aus seiner Umgebung kolportiert, ich hätte ihn – im Auftrage Honeckers fortgesetzt bedrängt, dass er eine staatliche Beteilung am Institut zuließe, was er aber tapfer abgelehnt habe. Das Gegenteil war der Fall. Zudem: Honecker interessierte sich weder für Ardennes Institut noch für die wissenschaftliche Forschung. Aus bündnispolitischen Überlegungen haben wir manche Verrenkung gemacht, aber solche nicht. Eines Tages beispielsweise kam Prof. Dr. Hermann Klare,[Anmerkung 62] der Präsident der Akademie der Wissenschaften, zu mir und erklärte, er wolle Mitglied der SED werden. Hermann, das geht nicht, sagte ich, der Akademiepräsident muss neutral und parteilos sein. Er ließ sich nur trösten mit der Feststellung, in meinen Augen sei er als parteiloser Kommunist auf diesem Posten viel wichtiger denn als Parteimitglied. Oder Kurt Schwabe,[Anmerkung 63] der 1945 sein »Forschungsinstitut für chemische Technologie« gegründet hatte. Die Nazis hatten ihn aus der TU vergrault, da begann er selbständig zu forschen. Das war eine exzellente Einrichtung, die noch heute existiert. Ich habe zu Ardenne gesagt, er solle sich von dem eine Scheibe abschneiden: Schwabe mache im Jahr mehrere Millionen Gewinn und führe diesen an den Staat ab, der nehme nicht nur. Prof. Schwabe bewilligte sich ein bescheidenes Gehalt von weniger 6.000 Mark brutto. Und, da er kinderlos war, und er mich mochte, wollte er mir sein Institut testamentarisch vermachen. Das empfand ich als große Ehre, aber als Stellvertretender Ministerpräsident konnte und wollte ich ein solches Erbe nicht annehmen. Wie war das Verhältnis zwischen Max Steenbeck, ein hervorragender Physiker, und Walter Ulbricht? Positiv. Es stimmt auch nicht, dass er sich nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion bei Ulbricht Bedenkzeit ausgebeten habe, ob er in der DDR bleibe oder in die BRD gehe. Als er später den Krupp-Preis für seine Tätigkeit bei Siemens während der Nazizeit verliehen bekam, da hingen 40.000 DM dran, kam er zu mir und fragte, ob er das Geld annehmen solle, woraus ich schloss, dass er den Preis ablehnen wollte. Selbstverständlich, sagte ich, warum denn nicht? Gut, sagte er, und spendete davon den größten Teil für einen Kindergarten in Jena, dann zum Ankauf von wissenschaftlicher Literatur im Ausland. Und mit dem Rest leistete er sich eine Urlaubsreise mit seiner Frau nach Finnland. Steenbeck wollte nie in die BRD. Nebenbei: Ich war insgesamt 27 Jahre im Ministerrat für Wissenschaft und Technik verantwortlich: Keiner der Forscher, die vorher bei mir waren und um Dienst- oder Urlaubsreisen in den Westen nachgesucht haben, ist drüben geblieben. Nicht einer. Sie wussten, was sie an der DDR hatten. Und mit Peter Adolf Thiessen war Ulbricht befreundet. Die waren per Du. Thiessen hatte eine furchtbare Vergangenheit: Der war schon vor 1933 in der NSDAP. Aber er hatte auch ein großes Verdienst. Am renommierten Kaiser-Wilhelm Institut,[Anmerkung 64] das Thiessen leitete, arbeitete auch der Kommunist Robert Rompe,[Anmerkung 65] der eine illegale antifaschistische Widerstandsgruppe führte. Thiessen hat das mitbekommen – und ihn gedeckt. Rompe hat mir mal gesagt, dass er Thiessen faktisch sein Leben verdanke, der hätte ihn hochgehen lassen können. Stattdessen warnte er ihn: Seien Sie vorsichtig! Er sagte nicht etwa: Hören Sie auf! Ulbricht wusste davon. Und davon, was Thiessen für die sowjetische Atombombe zur Brechung des US Kernwaffenmonopols geleistet hatte. Thiessen war der höchstdekorierte deutsche Forscher in der Sowjetunion, die Sowjets haben ihn – zu Recht – mit Auszeichnungen überhäuft. Er kehrte als ein reicher Mann in die DDR zurück. Thiessen, du erwähntest es, war in der NSDAP. Du wurdest, kaum dass du als Minister berufen warst, im Westen als »Nazi« denunziert. Was war da dran. Zunächst: Die DDR und die Antifaschisten in der Bundesrepublik haben immer wieder scharf kritisiert, dass belastete Nazis in den 50er Jahren in der BRD wieder zu Amt und Würden kamen. Im »Kampf gegen den Kommunismus« im Kalten Krieg machten sie weiter, wo sie 1945 hatten aufhören müssen: Richter, Militärs, Geheimdienstler, Politiker … Zur eigenen Entlastung führte Bonn Angriffe auf die DDR, indem behauptet wurde, dass an führenden Stellen der DDR ja ebenfalls Nazis säßen. Es sollte auf diese Weise der antifaschistische Charakter der DDR infrage gestellt werden. Das tut man ja noch heute: Schau ins Internet unter Wikipedia – bei den biografischen Einträgen zu Funktionären der DDR wird gleich zu Beginn auf eine vermeintliche Mitgliedschaft in der NSDAP verwiesen. Und gleich danach heißt es dann: Eintritt in die KPD oder SED. So suggeriert man Kontinuität und bedient das Verdikt »Braun gleich Rot«. Als meine Biografie in der Westpresse hochgekocht wurde, luden mich die Genossen vom Zentralkomitee – dem ich bereits als Mitglied angehörte beunruhigt vor und fragten, wie sich das mit der NSDAP verhalte. Ich sagte, dass ich davon nichts wisse, ich sei nie Mitglied der Nazipartei gewesen. Ich war in der HJ wie wohl die meisten, ich lebte damals in einem Dorf in Thüringen mit 800 Einwohnern, wenn man nicht zu den Pimpfen gegangen wäre, wäre man geächtet worden. Die Nachprüfungen ergaben: Unser Lehrer, NSDAP Ortsgruppenleiter und eingefleischter Nazi, der uns in Uniform unterrichtete, wollte glänzen und hatte alle seine ehemaligen Schüler aus dem Dorf, als sie 18 wurden, ohne deren Kenntnis als Mitglieder der NSDAP eintragen lassen. Ich hatte davon keine Ahnung, zumal ich wenig später zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Mein Vater war Kommunist, der hätte mich aus dem Haus geprügelt, wenn dies eine wissentliche und willentliche Entscheidung von mir gewesen wäre. Aber bei Wikipedia steht wahrheitswidrig: »1942 wurde er Mitglied der NSDAP.« Ich wurde nicht Mitglied, ich wurde zum Mitglied gemacht, wovon ich erst nach mehr als zwanzig Jahren erfuhr. Das war ein erheblicher Unterschied. Zurück zu Thiessen und Ulbricht. Diese hatten, wie du sagtest, ein freundschaftliches Verhältnis, sie haben sich wechselseitig beraten. Auf Thiessen soll auch die Losung vom Überholen ohne Einzuholen zurückgehen? Nein, nicht Thiessen war der Urheber. Staatssekretär Stubenrauch von mir, er hatte seinen Diplomingenieur in Leningrad gemacht, und dessen Professor Schaumjan sind die eigentlichen Väter. Schaumjan kannte ich persönlich. Unser Ministerium lag in der Wuhlheide, und dort hatte Ulbricht auch die Akademie für marxistisch leninistische Organisationswissenschaften gegründet und angesiedelt. Er wollte damit Wissenschaft und Forschung, die ja organisiert werden müssen, vorantreiben. Ich hielt die Akademiegründung für überzogen, ein Institut hätte es auch getan, aber Ulbrichts Ansinnen stimmte ich prinzipiell zu. Ich lud also Schaumjan ein, dass er an der Akademie Vorträge hielt. Er hatte eine bedeutenden Beitrag zur Erhöhung der Produktivität im Werkzeugmaschinenbau geleistet. Darüber sprach er und über Grundsätzliches in der Forschung. Wolfgang Berger, Ulbrichts Mitarbeiter, war einmal bei Schaumjans Vortrag dabei. Eine These des Leningrader Wissenschaftlers lautete, dass wir nicht »nacherfinden« sollten, was der Kapitalismus entwickele, sondern wir müssten das umgehen, also nicht nur auf und nachholen, was er in Wissenschaft und Technik vormache. Daraus leitete Berger ab: überholen ohne einzuholen. Und das schrieb er Ulbricht in eine Rede. Es war also als Wissenschafts- und Technik-Strategie und nicht für die Gesellschaft gedacht? Natürlich. Wenn man in der Forschung nur nachläuft, ist der andere immer schon weiter. Also muss man, um zu Spitzenleistungen zu kommen, andere Wege beschreiten, die vorgegebenen Bahnen der anderen verlassen. – Ich war ja auch Vorsitzender des Ausschusses, der die Nationalpreise Wissenschaft und Technik vergab. Das war eine sehr lukrative Auszeichnung, und wir bekamen oft Erfindungen eingereicht, die auf diese Weise honoriert werden sollten. Da mussten wir darauf achten, was tatsächlich neu oder eben nur nacherfunden worden war. Die Losung ist unverändert gültig, auch wenn sie nicht ausgesprochen wird. Überall in der Welt, wo geforscht wird, verfährt man nach diesem Prinzip: Wenn man vorn landen will, muss man die Konkurrenz auf einem eigenen Weg zu überholen und nicht einzuholen versuchen. Wer also damals und auch heute diese Losung ins Lächerliche zu ziehen versucht, hat nichts verstanden. Die Wissenschaftler und Techniker bei uns haben es mehrheitlich begriffen, die Ideologen nicht. Ich erinnere mich eines Pädagogischen Kongresses, auf dem ein Gewerkschaftsfunktionär erklärte, wir müssten jetzt Westdeutschland überholen ohne einzuholen. Völliger Quatsch. Das wollte Ulbricht auch gar nicht, wir haben uns darüber wiederholt ausgetauscht. Er hatte jedoch etwas gegen Kopieren und Nachäffen in jedem Bereich. Warum ist es uns nicht gelungen, die Vorzüge des Sozialismus mit dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt zu verbinden? Ach, Egon, weil wir politisch große Fehler gemacht haben. Und weil unsere ökonomische Basis einfach zu schmal war, um an die Spitze zu kommen. Jeder erfolgreiche Konzern heute weiß, was auf seinem Gebiet weltweit geschieht. Schon daran scheiterten wir. Das Embargo im Kalten Krieg, das Fernhalten der DDR von der internationalen Arbeitsteilung und dem Informationsaustausch hat uns zusätzlich geschadet. Auch wenn die Genossen der Aufklärung vom Sektor Wissenschaft und Technik uns sehr halfen, alles konnten sie doch nicht besorgen. Uns fehlten Informationen, es herrschte ein ungedeckter Bedarf an internationaler Fachliteratur, davon lebt doch ein Wissenschaftler. Im Kern ist Wissenschaft eine Art Diebstahl, man übernimmt Informationen, um herauszubekommen, was die anderen machen und was man nicht machen sollte– also wieder überholen ohne einzuholen. Wichtig war auch die Teilnahme an internationalen Kongressen. Doch da ließ unsere Abwehr wiederum viele Wissenschaftler nicht fahren, weil sie Geheimnisträger waren und als gefährdet galten. Diese Übervorsicht hat der DDR geschadet, aber noch weit mehr der Sowjetunion. In der Forschung auf militärischem Gebiet waren unsere Freunde absolute Weltspitze, aber alles blieb geheim. Wer als Erster einen Sputnik auf die Erdumlaufbahn bringt, hatte hinlänglich bewiesen, über was für ein Potenzial er verfügte. In Selenograd bei Moskau arbeiteten damals etwa 200.000 Wissenschaftler fast nur an Verteidigungsaufgaben. Was die dort geleistet haben, war fantastisch. Ich war zweimal dort und durfte niemanden mitbringen, nicht einmal einen Dolmetscher. Ich habe sie gefragt, warum ihre großartigen Entwicklungen und Entdeckungen nicht auch in die zivile Wirtschaft überführt werden, damit die ganze Gesellschaft ihren Nutzen davon habe. Da hieß es nur: Dafür haben wir keine Mittel - und aus Sicherheitsgründen. Ich wurde einmal zu Verhandlungen in die Sowjetunion geschickt. Unser Politbüro hatte ein Programm von 78 Themenkomplexen beschlossen, an denen wir mit gemeinsam mit sowjetischen Wissenschaftlern und Technikern forschen und arbeiten wollten. Drei Themen fielen heraus, das tangiere zu sehr ihre Sicherheitsinteressen, hieß es. Ich biss wie auf Granit. Ich habe Erich Honecker informiert in der Erwartung, dass er das zur Chefsache machte, doch er verwies mich an Günter Mittag, er begriff offenkundig nicht die Bedeutung. Das hat mich enttäuscht. Die Masse der wissenschaftlichen Themen, die wir allein bearbeitet haben, bearbeiten mussten, war für die kleine DDR nicht zu bewältigen. Da haben uns die Freunde sehr im Stich gelassen. Sie ließen sich nicht in die Karten schauen, haben aber von uns profitiert. Letzte Frage, womit ich zum Ausgangspunkt zurückkehre: Walter Ulbricht legte großen Wert auf die Entwicklung von Wissenschaft und Technik, er pflegte zu den Wissenschaftlern ein konstruktives Verhältnis. Würdest du mir widersprechen wollen, wenn ich behaupte, dass ihm das Bildungswesen aber mindestens ebenso wichtig war? Keineswegs. Er hatte verinnerlicht: Wenn es kein ordentliches Bildungswesen gibt, dann fallen auch Wissenschaft und Technik zurück.
Margot Honecker: Es ging immer um die Sache, nicht um Personen
Margot Honecker-Feist, Jahrgang 1927, 1945 KPD. Mitbegründerin des Antifaschistischen Jugendausschusses in Halle. 1946 SED. FDJ-Funktionen im Land Sachsen-Anhalt, von 1949 bis 1953 Sekretär des FDJ-Zentralrats und Vorsitzende der Pionierorganisation. 1953 Ehe mit Erich Honecker. Besuch der Komsomolhochschule in Moskau. Danach Funktionen im Volksbildungsministerium. Von 1963 bis 1989 Ministerin für Volksbildung der DDR. Von 1950 bis 1989 Kandidat bzw. Mitglied des ZK der SED. Mit kurzen Unterbrechungen Abgeordnete der Volkskammer von 1949 bis 1990. Nach zwangsweisem Aufenthalt in Moskau Exil in Chile seit 1992. Du kommst aus einem kommunistischen Elternhaus in Halle. Hast du dort, vor 1945, etwas von Ulbricht gehört? Thälmann war der erste Name eines Arbeiterführers, der sich mir als Kind fest einprägte. Von Ulbricht hörte ich erst später. Nachdem mein Vater 1939 aus Buchenwald zurückgekehrt war, nahm er die illegale Arbeit wieder auf. Bei Zusammenkünften, an denen ich als einer der jungen Mithelfer teilnahm, redeten die Genossen über Sendungen von Radio Moskau, in denen Pieck, Ulbricht und andere gesprochen hatten. Als ich 1945 mit der aktiven politischen Arbeit begann, hörte ich von der »Gruppe Ulbricht«, die aus Moskau gekommen war, um mit dem Aufbau eines friedlichen, demokratischen Deutschlands zu beginnen. Walter Ulbricht sah ich alsbald auf Kundgebungen, oft auch auf Beratungen in der Zeit der Volkskongressbewegung.[Anmerkung 66] Sehr nah erlebte ich ihn vor allem auf den Sitzungen des Zentralkomitees, die von Wilhelm Pieck und Otto Grotewohl geleitet wurden. Ich war 1950 Kandidat des ZK geworden. Meldete sich Walter zu Wort, war nicht nur ich ganz Ohr, weil er immer sehr konkret auf die nächsten Aufgaben orientierte, sehr klar und überzeugend argumentierte. Du bist 1945 Mitglied in die KPD eingetreten. Von den etwa 300.000 Mitgliedern im Jahre 1933 hatten nur wenig mehr als die Hälfte die faschistische Diktatur, Krieg und Emigration überlebt. Dass das Nichtzustandekommen einer antifaschistischen Abwehrfront und der Bruderkrieg von Sozialdemokraten und Kommunisten den Nazis maßgeblich geholfen hatte, war bereits auf der »Brüsseler Parteikonferenz« 1935 selbstkritisch festgestellt worden. Mancher Genosse machte für dieses Versagen ausschließlich die SPD verantwortlich, was natürlich sektiererisch war: Die Linie lautete »Aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, Beendigung des Bruderzwistes und Herstellung einer gemeinsamen Partei«. Wie hast du damals diese Auseinandersetzungen erlebt? Tatsache ist nun mal: Die KPD hatte im Kampf für die Interessen des deutschen Volkes am meisten von allen Parteien geblutet. Rudi Jäger, der Leiter des illegalen Gebietskomitees Halle Merseburg (später war er FDGB Vorsitzender von Sachsen-Anhalt), erinnerte sich, dass nach den Verhaftungen 1934 in einer zweiten Verhaftungswelle im Jahr darauf allein in unserem Territorium 240 Funktionäre und 800 Mitglieder der Partei eingesperrt worden waren. Das war bitter. Aber noch bitterer war, dass jetzt, nach dem Krieg, Menschen neben uns erklärten: Wir haben das alles nicht gewusst! Über tausend Menschen waren plötzlich verschwunden. Oder später, als die Juden deportiert wurden. Das wollte man nicht bemerkt haben? Da musstem wir kräftig schlucken, um ruhig und sachlich zu bleiben. Mein Vater war ein entschiedener Verfechter der Vereinigung von KPD und SPD. Dennoch konnte auch er sich manchmal bittere, kritische Worte über Genossen der SPD nicht verkneifen. Ich selbst kam bisweilen von Jugendversammlungen ziemlich niedergeschlagen und verzagt nach Hause. Es war mitunter deprimierend zu hören und zu sehen, wie Jugendliche, die so alt waren wie ich oder jünger, in ihrem Denken der Nazizeit verhaftet waren. Wir versuchten ihnen klarzumachen, dass der Sieg über Hitlerdeutschland keine persönliche Niederlage, nicht das Ende der deutschen Geschichte, sondern die Chance für ein neues Leben, für eine neue gesellschaftliche Ordnung darstellte. Walter Ulbricht, der dies sehr deutlich wahrnahm, ermutigte uns Jugendfunktionäre, nicht zu verzagen, keine Mühe zu scheuen, um alle Jugendlichen zu gewinnen, indem wir sie einbeziehen, ihnen Verantwortung übertragen. Einen anderen Weg gebe es nicht. Ohne Mitwirkung aller Jugendlichen wäre es nicht möglich, ein neues Deutschland zu schaffen. Pieck, Grotewohl und Ulbricht wiederholten ständig, dass die deutsche Jugend nicht verantwortlich sei für die Verbrechen des Faschismus, sie sei nicht mitschuldig. Sie könne unbelastet für ihre eigene Zukunft kämpfen. Und die läge in einem einheitlichen, antifaschistisch-demokratischen Deutschland. Walter Ulbricht war nach dem Krieg einige Male in Halle. Kannst du dich daran noch erinnern? Natürlich. An eine der Kundgebungen auf dem Hallmarkt kann ich mich besonders erinnern, das muss vor den Landtagswahlen im Oktober 1946 gewesen sein. Bernard Koenen,[Anmerkung 67] gebürtiger Hamburger, der in den Reihen der KPD an vielen Kämpfen der Arbeiterklasse in Mitteldeutschland teilgenommen hatte, sprach zu uns, dann trat Ulbricht ans Mikrofon. Er äußerte sich insbesondere zu wirtschaftlichen Fragen, denn in unserer Region waren die großen chemischen Konzern Betriebe, die wieder in Gang gebracht werden mussten. Die Mitglieder der Freien Deutschen Jugend kandidierten übrigens bei allen drei Parteien. Ich erinnere mich an manche Wahlversammlung, auf der ich für die Liste der SED und der Jugendsekretär der LDP, Rudolf Agsten,[Anmerkung 68] für seine Partei sprach. Wir traten auf Versammlungen mit gemeinsamen Positionen auf, zuweilen aber vertraten wir auch sehr unterschiedliche Standpunkte. Später, gemeinsam Abgeordnete in der Volkskammer, erheiterten wir uns manchmal über unsere damalige »Gegnerschaft« während des Wahlkampfes 1946. In jener Zeit lernte ich übrigens auch Gerald Götting[Anmerkung 69] kennen und schätzen. Hans-Dietrich Genscher,[Anmerkung 70] der damals ebenfalls bei den Hallenser Liberalen war, habe ich hingegen nicht getroffen. Der DDR wird vorgeworfen, ihr Antifaschismus sei »verordnet« gewesen. Wer hat dir damals, als du nach dem Krieg in Halle gegen die faschistische Ideologie in den Köpfen gearbeitet hast, dies verordnet? Niemand. Es entsprach dies meiner Erfahrung und Überzeugung. Es ist eine der infamsten Lügen unserer Gegner zu behaupten, wir seien nicht antifaschistisch gewesen. Wir kennen dieses üble Verdikt Kurt Schumachers[Anmerkung 71] von den »rotlackierten Faschisten«, das er im Mai 1946 über die Kommunisten verhängte – ein Jahr nach dem Ende der Nazidiktatur! Mit solchen Parolen sollte verschleiert und vergessen gemacht werden, dass der deutsche Imperialismus den Faschismus gebar. Die herrschende kapitalistische Klasse wollte die Weltherrschaft zur Sicherung von Märkten und Ressourcen, und deshalb brauchte sie eine politische Ordnung, die dies am effektivsten durchsetzen konnte. Die Nazipartei schien dem deutschen Großkapital dafür das wirksamste Instrument. Hitler & Co. zur Macht verholfen zu haben war darum kein Betriebsunfall. Das Kapitel schafft sich immer die besten Produktions- und Verwertungsbedingungen, auch damals. Sein Profithunger verlangte nach Neuordnung Europas und der Welt, und das mit Krieg. Die Interessen des deutschen Monopolkapitals waren und sind nie identisch mit den Interessen des deutschen Volkes Leider ließ es sich jedoch in seiner Mehrheit manipulieren und verführen. Es folgte den Nazis in die nationale Katastrophe. Und ausgerechnet uns, die nach 1945 aufklärten, die diese Verführung sichtbar machten, die die Verflechtung wirtschaftlicher und politischer Interessen benannten, mehr noch: die wir die Wurzeln von Faschismus und Krieg durch die Enteignung der Kriegsverbrecher beseitigten, die Schuldigen für Faschismus und Krieg bestraften, ausgerechnet uns nun vorzuhalten, wir hätten nicht aus antifaschistischer Überzeugung gehandelt, ist demagogisch und verlogen. Zur Wahrheit gehört, dass alle Siegermächte, die Alliierten, im Potsdamer Abkommen festlegten, dass Faschismus mit den Wurzeln auszurotten sei, dass alle Voraussetzungen zu schaffen seien, damit Deutschland niemals mehr seine Nachbarn und die Welt bedrohen könne. Diesen Weg hätte ganz Deutschland konsequent gehen müssen. Wer aus der Geschichte gelernt hatte, zog die richtigen Schlüsse. Im Übrigen ist bezeichnend, dass im kapitalistischen Deutschland nie von Faschismus, sondern immer von »Nationalsozialismus« geredet und geschrieben wurde und wird. Auch dies ist eine absichtsvolle Verschleierung des gesellschaftlichen Ursprungs und des Klassencharakters dieser kapitalistischen Diktatur. Die obskure These Schumachers wird immer wieder hervorgekramt und zu stützen versucht, etwa mit jenem Treffen von führenden Funktionären der FDJ und einstigen HJ-Führern im Januar 1951. Es gab dazu in der ARD einen Film (»Braunes Erbe. Der Antifaschismus der DDR«), der am 13. Dezember 2007 gesendet wurde bezeichnenderweise am »Pioniergeburtstag«. Ich kann mich an diese Zusammenkunft Anfang 1951 gut erinnern, ich habe sie schließlich im Auftrag des Sekretariats des Zentralrats geleitet. Erich Honecker als Vorsitzender der FDJ traf sich zum Abschluss mit den Teilnehmern. Man kann es kurz machen: Die Gräben zwischen uns waren tief, aber wir suchten im Dialog gemeinsam nach Wegen, die sich mit der Remilitarisierung Westdeutschlands abzeichnende Entwicklung aufzuhalten. Unser Anliegen, was bei der Darstellung auch dieses Treffens heute stets ausgeblendet wird: das Bemühen, das weitere Auseinanderdriften von West und Ostdeutschland aufzuhalten, einen Krieg zu verhindern und perspektivisch die Einheit Deutschlands wiederherzustellen. Alle solche Aktivitäten standen unter der Losung »Deutsche an einen Tisch!« In diesem Kontext sind das Deutschlandtreffen der Jugend zu Pfingsten 1950 zu sehen und die Oberhofer Sportlergespräche, deren erstes im Februar 1951 stattfand, und viele andere deutsch-deutsche Begegnungen in jener Zeit. Unsere Begegnung mit einigen ehemaligen Führern der Hitlerjugend, die im Übrigen 1945 zusammen mit der NSDAP und anderen faschistischen Organisationen als verbrecherisch verboten worden war, bedeutete keinen Schulterschluss mit Nazis, wie unterstellt wird, sondern war der zugegeben: erfolglose – Versuch, mit gesprächsbereiten Westdeutschen gegen den Kalten Krieg anzugehen. Die Hürden, die diese Leute für ein solches gemeinsames Gespräch zu überwinden hatten, waren mindestens so hoch wie die unsrigen. Am 7. Oktober 1949 konstituierte sich der Deutsche Volksrat als Provisorische Volkskammer und wählte Wilhelm Pieck[Anmerkung 72] zum Präsidenten der DDR. Das war die Reaktion auf die Gründung einer Bundesrepublik in den drei Westzonen. Die Zusammenkunft fand im Gebäude der Deutschen Wirtschaftskommission in der Leipziger Straße statt, heute Sitz des Bundesfinanzministeriums. Du warst damals 22 Jahre alt und die jüngste Abgeordnete, und, wenn ich es richtig sehe, bist du die einzige noch lebende Teilnehmerin dieses historischen Aktes … Mein Freund Heinz Keßler war auch dabei. Ja, richtig, aber er war, mit Verlaub, etwas älter als du … Wie auch immer: Du warst die jüngste Volkskammerabgeordnete und hast Pieck den Blumenstrauß überreicht. Der Präsident trug, im Unterschied zum Parlament, nicht das Attribut »provisorisch«. Allein das Wörtchen »provisorisch« zeigte doch, dass wir die Tür offen hielten. Für uns war die Gründung eines zweiten deutschen Staates nichts Endgültiges, die deutsche Einheit blieb unverändert das Ziel. Wir wollten die Chance bewahren, dass es progressiven, patriotischen Kräften im Westen noch gelingen könnte, die Entwicklung zu einem westlichen Seperatstaat zu durchkreuzen. Wir wollten das einheitliche, demokratische Deutschland. Die Sowjetunion unterstützte diesen politischen Kurs, weil er sowohl im deutschen wie auch in ihrem eigenen Interesse lag. Es sollte kein Deutschland geben, von dem Kriege ausgehen könnten. Mit dem Beitritt der BRD zum Militärpakt der NATO Mitte der 50er Jahre aber war die Spaltung zementiert. Wie bist du damals überhaupt Abgeordnete geworden? Ich hatte in Halle im Frühjahr 1949 für den Volkskongress kandidiert. In den Ländern und Provinzen waren zuvor, nach entsprechenden öffentlichen Zusammenkünften, Kandidaten aufgestellt worden. Auf den Stimmzetteln stand »Ich bin für die Einheit Deutschlands und einen gerechten Friedensvertrag.[Anmerkung 73] Ich stimme darum für die nachstehende Kandidatenliste zum Dritten Deutschen Volkskongress«. Dann folgten die Namen und zwei Kreise »Ja« und »Nein«, die alternierend anzukreuzen waren. Die Wahl fand Mitte Mai statt, am 29./30. Mai 1949 traten die über zweitausend Delegierten aus Ost und West zusammen. Der Kongress wählte den Volksrat und nahm – mit einer Gegenstimme – den Entwurf einer Verfassung an. Es gibt dieses Foto von dir und Pieck vom 7. Oktober 1949 mit dem Blumenstrauß … Das war einer der bewegendsten Momente in meinem Leben. Als junges Ding stand ich vor dem in den Kämpfen ergrauten Wilhelm Pieck. Das Herz klopfte mächtig. Die Aufregung verging aber, als mir Wilhelm Pieck in seiner väterlichen Art ermutigend zulächelte. Als Ministerin für Volksbildung hast du wesentlich die Ausarbeitung und Verwirklichung des Gesetzes über das einheitliche sozialistische Bildungssystem vom 25. Februar 1965 mitbestimmt. Die annähernd zweijährige öffentliche Debatte zu diesem wichtigen Gesetz war ein heute weithin vergessenes signifikantes Beispiel sozialistischer Demokratie. Welche Auseinandersetzungen hat es damals gegeben? Das Gesetz hat seine Wurzeln in der nach 1945 erfolgten Schulreform, mit der wir das Bildungsprivileg brachen. Mit dem »Gesetz zur Demokratisierung der deutschen Schule« aus dem Jahre 1948 wurden erstmals in Deutschland Grundsätze für die Entwicklung eines demokratischen Schulwesens verankert. Walter Ulbricht persönlich schenkte der Schulpolitik immer große Aufmerksamkeit, was letztlich dazu führte, dass nach der 2. Parteikonferenz[Anmerkung 74] auch die Frage diskutiert wurde, ob eine achtjährige Schulbildung den gesellschaftlichen Anforderungen in Richtung Sozialismus genüge. Es begann eine breite Diskussion. Als nach den Ereignissen von 1953 Fehler und Überspitzungen korrigiert wurden, traten auch, sagen wir ruhig: revisionistische Auffassungen ans Tageslicht. Sie reichten von Forderungen nach Abschaffung des Russisch Unterrichts bis zur generellen Infragestellung einer zehnklassigen Schulausbildung. Auf der 3. Parteikonferenz 1956, insbesondere aber auf dem V. Parteitag 1958 erfolgte eine Auseinandersetzung mit derartigen Auffassungen. Diese machte den Weg frei für die weitere gesellschaftliche Entwicklung. In der Schulpolitik ging es nun kontinuierlich zum Aufbau der zehnklassigen Schule mit polytechnischer Ausrichtung. Auf dem V. Parteitag hatte Walter Ulbricht erklärt, dass die Einführung des polytechnischen Unterrichts eine Kernfrage bei der Entwicklung einer neuen sozialistischen Schule sei. Das war eine wichtige strategische Orientierung. Sie wurde mit Fachleuten und mit Eltern diskutiert, Kommissionen berieten und werteten praktische Erfahrungen aus, internationale Entwicklungen wurden studiert. All das floss schließlich in ein demokratisches Gesetzgebungsverfahren ein. Wenn ich mit Walter Ulbricht zusammentraf, zeigte er sich stets am Thema interessiert und ließ sich über den Fortgang der Arbeiten informieren, er stellte Fragen und erteilte Ratschläge. Zu jener Zeit gab es kaum noch Stimmen, die eine einheitliche zehnklassige Schulausbildung für falsch hielten oder die die Vorschulerziehung für alle Kinder ablehnten. Im Mittelpunkt der Diskussion standen inzwischen pädagogische und nicht zuletzt ökonomische Fragen. Denn Bildung kostet Geld, es ist eine Investition, die sich erst sehr viel später »rechnet«. Walter Ulbricht stellte zwei Jahre nach Annahme unseres Gesetzes auf dem VII. Parteitag 1967 heraus, dass die demokratische Erarbeitung des Gesetzes über das einheitliche sozialistische Bildungswesen und das Gesetz selbst eine herausragende Bedeutung für die Gestaltung des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus besäßen. Das Gesetz erfasste alle Bereiche – von der Vorschulerziehung bis zur Hochschule und eröffnete unterschiedslos allen Kindern die gleichen Möglichkeiten und Chancen. Es orientierte auf eine hohe Allgemeinbildung, eine solide, breite Grundlagenbildung und auf die Entwicklung selbständigen, schöpferischen Denkens. Kurz: Dieses Gesetz von 1965 bestimmte das Profil eines neuen modernen Schultyps. Kannst du dich an Begebenheiten erinnern, bei denen Ulbricht auch privates Interesse an diesem Thema zeigte? Immerhin: Ulbrichts hatten schließlich eine Adoptivtochter[Anmerkung 75] Schulalter? im 1959 hatten wir mit der Einführung eines Unterrichts in der Produktion (UTP) begonnen. Schülerinnen und Schüler wurden auf diese Weise mit der Sphäre der Produktion bekanntgemacht. Facharbeiter, Meister, Lehrausbilder und Genossenschaftsbauern vermittelten Kenntnisse und Lebenseinstellungen. Erich und ich waren mit unserer Tochter an einem Sonntagnachmittag zum Kaffee bei Ulbrichts. Walter erkundigte sich bei Sonja, wie das denn so mit dem polytechnischen Unterricht an ihrer Schule laufe, ob ihr der gefalle. Sonja schüttelte den Kopf und klagte, dass das gar kein Unterricht sei, sie müssten in der LPG nur Kartoffeln lesen. Lotte warf ein, dass dies doch auch notwendig wäre, und außerdem würde man bei der Feldarbeit als Städter immer etwas lernen. Walter unterbrach sie – nicht etwa, weil er die Auffassung seiner Frau nicht teilte, sondern weil er, wie er sagte, wissen wolle, wie die Schüler über dieses Fach dächten und ob es angenommen würde. Es brauchte einige Zeit, bis wir die Voraussetzungen für einen soliden Unterricht auch in diesem Fach geschaffen hatten. Ulbricht kam wiederholt auf diese Entwicklungsprobleme zu sprechen, so auch auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees 1965. Er monierte dort eine gewisse Enge in der Oberschule und in der Berufsausbildung und forderte die Verbesserung des Niveaus der technischen Grundausbildung. Dabei berief er sich auf Marx und Engels, die nachgewiesen hätten, dass die Verbindung von Unterricht mit produktiver Arbeit und Gymnastik für eine allseitige Persönlichkeitsentwicklung nötig sei. Viele progressive Pädagogen hatten sich schon mit dieser Frage befasst. So entwickelten Schulreformer in Deutschland den Arbeitsschulgedanken, der jedoch vorwiegend auf die Arbeitsvorbereitung orientierte. Die deutsche Lehrerversammlung entwickelte den Begriff der Bildung dann weiter, trat für eine allseitige allgemeine Ausbildung ein. Wir nutzten also die Ideen und Erfahrungen, die in der Vergangenheit auf diesem Felde gemacht worden waren, welche jedoch erst unter sozialistischen Bedingungen verwirklicht werden konnten. Es war kein leichter Weg, es dauerte etwa anderthalb Jahrzehnte, bis die zehnklassige polytechnische Oberschule in der DDR flächendeckend durchgesetzt war. Und daran hatte Walter Ulbricht maßgeblichen Anteil. Die »Konsultation« des Staatsratsvorsitzenden bei deiner Tochter Sonja finde ich interessant. Nun frage ich dich als Mutter, nicht als Ministerin: Konnte er mit Kindern? Ja. Er war das, was man gemeinhin kinderlieb nennt. Ich meine nicht jene vermeintliche Zuneigung bei Politikern, die – sobald eine Kamera in der Nähe ist – Kinder drücken, herzen und über den Scheitel streichen, weil solche Gesten beim Wahlvolk angeblich gut ankommen. Ulbricht nahm Kinder ernst und besaß eine natürliche Zuneigung. Das spürte man auch an kleinen Begebenheiten. Einmal lag Sonja im Krankenhaus. Ulbricht hatte aus anderen Gründen im Hospital zu tun, ich weiß nicht, ob er jemanden besuchte oder selbst zu einer Untersuchung dort war. Jedenfalls bekam er mit, dass unsere Kleine auf der Kinderstation lag, und da schaute er spontan vorbei. Er wusste, wie Kinder darunter leiden, wenn sie allein sind, zumal in einem Krankenhaus. Zurück zur großen Politik. 1953 gab es durch Berija und seine Anhänger das Bestreben, die DDR aufzugeben. In der SED-Führung wurde die Forderung laut, Ulbricht solle von seiner Parteifunktion abgelöst werden. Honecker stellte sich damals auf die Seite Ulbrichts. Wie hast du diese Zeit erlebt? Bei diesem Angriff Berijas[Anmerkung 76] ging es nicht um die Person Ulbricht. Es ging um die Generallinie der SED, die Walter Ulbricht konsequent vertrat, und es ging um die DDR. Berija wollte ein neutrales Deutschland mit einer Koalitionsregierung und damit eine Art Pufferzone zwischen dem Westen und der Sowjetunion. Das aber hieß nichts anderes als die Aufgabe der DDR und des Sozialismus in Deutschland. In dieser Situation, und auch nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956, gab es Schwankungen in der Parteiführung und Angriffe auf Walter Ulbricht im Politbüro. Erich stand immer auf der Seite Walter Ulbrichts bei der Verteidigung der Generallinie. Nach dem Bericht, den Erich auf dem 30. Plenum des Zentralkomitees erstattete, stellte sich das ZK hinter Walter Ulbricht und beschloss die weitere Entwicklung der DDR in Richtung Sozialismus. Die Attacke Berijas scheiterte an der Haltung unserer Partei, und sie musste scheitern, weil eine Preisgabe der DDR objektiv auch gegen die Interessen der UdSSR gerichtet war. Die Völker der Sowjetunion hatten schließlich nicht dafür geblutet, dass im Herzen Europas neuerlich ein revanchistisches, den Frieden bedrohendes Deutschland entstünde. Die DDR-Medien vermittelten in den 60er Jahren ein Bild der Harmonie zwischen Ulbricht und Honecker sowie deren Ehefrauen. 1970 änderte sich dies. Was war geschehen? Ich erinnere mich nicht, dass sich die die DDR-Medien über Privates, etwa über unsere gemeinsamen Kaffeenachmittage oder Skiausflüge zum Jahreswechsel ausgelassen hätten. Das war immer schon und ist erst recht heute ein beliebtes Feld der bürgerlichen Presse, auf dem viele Blumen sprießen. Aber deine Frage zielt wohl eher darauf, ob sich das Verhältnis der Ulbrichts und der Honeckers im Laufe der Zeit verändert habe, ob es Meinungsverschiedenheiten und Kritik an Entscheidungen Walter Ulbrichts gab. Grundsätzlich: Politische Meinungsverschiedenheiten bleiben in der Zusammenarbeit von Politikern nicht aus. In diesem Falle schmälerten sie aber nicht die von Achtung getragenen Beziehungen zu Walter, wobei ich einräume, dass in jener Zeit, als er schon alt und krank war, er es den Genossen nicht immer leicht gemacht hat. Als wir, mein Mann und ich, im Sommer 1973 Lotte Ulbricht auf Walters letztem Weg durch die von vielen Menschen gesäumten Straßen Berlins begleiteten, empfanden wir dies nicht als einen Abschied von seiner Politik, sondern als Abschied von einem Menschen, der uns in vielen Jahren gemeinsamer politischer Kämpfe nahegekommen war. Ich meinte den Wechsel von Walter auf Erich an der Spitze der Partei … Dabei ging es nicht um Personen, nicht um Walter Ulbricht und nicht um Erich Honecker, sondern um die DDR und darum, welche Maßnahmen in der Politik und in der Ökonomie getroffen werden mussten, um das Land weiter zu entwickeln. Natürlich waren dabei auch Entscheidungen, die mit seinem Namen verbunden waren, kritisch zu prüfen. Als Mitglied des Ministerrats wusste ich von den Schwierigkeiten in der Wirtschaft und deren Auswirkungen auf andere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens. Die wissenschaftlich-technische Revolution hatte Strukturfragen in der Wirtschaft aufgeworfen oder verschärft, welche sich aus der Spaltung Deutschlands ergeben hatten. Noch belastete uns, dass die hauptsächlichen Wirtschaftszweige sich traditionell im Westen Deutschlands befanden. Es blieb uns nichts anderes übrig, fast alles zunächst auf den Aufbau etwa der Schwer- und der Chemieindustrie zu konzentrieren, was dazu führen musste, dass andere Zweige zurückblieben. Entscheidungen, die die Entwicklung des Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft begleiteten und mit denen die ohnehin angespannten Wirtschaftspläne zusätzliche Aufgaben gestellt bekamen, verschärften die Disproportionen in der Volkswirtschaft. Sie stellten die planmäßige und proportionale Entwicklung der Volkswirtschaft in Frage. Die Auswirkungen auf die sozialpolitischen Aufgaben machten sich bereits störend bemerkbar. Auf der 14. Tagung des Zentralkomitees 1970 wurden die Probleme kritisch analysiert und Schlussfolgerungen gezogen. Wenn heute darüber geschrieben wird, dass das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft von Moskau und von Honecker liquidiert worden sei, ist Unwissenheit im Spiel oder man möchte von den wahren Ursachen unserer schweren Niederlage 1990 ablenken. Walter Ulbricht hatte Mitte des Jahres 1965 eine kritische Bilanz zum NÖSPL gezogen und auf dem VII. Parteitag daraus Schlussfolgerungen abgeleitet. Die prinzipiell richtige Orientierung auf die Nutzung der wissenschaftlich technischen Revolution und eine höhere eigenverantwortliche Führungstätigkeit der großen Wirtschaftskombinate, was auf die Erreichung einer höheren Arbeitsproduktivität gerichtet war, wurde 1970/71 nicht erledigt, sondern weitergeführt, was sowohl an einzelnen Maßnahmen wie auch an der Entwicklung des Nationaleinkommens in diesen Jahren unschwer festzustellen ist. Korrigiert und zurückgenommen wurden Übertreibungen und Überspitzungen, die mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten kollidierten. Auf dem VIII. Parteitag wurden entsprechende Beschlüsse gefasst. Diese zielten auf die Stabilisierung der Wirtschaft und ihr weiteres Wachstum mit dem Ziel der immer besseren Befriedigung der sozialen, materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Menschen. Schließlich ist dies ja die Bestimmung einer sozialistischen Wirtschaft. Wir wussten es damals, und wir sehen es heute nicht anders, dass das Verhältnis zwischen der DDR und der Sowjetunion von existenzieller Bedeutung für uns war. Julij Kwizinskij, einst Diplomat an der Botschaft in Berlin und später Botschafter der Sowjetunion in Bonn, bezeichnete in seinen Erinnerungen das Verhältnis seines Landes zur DDR als »schizophren«. Das sagt viel und doch nichts. Die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern kann man nicht mit einem Satz charakterisieren. Man versteht sie auch nur, wenn sie in die internationale Politik eingebettet betrachtet werden, also im historischen Kontext. Es bleibt: Die Sowjetunion hatte in der DDR ihren engsten und treuesten Bündnispartner. Gemeinsam mit den deutschen Kommunisten und Antifaschisten haben die sowjetischen Menschen dafür gekämpft, dass Deutschland vom Faschismus befreit wurde. Aber, und das gehört auch zur Wahrheit: Die Beziehungen waren Beziehungen zwischen einer Großmacht und einem kleinen Staat, und eine Großmacht hat nun einmal eigene nationale Interessen, die für sie einen hohen Stellenwert besitzen. Die DDR war ein Land fast ohne Rohstoffe, sie war von der Sowjetunion ökonomisch abhängig, was natürlich auch Einfluss hatte auf die Beziehungen. Vor der Geschichte wird Bestand haben, dass das Bündnis UdSSR-DDR jahrzehntelang einen entscheidenden Beitrag leistete für die Bewahrung des Friedens in Europa. Man sollte nie vergessen, dass die Sowjetunion im Kampf für den Weltfrieden die schwersten Lasten trug. Das scheint ein wenig aus dem Blick zu geraten, wenn man unsere Beziehungen auf Übernahme des sowjetischen Sozialismus-Modells reduziert. Das ist – ob wissentlich oder unwissentlich – die Übernahme eines der »Argumente« gegen den Sozialismus in der DDR, welches die tatsächliche Entwicklung ausblendet. Natürlich nutzten wir die Erfahrungen der Sowjetunion, schließlich hatte man dort zuerst das Neuland Sozialismus beschritten. In der sowjetisch besetzten Zone, später in der DDR, herrschten andere Bedingungen. Wir gingen demzufolge andere Wege bei der Bodenreform, der Bildungsreform, beim Umbruch in der Volkswirtschaft … So existierte neben dem Volkseigentum auch genossenschaftliches und Privateigentum. Wir hatten ein Mehrparteiensystem usw. Das heißt: Die DDR-Gesellschaft fußte auf anderen Grundlagen als die in der Sowjetunion, folglich gab es auch eine eigenständige Entwicklung. Natürlich gab es im Verlauf der Jahre unserer engen Zusammenarbeit auch Dummheiten, auf unserer Seite nenne ich die Versuche der Nachahmung, auf ihrer Seite den Hang zur Einmischung in unsere Angelegenheiten. Im Verhältnis zwischen dem großen und dem kleinen Bruder gab es Meinungsverschiedenheiten, auch solche ernster Natur wie die bereits im Zusammenhang mit Berija erwähnten. In den ökonomischen Beziehungen, die ja nicht unabhängig von der Weltwirtschaft existierten, verlief auch nicht alles reibungslos. Hier musste die DDR manches schlucken. Nachdem auf dem Weltmarkt die Ölpreise in die Höhe getrieben wurden, verlangte die Sowjetunion von der DDR einen dementsprechenden Preis. Das traf uns ins Mark und stellte die geplante Entwicklung infrage. Es gefährdete die DDR. In der Außenpolitik, wenn die Sowjetunion als Großmacht gegenüber den westlichen Großmächten handelte, gab es Gemeinsamkeiten, aber auch Kontroverses, mitunter gar Sand im Getriebe, wenn die sowjetische Führung Dinge anders beurteilte als die Führung der DDR. Ich erinnere nur an die Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf unserem Territorium als Reaktion auf die Maßnahmen des Westens. Das war für die DDR weder politisch noch ökonomisch leicht zu verdauen. Wenn die Interessen der DDR ignoriert oder übergangen wurden, stellte sich unsere Parteiführung, bei Pieck angefangen, dagegen. Nicht immer mit Erfolg. Trotz aller Querelen wurde der Bruderbund mit der DDR aber nie aufgekündigt. Das geschah erst durch den Verrat Gorbatschows und seines Gefolges. Schritt um Schritt haben diese unter dem Schleier der Perestroika alle marxistisch-leninistischen Prinzipien aufgegeben. Das endete schließlich im Chaos. Die einst starke Sowjetunion taumelte der Niederlage entgegen. Und ihre Führung biederte sich den USA und der BRD an, sie begab sich in deren Abhängigkeit und warf Prinzipien der internationalen Solidarität über Bord. Sie öffnete der Konterrevolution die Tore. Der Niedergang der einst mächtigen Sowjetunion war der Untergang der DDR und des ganzen sozialistischen Lagers. Es bewahrheitete sich, dass friedliche Koexistenz, wie von Lenin beschrieben, die Interessengegensätze zwischen den Systemen nicht aufhebt, dass der Kampf zwischen ihnen fortgeführt wird, dass Klassenkampf auf internationaler und auf nationaler Ebene bleibt. Das hatte diese Führung in Moskau vergessen oder in den Wind geschlagen. Das ist bitter, aber wahr. Für die einen ist Ulbricht ein »Stalinist«, für die anderen ein Arbeiter an der Staatsspitze. Die einen nennen ihn eine »Marionette Moskaus«, die anderen einen deutschen Patrioten. Für die einen ist er ein unverbesserlicher Dogmatiker, für die anderen ein mutiger Reformer. Für manche der »sächsische Bösewicht«. Der bekannte bürgerliche Publizist Sebastian Haffner bezeichnete Ulbricht 1966 als den erfolgreichsten deutschen Politiker nach Bismarck und neben Adenauer. Er meinte, in Deutschland hat Ulbricht nach Adenauers Abgang keinen Gegenspieler, der ihm das Wasser reichen könnte. Wenn du zurückblickst und Walter Ulbricht in die widersprüchliche Geschichte des 20. Jahrhunderts einordnest, was möchtest du besonders hervorheben? Jeder Mensch, auch jeder Politiker, hat Stärken und Schwächen, er kann irren und Fehler machen, Irrtümer begehen, die ernste Folgen haben können. Aber auch diese Fehler sollten, um gerecht zu urteilen, stets im Zusammenhang von Zeit und Raum betrachtet werden. Es widerstrebt mir, diese Stärke oder jene Schwäche Walter Ulbrichts hervorzuheben. Etiketten, die man unseren Politikern verpasst, oder Schubladen, in die man sie packen möchte, sind dumm und dienen der Geschichtsfälschung, letztlich ist das Teil des antikommunistischen Feldzuges, den sie aus Angst vor dem Gespenst des Sozialismus führen. Es ist nicht aus der Geschichte zu tilgen: Walter Ulbricht war einer der hervorragenden Führer der deutschen und der internationalen Arbeiterbewegung.
Günter Wilms: Er initiierte ein Bildungswesen, um das uns andere beneideten
Günter Wilms, Jahrgang 1927, 1946 Neulehrer, Studium und Promotion an der Technischen Hochschule Dresden und an der Humboldt-Universität zu Berlin, Dozent und Prorektor an der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald. Verantwortlicher für die Aus- und Weiterbildung von Pädagogen im Ministerium für Volksbildung der DDR. Danach als Professor und Institutsdirektor an der Pädagogischen Hochschule Potsdam tätig, 1970 Mitglied der neu gegründeten Akademie der Pädagogischen Wissenschaften und deren Vizepräsident. Von 1980 bis 1990 Leiter des in Potsdam ansässigen Akademie Instituts für Leitung und Organisation des Volksbildungswesens (»ILO«). Nach 1990 vorwiegend publizistisch auf pädagogisch-wissenschaftlichem Gebiet tätig Im politischen Wirken Walter Ulbrichts hatten Bildungsfragen einen festen Platz. Der Sicherung einer hohen Bildung für alle Kinder und der Schaffung der dafür erforderlichen Bedingungen schenkte er große Aufmerksamkeit. Ausdruck hierfür war insbesondere seine Rede auf der III. Parteikonferenz der SED im März 1956. Dort formulierte er die Aufgabe, in allen Schulen den polytechnischen Unterricht einzuführen und bis Ende 1960 zu erreichen, dass 40 Prozent aller Schüler Zehnklassenschulen besuchten. Ulbricht orientierte darauf, die Zehnklassenschule als obligatorische Schule für alle Mädchen und Jungen zu entwickeln. Diese Aufgabenstellung fand ihren Niederschlag in den Beschlüssen des V. Parteitages der SED im Juli 1958. Danach, im Oktober, beriet Walter Ulbricht in Leipzig mit Lehrern und Erziehern die weitere Entwicklung der sozialistischen Schule und setzte sich dabei mit jener Auffassung auseinander, das in der achtjährigen Grundschule vermittelte Wissen reiche aus, um ein guter Facharbeiter zu werden. Die Politik der SED und der DDR orientiere auf eine Hebung des allgemeinen Bildungsniveaus, erklärte er, um die Menschen zu befähigen, ein kulturvolles Leben in Wohlstand und Glück zu führen. Und nicht zuletzt stelle die fortschreitende Modernisierung, Mechanisierung und Automatisierung der Produktion, so Ulbricht weiter, und die Einführung der modernen Technik in der sozialistischen Landwirtschaft höhere Ansprüche, denen man mit der bisherigen Grundschulbildung und ohne polytechnische Ausbildung nicht mehr gerecht werden könne. Deshalb sei es erforderlich, zur zehnjährigen polytechnischen Schulbildung überzugehen. Der Realisierung dieses Anliegens diente das im Dezember 1959 verabschiedete »Gesetz über die sozialistische Entwicklung des Schulwesens in der DDR«. Um alle Kräfte auf die Verwirklichung dieses Gesetzes zu konzentrieren, wandte sich Ulbricht als Erster Sekretär mit einem offenen »Brief des Zentralkomitees der SED an alle Schulparteiorganisationen«, in dem er sich ausführlich mit den in den Schulen zu leistenden Aufgaben beschäftigte. Dieser Brief zeugte von der großen Achtung, die er den Pädagogen entgegenbrachte. Auf dem VI. Parteitag der SED im Januar 1963 unterstrich Ulbricht, dass der in der Schulpolitik eingeschlagene Weg richtig und zweckmäßig sei. Er nannte den Aufbau der zehnklassigen Schule, die Einführung des polytechnischen Unterrichts und die enge Verbindung von Schule und Lebenswirklichkeit erfolgreich. Mit Verweis auf tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen und die wissenschaftlich-technischen Revolution unter sozialistischen Bedingungen forderte er grundlegende Konsequenzen für das gesamte Bildungswesen. Es ging also nicht nur um die Schulentwicklung, sondern um das Bildungswesen in seiner Gesamtheit, also vom Kindergarten bis hin zur Erwachsenenbildung. Ulbricht hielt zudem Schritte zur Überwindung der traditionellen Trennung von Allgemeinbildung und Berufsbildung für erforderlich. Da die Entwicklung des Bildungswesens alle Bereiche der Gesellschaft betreffe, schlug Ulbricht dem Ministerrat die Gründung einer »Staatlichen Kommission zur Gestaltung des einheitlichen sozialistischen Bildungssystems« vor, in der alle Probleme der Weiterentwicklung des Bildungswesens erörtert und zur öffentlichen Diskussion gestellt würden. Diese Kommission wurde im März 1963 aus der Taufe gehoben. Zum Vorsitzenden wurde Alexander Abusch berufen, ein Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Die Mitglieder vertraten alle für das Bildungswesen bedeutsamen Wissenschafts- und Lebensbereiche: Pädagogen Kindergärtnerinnen, Lehrer, Erzieher, Schuldirektoren, Hochschullehrer –, Psychologen, Mediziner, Sportwissenschaftler, Ökonomen, Soziologen, Historiker, Philosophen, Mathematiker, Naturwissenschaftler und Musiker. Präsent waren Akademien, Parteien, Einzelgewerkschaften, Staats-, Industrie- und Landwirtschaftsorgane. Allein die Zusammensetzung zeigte, dass die Probleme des Bildungswesens gesamtgesellschaftlich betrachtet wurden und auch gesamtgesellschaftlich gelöst werden sollten. Die Bildung stand mit im Zentrum der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Kommission lenkte zwei Jahre lang den Prozess der Ausarbeitung von Grundsätzen, wobei sie sich auf wissenschaftliche Vorarbeiten des Deutschen Pädagogischen Zentralinstituts stützte, und stimulierte eine umfangreiche öffentliche Diskussion darüber. Mehr als 5.000 schriftliche Stellungnahmen mit Kritiken und Vorschlägen wurden von Arbeitsgruppen geprüft und berücksichtigt. Die Kommission legte schließlich den so erarbeiteten Entwurf vor, der im Februar 1965 von der Volkskammer als »Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem« verabschiedet wurde. Die Entwicklung des Bildungswesens wurde als ein in die gesamtgesellschaftliche Entwicklung integrierter Prozess konzipiert, als Einheit von Bildung und Erziehung, beginnend in der Krippe über Kindergarten und Oberschule bis zur beruflichen-, Hochschul- und Weiterbildung. Es war die progressive Fortsetzung der antifaschistisch demokratischen Schulreform von 1946, gerichtet auf die Persönlichkeitsentwicklung der Heranwachsenden und die Vermittlung sozialistisch-humanistischer Werte. Die Besinnung auf das progressive pädagogische Erbe des 17., 18. und 19. Jahrhunderts (Johann Comenius, Johann Pestalozzi, Adolph Diesterweg und andere) und auf bildungspolitische Traditionen der Arbeiterbewegung (Clara Zetkin, Edwin Hoernle etc.) zwang zu kritischer Überprüfung eigener Überlegungen und vermittelte Anregungen für zu treffende Entscheidungen. Das betraf die Überzeugung von der Bildungs- und Entwicklungsfähigkeit jedes Menschen und die Achtung vor seiner Würde und Persönlichkeit. Jeder Mensch hatte das Recht auf Bildung und Ausbildung entsprechend seinen Fähigkeiten, Neigungen und Interessen. Jeder Mensch ist begabt, und Begabung ist nicht etwas durch Geburt Vorherbestimmtes. Und schließlich waren wir davon überzeugt, dass Individualität und Persönlichkeit sich in der Gemeinschaft mit anderen ausprägt. Mit dem Gesetz von 1965 wurde nicht der Zustand des Bildungswesens festgeschrieben, sondern seine langfristige Entwicklung über mindestens 15 bis 20 Jahre konzipiert. Bei seiner Ausarbeitung wurde großer Wert darauf gelegt, dass das Gesetz nicht zu einem Korsett wurde und offen war für künftige Entwicklungen in Gesellschaft und Wissenschaft. So wurde zum Beispiel die Berufsausbildung in Richtung einer Kombination von beruflicher Grundlagen- und beruflicher Spezialbildung umgestaltet und der Weg der Verbindung von beruflicher Ausbildung mit Abitur vor allem an Betriebsberufsschulen zuielstrebig ausgebaut. Bei der Ausarbeitung des Gesetzes wurde der Blick von Anfang an auch auf die Gesamtheit der Bedingungen finanzieller, materieller und personeller Art gerichtet – im Wissen darum, dass das Erforderliche nur schrittweise und im Rahmen der ökonomischen Möglichkeiten geschaffen werden konnte. Das betraf den Bau von Schulen und Schulturnhallen, die Ausstattung der Schulen mit Möbeln und Unterrichtsmitteln, die Entwicklung und Produktion von Schulbüchern und pädagogischer Literatur. Es betraf aber auch die Aus- und Weiterbildung der Lehrer und Erzieher. Ein parallel erarbeitetes langfristiges Programm zur Ausbildung von Lehrern und Erziehern sorgte nicht zuletzt dafür, dass die Klassenfrequenz in den Schulen auf eine pädagogisch sinnvolle Größe gesenkt werden konnte: 1989 betrug sie im Durchschnitt 20,4 Schüler pro Klasse. Auch die Lehrerpflichtstunden – 1989 waren es 21 bis 23 Stunden je Woche konnten so geregelt werden, dass die Pädagogen die Möglichkeit hatten, sich um jeden Schüler und jede Schülerin im und außerhalb des Unterrichts individuell zu kümmern. Im Zentrum der Arbeit standen in den 60er und 70er Jahren der Aufbau der zehnklassigen allgemeinbildenden polytechnischen Oberschule, die Bestimmung der spezifischen Merkmale und Inhalte der verschiedenen Bildungswege, die Neubestimmung des Verhältnisses von allgemeiner und beruflicher Bildung sowie die Ausarbeitung des neuen Inhalts der Allgemeinbildung. Bei der Bestimmung des Inhalts gingen Pädagogik und Schulpolitik von dem klassischen deutschen Bildungsbegriff aus, der mit dem Namen Wilhelm von Humboldt untrennbar verknüpft ist. Hinsichtlich des Kanons für allgemeine Bildung waren die traditionellen Bildungsbereiche Grundlage. Als neuer Bereich, der auch die traditionellen Bereiche beeinflusste, kam die polytechnische Bildung hinzu. Das war mehr als eine einfache Erweiterung des Fächerkanons, denn er vergrößerte die Vorbereitung junger Menschen aufs Leben ganz erheblich. An den Details des Bildungskanons wurde vor allem im Zusammenhang mit der Erarbeitung der Lehrpläne für die allgemeinbildenden Oberschulen ständig »gefeilt«. Entwicklungen in Wissenschaft und Gesellschaft, vor allem aber Erfahrungen in der Schulpraxis, lieferten Anregungen. In den 80er Jahren hatte sich folgende Verteilung der Bildungsbereiche im Fächerkanon der Oberschule herausgebildet:
| Deutsche Sprache | 12,8 Prozent |
| Literatur | 10,1 Prozent |
| Mathematik | 17,7 Prozent |
| Gesellschaftswissenschaftlicher Unterricht | 10,9 Prozent |
| Naturwissenschaftlicher Unterricht | 12,2 Prozent |
| Polytechnischer Unterricht | 11,0 Prozent |
| Fremdsprachen | 11,0 Prozent |
| Kunsterziehung und Musik | 6,8 Prozent |
| Körpererziehung | 7,5 Prozent |
Wenn man die zweieinhalb Jahrzehnte bilanziert, in denen das Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem wirkte, kommt man nicht umhin, den Beitrag von Walter Ulbricht herauszustellen. Aufgrund seiner Initiative auf dem VI. Parteitag der SED 1963 war in der DDR ein Bildungswesen entstanden, das eine bedeutende bildungspolitische und pädagogische Leistung darstellte. Es berücksichtigte deutsche und internationale Bildungstraditionen, war einheitlich und wies durchgängige Bildungswege auf. Zudem wurde es stetig weiterentwickelt. Dieses Bildungswesen umfasste die Einrichtungen der Vorschulerziehung (Krippen und Kindergärten), die zehnklassige allgemeinbildende polytechnische Oberschule, Einrichtungen der Berufsausbildung (kommunale- und Betriebsberufsschulen), die zur Hochschulreife führenden Bildungseinrichtungen (Erweiterte Oberschule, Berufsausbildung mit Abitur, Volkshochschulen, Fachschulen), Ingenieur- und Fachschulen, Universitäten und Hochschulen sowie Einrichtungen der Erwachsenenbildung (Volkshochschulen, Betriebsakademien in Betrieben der Industrie, der Landwirtschaft und der Verwaltungen). Die DDR vermochte es, dass alle Kinder und Jugendlichen eine zehn Jahre umfassende Oberschulbildung erwarben und alle, die nicht den Weg zum Abitur und damit zum Hochschulstudium gingen, eine vollwertige Berufsausbildung mit anschließend gesichertem Arbeitsplatz bekamen. Ihnen stand die Möglichkeit offen, ein Fachschulstudium zu absolvieren. Welche Wirkungen damit erreicht wurden, lässt sich an der Entwicklung der Qualifikationsstruktur der DDR-Bevölkerung ablesen: Die Zahl der Facharbeiter und Meister stieg von 25,8 Prozent im Jahr 1955 auf 64 Prozent im Jahr 1985. Die Zahl der Hoch- und Fachschulkader stieg von 4,3 Prozent im Jahr 1955 auf 21 Prozent im Jahr 1985. Die Zahl der Un- und Angelernten sank von 69,9 Prozent im Jahr 1955 auf 15 Prozent im Jahr 1985. Das Bildungswesen, so wie es sich auf der Grundlage des Gesetzes von 1965 herausgebildet hatte, war integraler Bestandteil des gesamtgesellschaftlichen Systems der DDR. Hunderttausende Pädagoginnen und Pädagogen, unterstützt von Eltern, Wissenschaftlern und Werktätigen in Betrieben und Verwaltungen, hatten es durch ihre fleißige Arbeit dazu gemacht. Es genoss international, auch in der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), hohe Anerkennung und wurde in vielen Staaten, nicht zuletzt in einer Reihe von Entwicklungsländern, als Beispiel für ein wahrhaft humanistisches Bildungswesen gesehen. Was dann nach dem Anschluss der DDR an die BRD mit diesem Bildungswesen geschah, war ein Rückfall in ein sozial ungerechtes, von Bildungsprivilegien geprägtes System. Das war und ist unverantwortlich gegenüber den Kindern und Jugendlichen dieses Landes.
Walter Wiemer: Staatsmännisches Denken auf dem VII. Pädagogenkongress
Walter Wiemer, Jahrgang 1931, geboren und aufgewachsen in Ostpreußen, nach dem Krieg Ochsenkutscher, Knecht und Landarbeiter, Arbeit auf dem Neubauernhof des Vaters in der Uckermark seit 1948. Eintritt in die FDJ, Teilnehmer des Fackelzuges am 11. Oktober 1949 in Berlin und der III. Weltfestspiele der Jugend und Studenten 1951. Danach Neulehrer, später Fernstudium Geschichte und Deutsch und Mitte der 60er Jahre Besuch des Pädadogischen Instituts in Leipzig. Von 1969 bis 1989 Direktor der Hermann-Matern-Schule in Brüssow bei Prenzlau, die 2002 mangels Schüler aufgelöst wurde. Brüssow zählt vielleicht zweitausend Einwohner und liegt in der Uckermark, zu DDR-Zeiten gehörten wir zum Kreis Pasewalk, heute sind wir Land Brandenburg. Hitler schenkte 1935 dem Generalfeldmarschall August von Mackensen[Anmerkung 77] die preußische Domäne Brüssow, das waren über 1.200 Hektar Land zuzüglich Wald und Seen, die später zum Erbhof erklärt worden, und besuchte selbst zweimal den Ort. Der damals bereits 86-jährige Militär holte Albrecht Schönherr, einen Schüler Dietrich Bonhoeffers, nach Brüssow. Es war, von 1937 bis 1946 die erste Pfarrstelle Schönherrs. 1969 wurde Schönherr Vorsitzender des Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR. Bischof Schönherr prägte jene Haltung und Formel von der »Kirche im Sozialismus« (»nicht gegen, nicht neben, sondern im Sozialismus«) und setzte konsequent die Politik des Dialogs zwischen Kirche und Staatsführung fort, die mit dem Treffen des Thüringer Landesbischofs Moritz Mitzenheim und Walter Ulbricht auf der Wartburg begonnen worden war. Im Spätsommer 1964 suchte Ulbricht den Kirchenmann in dessen Amtssitz in Eisenach auf. Mitzenheim war der einzige von sechs DDR-Bischöfen gewesen, der vor Jahresfrist Ulbricht zu dessen 70. Geburtstag persönlich gratuliert hatte. Der Kirchenmann hatte im Herbst 1963 auch den Wahlaufruf des Nationalrats der Nationalen Front unterzeichnet und seinen Kritikern entgegengehalten: »Man nennt mich einen ›roten Bischof‹. Das ist recht so. Denn es gibt auch ein ›Rotes Kreuz‹ – und das bringt Hilfe!« Bei dieser zweistündigen Begegnung, so Walter Ulbricht später, habe ihn der Kirchenmann auch gebeten, »Besuche von Personen im Rentenalter bei ihren Verwandten in der westdeutschen Bundesrepublik und im besonderen Gebiet Westberlin und umgekehrt« zu erlauben. Er sagte zu, »dass Ihre Anregungen von unserer Seite sofort geprüft werden«. Wie Ulbricht drei Wochen nach dieser Begegnung in einem Schreiben an Mitzenheim mitteilte, habe sich die DDR-Regierung »mit der Sache beschäftigt« und den Innenminister angewiesen, solche Besuche zu ermöglichen. »Hochachtungsvoll W. Ulbricht.« Seit dem 2. November 1964 hatten die damals rund drei Millionen DDR Rentner für insgesamt vier Wochen in jedem Jahr die Möglichkeit, »in den Westen« zu fahren. Bischöf Schönherr, wie gesagt, nahm den Gesprächsfaden wieder auf, er traf sich 1978 mit Ulbrichts Nachfolger im Amt des Staatsratsvorsitzenden. Das alles hat mit der Begebenheit, die ich erzählen möchte, nichts zu tun. Ich wollte damit aber sichtbar machen, dass selbst in ganz kleinen Orten wie Brüssow, in denen es heute mangels Kinder nur noch winzige Grundschulen gibt, sich mitunter doch auch große Geschichte spiegelt, aus der sich manches ableiten und lernen lässt. Ich glaube, ich habe dies als Lehrer ein wenig vermitteln können, was ich mit Befriedigung auch aus den vielen Einladungen zu Klassentreffen ersehe, die mich erreichen. Inzwischen kommen dort Großeltern und Urgroßeltern zusammen, die ich einst als Lehrer auf ihrem Weg ins Leben begleitete. Im Mai 1970 war ich Teilnehmer des VII. Pädagogischen Kongresses in Berlin. Zusammenkünfte dieser Art fanden in großen Abständen statt. Ihnen oblag es, die Richtung der Schulentwicklung in der DDR nach gründlicher Diskussion der herangereiften Probleme zu einem gewissen Abschluss zu bringen. Die Diskussionsphase zur Vorbereitung dauerte meist drei bis vier Jahre in den Schulen und wurde im Wesentlichen über die Gewerkschaft Bildung und Erziehung und das Pädagogische Kreiskabinett, das dem Kreisschulamt nachgeordnet war, gesteuert. Die Zahl der Delegierten je Kreis betrug fünf bis zehn. Die Schulkollegien, aus denen gemäß Quote ein Lehrer bzw. eine Lehrerin zu entsenden waren, entschieden darüber in offener Abstimmung. Aus dem Kreis Pasewalk kamen fünf Pädagogen, an drei kann ich mich noch entsinnen: Kollegin Melzer, die Kollegen Lewin und Belz, dazu noch jemand und ich. So kamen denn etwa anderthalbtausend Delegierte in der Berliner Dynamo Sporthalle zusammen, auf den Rängen hatten die ausländischen Gäste und die Presse Platz genommen. Die Volksbildungsministerin[Anmerkung 78] hielt das Hauptreferat. Darin äußerte sie sich über Themen vom Kindergarten bis zum Abitur, weiter bis zu den Hochschulen, vom Unterricht in den Klassen der Unterstufe über den Fachunterricht in allen Wissensbereichen der sich ausprägenden zehnklassigen Polytechnischen Oberschulen bis hin zum Studium an den Instituten für Lehrerbildung und den Hochschulen, die die Fachlehrer auf den Unterricht vorbereiteten. Nichts wurde ausgespart. Selbst Schulspeisung, Trinkmilchversorgung und die medizinische Betreuung der Kinder in den Einrichtungen fanden angemessene Beachtung. Die Ministerin, so schien es, besaß ein realistisches Bild vom Alltag in den Klassen- und Lehrerzimmern. Breit wurde die produktive Arbeit der Schüler ab Klasse 7 in den Betrieben beleuchtet, auf jede vermeintliche Wunde wurde der Finger gelegt und jede nützliche Neuerung zur Nachahmung empfohlen. Das war der allgemeine Tenor, den wir aufnahmen. Walter Ulbricht saß an den vier Kongresstagen im Saal und verfolgte aufmerksam die Debatte. Nur selten war sein Platz im Präsidium frei. Als ihm der Tagungsleiter am letzten Tag das Wort erteilte, schien die Halle vor Spannung zu platzen. Der 76-Jährige überwand die wenigen Stufen zum Rednerpult sichtlich schwerfällig, als ob er gehbehindert sei. Seine ersten Sätze wurden wiederholt von Hustenanfällen unterbrochen, er wirkte gesundheitlich angeschlagen und unsicher. Doch nach einigen Minuten hatte er sich gefangen, seine Stimme wirkte fester, er hatte seinen Rhythmus gefunden. Es folgte ein anderthalbstündiger Exkurs über deutsche Geschichte, die Lektion eines altersweisen Staatsmannes, die alle im Saal berührte. Ulbricht skizzierte den Weg des Kampfes der unterdrückten Schichten des deutschen Volkes bis zur Gründung der DDR bis heute. Logik und historische Notwendigkeit erschienen wie aus einem Guss. Und Ulbricht selbst war Geschichte. Ein Jahrhundertleben. Mehrere Male nahm er Bezug auf diesen oder jenen Redebeitrag, und oft wusste er auch noch, wo die Rednerin oder der Redner saß, denn er wies mit der Hand in die Richtung. Wer Ulbricht noch nie erlebt hatte, war gleichermaßen erstaunt und beeindruckt von dessen Gedächtnis, von der Klarheit und der Überzeugungskraft seiner Argumente. Am Ende seiner Rede sagte er, was auch viele erwarteten, etwas zu unseren Gehältern. Trotz großer Probleme in vielen Bereichen unserer Gesellschaft, so Ulbricht, werde demnächst etwas für die Lehrer und Erzieher getan. Seit wohl sieben Jahren stagnierten unsere Einkommen. Entsprechend kräftig fiel denn auch der Schlussapplaus aus. In den Wochen nach dem Kongress baten mich einige Schuldirektoren aus der Nachbarschaft um einen persönlichen Bericht. Ich erinnere mich, dass rege diskutiert wurde. Besonders groß aber war die Freude über die Gehaltserhöhung, die in dem Umfang von 60 bis 80 Mark so nicht erwartet worden war.
Gregor Schirmer: Die drei Hochschulreformen und Ulbrichts Intentionen
Gregor Schirmer, Jahrgang 1932, aufgewachsen in Nürnberg, 1949 Eintritt in die KPD, Übersiedlung in die DDR 1950, Studium der Rechtswissenschaften an der Leipziger Karl-Marx-Universität, danach Völkerrecht an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften Potsdam-Babelsberg, Promotion an der Humboldt-Universität zu Berlin, 1965 Habilitation, von 1963 bis 1990 Volkskammerabgeordneter (Kulturbund), Stellvertretender Minister für Hoch- und Fachschulwesen (bis 1976), danach bis 1989 stellvertretender Leiter der Abteilung Wissenschaft im ZK der SED. Schirmer war Mitarbeiter von Abgeordneten der PDS- bzw. der Linksfraktion im Bundestag, ist Mitglied des Verbandes für Internationale Politik und Völkerrecht, des Marxistischen Forums und des Ältestenrats der Partei Die Linke. Zum ersten Mal bin ich Walter Ulbricht begegnet, als er 1946 mit Max Fechner, dem ehemaligen SPD-Mann in der zweiten Reihe der SED, zu einer großen Kundgebung auf dem Hauptmarkt nach Nürnberg kam. Damals logierten die »führenden Genossen« bei ihren Besuchen an der Basis nicht in Hotels, von denen es in der ausgebombten Stadt ohnehin nur wenige gab. Sie wurden zur Verköstigung und Übernachtung privat untergebracht. Mein Vater war Bezirksvorsitzender der KPD Nordbayern. Also wohnte WU bei uns im 2. Stock eines Mietshauses im Nürnberger Stadtteil Johannis, wie vorher bereits Wilhelm Pieck, Max Reimann und andere. Ich war schon daran gewöhnt, mein kleines Zimmer und Bett für Gäste von auswärts zu räumen. Mit meinem Vater habe ich Ulbricht und Fechner zum Hauptmarkt begleitet. Auf den letzten hundert Metern bis zur Tribüne gab es freundlichen Beifall der noch hinzuströmenden Kundgebungsteilnehmer, aber auch Pöbeleien von Störenfrieden, denen die beiden nichts schuldig blieben. Die Kundgebung verlief friedlich und war mit einigen zehntausend Teilnehmern ein voller Erfolg für die KPD, die bei den Wahlen zur Verfassungsgebenden Bayerischen Landesversammlung aber dennoch nur 5,3 Prozent der Stimmen bekam. Nach der Kundgebung wurde bis spät in die Nacht in unserem Wohnzimmer lebhaft mit WU und Max Fechner diskutiert. Daran waren nach meiner Erinnerung auch Fritz Sperling und Rudi Singer beteiligt. Später wurde mir berichtet, dass WU meinen Vater wegen seines Pessimismus hinsichtlich der Möglichkeit einer Bodenreform in Bayern heftig kritisiert und vermerkt habe: »Gebt dem bloß nicht die Partei in Bayern in die Hand.« Hermann Schirmer ist trotzdem 1948 ohne Ulbrichts Einspruch Landesvorsitzender der KPD geworden. Meine Mutter hat die Runde im Wohnzimmer mit ihrer unnachahmlichen Gastfreundschaft bewirtet. Am nächsten Tag störte es WU nicht, dass er mangels anderer Gelegenheit am Abguss in der Küche seine Morgentoilette erledigen musste. Ich war von WU sehr beeindruckt. Unsere zweite Begegnung fand kurz nach meiner Übersiedlung in die DDR statt. Ich war zur 1. Funktionärskonferenz der FDJ am 26. November 1950 eingeladen und habe Walter Ulbricht erlebt, der im Juni auf dem III. Parteitag der SED Generalsekretär des ZK der SED geworden war. Er hat die Jugend zum »Feldzug zur Aneignung von Wissenschaft und Kultur« aufgefordert. WU vermochte es, eine enorme Aufbruchsstimmung zu verbreiten. Er kritisierte scharf die Säumigkeit der für das Hochschulwesen Verantwortlichen im Volksbildungsministerium und verlieh jener Entwicklung merklich Impulse, die später 2. Hochschulreform genannt wurde. Diese Reform war stark vom sowjetischen Hochschulmodell beeinflusst. Woran sonst hätten sich die neuen deutschen Machtorgane bei der Gestaltung der Arbeit der Universitäten und HochschuIen orientieren sollen? Sollten sie im Hochschulbetrieb alles beim Alten lassen wie im Westen? Walter Ulbricht polemisierte auch gegen die Unsitte, Agitations- und Arbeitseinsätze während der Unterrichtszeit stattfinden zu lassen. Die Hauptaufgabe der Studenten sei »lernen, lernen und nochmals lernen«. Seine Rede bestärkte mich in meiner Absicht, so schnell wie möglich ein Studium aufzunehmen. Von 1951 bis 1955 habe ich die 2. Hochschulreform als studiosus iuris an der Karl-Marx Universität Leipzig in praxi erfahren. Ein sorgenfreies Studieren war materiell gesichert. Fast jeder erhielt ein Grundstipendium und fast die Hälfte der Studenten eine Leistungszulage. Studiengebühren gab es nicht. Das Recht auf fachgerechte Arbeit nach dem Studieren war garantiert. Das Studium ging nach strengem Plan in einem »Zehn-Monate-Studienjahr« und war »durchorganisiert« mit Pflichtvorlesungen, Seminaren, Prüfungen, Praktika usw. Die Studenten wurden in Seminargruppen zusammengefasst. Wir hatten enge Beziehungen zu unseren Professoren, Dozenten und Assistenten. Es galt das Prinzip der Einheit von Ausbildung und Erziehung. Die Universitäten und Hochschulen sollten nicht nur auf möglichst hohem fachwissenschaftlichem und pädagogischem Niveau Wissen und Können vermitteln, sondern die Studenten zu überzeugten Aktivisten beim Aufbau der neuen Gesellschaft erziehen. Zentrale Rolle dabei spielte das 1951 eingeführte obligatorische gesellschaftswissenschaftliche Grundstudium. Die Neuerungen erlebten wir Studienanfänger als Selbstverständlichkeiten, gegen die nichts einzuwenden war. Im Gegenteil. Wir wussten, woran wir im Studienablauf waren, welche Vorlesungen, Seminare und Übungen wir wann zu besuchen hatten, welche Prüfungen abzulegen waren etc. Die 2. Hochschulreform war zweifellos mit einer Verschulung des Studiums verbunden, der Studienplan mit obligatorischen Veranstaltungen überladen. Die selbständige wissenschaftliche Arbeit der Studenten sollte zwar Bestandteil der Ausbildung sein, in der Praxis aber wurde die Eigenverantwortung der Studenten und ihr Problemdenken zu wenig herausgefordert. Die dritte Begegnung mit WU habe ich in weniger guter Erinnerung, sie fand während der Babelsberger Staats- und Rechtswissenschaftlichen Konferenz am 2. und 3. April 1958 statt. Ulbricht nach meiner Einschätzung im Zenit seiner Macht – verurteilte scharf »Abweichler« unter den Rechtswissenschaftlern, die angeblich im bürgerlichen Rechtsdenken verhaftet seien. Sie wären von kapitalistischer Ideologie beeinflusst, von »Formalismus und Dogmatismus« angesteckt und durch Praxisferne verdorben. Seine Abrechnung mit »oppositionellen« Juristen war Teil der Strafmaßnahmen gegen aufmüpfige Intellektuelle, die sich nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 zu weit vorgewagt hatten und nun diszipliniert werden sollten. Im Schussfeld des Ersten Sekretär befand sich der Rechtstheoretiker Hermann Klenner, der sich laut Ulbricht angeblich bemüht hatte, »den Klassencharakter des Rechts zu verwischen«. Er habe sich »völlig vom Leben losgelöst« und »die Verbindung mit der Basis verloren«. Ulbricht verallgemeinerte, das »Zurückbleiben der Staats- und Rechtswissenschaft beruht darauf, dass die Hauptfrage, die Frage der politischen Macht, nicht zur Grundlage der gesamten Arbeit genommen wird«. Viele Wissenschaftler würden zwar die Beschlüsse der Partei für ihr persönliches Verhalten und ihre politische Einstellung akzeptieren, nicht aber für ihre Wissenschaft. »In Wahrheit aber schaffen die Beschlüsse der Partei die Grundlage der Staats- und Rechtswissenschaft.« Damit war ausgesprochen, um was es wirklich ging: die Parteibeschlüsse als oberste Richtschnur von Wissenschaft durchzusetzen und die machtnahe Rechtswissenschaft zum bloßen Instrument dieser Macht zu degradieren. Für wissenschaftliches Schöpfertum war da kein Raum mehr. Als junger Parteisekretär und Aspirant an der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität nahm ich Ulbrichts Auftrag ernst, dass »die Parteiorganisationen systematisch und ständig den Kampf gegen alle opportunistischen, revisionistischen und anderen versteckten bürgerlichen Ideologien in der Arbeit unserer Staats und Rechtswissenschaft organisieren sollen«. Auf der Konferenz hielt ich einen scharfen Diskussionsbeitrag. Unter meiner Verantwortung wurden an der Fakultät in der Folgezeit endlose »kritische und selbstkritische« Auseinandersetzungen und die Parteiverfahren durchgeführt, die mit einer Strengen Rüge für Hermann Klenner und Bernhard Graefrath und mit einer Rüge für Uwe-Jens Heuer endeten. »Zwecks Erziehung in der Praxis« wurden Klenner und Graefrath als Bürgermeister von Gemeinden im östlichen Berliner Umland und Heuer am Berliner Vertragsgericht eingesetzt. Auch wenn es nur eine befristete Verbannung war: Dessen rühme ich mich nicht. Zum vierten Mal erlebte ich WU im Zusammenhang mit der 3. Hochschulreform (1968 bis 1970). Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass er der Spiritus rector der Reform war. Sein Anteil ist später totgeschwiegen worden. Konzeptionelle Überlegungen und Zielstellungen waren von ihm schon auf dem VI. Parteitag der SED 1963 entwickelt worden und fanden Aufnahme im neuen Parteiprogramm. Dort wurde eine weitere »Umgestaltung des Fach und Hochschulstudiums« mit dem Schwerpunkt »Einheit von wissenschaftlicher Ausbildung« und »der wissenschaftlich-produktiven Tätigkeit der Studenten« proklamiert. Bei der 3. Hochschulreform ging es um eine Erneuerung der Universitäten, Hoch- und Fachschulen, die dem entsprach und dem diente, was damals umfassender Aufbau des Sozialismus und Gestaltung des Sozialismus als entwickeltes gesellschaftliches System genannt wurde. Die Hochschulreform stand im direkten Zusammenhang mit dem Neuen Ökonomischen System, das WU in den 60er Jahren angekurbelt hatte. Er erklärte damals, »dass die 3. Hochschulreform ein notwendiges und wichtiges Glied in der Kette der Maßnahmen zur Gestaltung des entwickelten Systems des Sozialismus ist, und zwar in doppelter Hinsicht: Sie ist einmal notwendig, um die realen Bedürfnisse unserer Gesellschaft, insbesondere der Wirtschaft nach einer weiteren Entwicklung der Produktivkräfte zu befriedigen, das heißt, die Hochschulreform ist erforderlich, um das ökonomische System des Sozialismus zu realisieren und auf seiner Grundlage die wissenschaftlich-technische Revolution zu vollziehen. Zum zweiten – das ist ebenso wichtig brauchen wir die Hochschulreform, um die sozialistische Menschengemeinschaft zu schaffen, in der sich die Werktätigen zu allseitig gebildeten sozialistischen Persönlichkeiten entwickeln und entfalten können.« Die Hochschulreform sei »ein ständiger und lang andauernder revolutionärer Prozess«. Damit setzte Ulbricht hohe Maßstäbe, denen m. E. die Praxis des sozialistischen Aufbaus nicht nachkommen konnte. Die Reform wich vom sowjetischen Modell nicht weniger ab als das Neue Ökonomische System. Im Grunde war sie eine Kritik an wesentlichen Seiten des mit der 2. Hochschulreform übernommenen sowjetischen Vorbilds. Die Hochschulreform fiel in die Periode Ulbrichtscher Politik, in der er versuchte, DDR-eigene Wege zu gehen. Die Partner in Moskau beobachteten darum unsere Hochschulreform misstrauisch, aber sie haben sie nicht behindert oder gar auf Abbruch gedrängt. Das erfuhr ich bei meinen Besuchen in der Sowjetunion und auch als Gastgeber sowjetischer Amtskollegen in der DDR. Jedenfalls erfolgte keine direkte Einmischung. Das lag wahrscheinlich daran, dass die Hochschulpolitik für die östliche Vormacht nicht wichtig genug war, um auf diesem Gebiet Einspruch zu erheben und Vorschriften zu machen. WU hatte eine »Antenne« für die unverzichtbare und wachsende Rolle von Wissenschaft und Hochschulbildung bei der Verwirklichung seiner Vorstellung vom Sozialismus. Und er pflegte auch eine – allerdings oft selektive – Kommunikation mit Wissenschaftlern. Die Besuche Walter Ulbrichts an der Universität Rostock 1965, an der Bergakademie Freiberg 1966, an der TU Dresden 1966 und an der Friedrich-Schiller-Universität Jena 1968 waren keine bloßen Protokollveranstaltungen, sondern echte Beratungen. Sie zeigten sein persönliches Interesse an der Vorbereitung und Durchführung der Reform. Wissenschaft und Hochschulbildung waren für ihn notwendige Mittel zur Überwindung des wachsenden Rückstandes der DDR Wirtschaft gegenüber dem Westen. Er war sich ziemlich klar darüber, dass sich systemübergreifend eine wissenschaftlich-technische Revolution vollzog, die gemeistert werden musste, wenn der reale Sozialismus den welthistorischen Wettbewerb gewinnen wollte. Ulbricht hörte allerdings zu sehr auf den wendigen Günter Mittag, für den die Hochschulen eher wissenschaftlich technische Dienstleistungsunternehmen für die Industrie waren. Wer wen bei subjektivistischen Übertreibungen bei der Reform bestärkte, etwa bei den »Großforschungszentren«, der Vertragsbindung der Hochschulforschung, den »Pionier- und Spitzenleistungen«, der »marxistisch leninistischen Organisationswissenschaft«, der Verdoppelung der Zahl der Absolventen usw. muss ich dahingestellt sein lassen: Ich weiß es nicht. Das Anliegen der Reform war in einem nur zwölf Seiten langen, mit relativ wenigen ideologischen Präludien versehenen Papier (»Prinzipien zur weiteren Entwicklung der Lehre und Forschung an den Hochschulen der Deutschen Demokratischen Republik«) im Oktober 1966 dargelegt worden. Hinzu kam ein Entwurf »Die Leitung der Hochschulen«, ferner Entwürfe für drei Rechtsvorschriften, die Verordnung über die Berufung und die Stellung der Hochschullehrer, die Verordnung über die wissenschaftlichen Mitarbeiter und die Verordnung über die akademischen Grade, die 1968 in Kraft traten. Die Dokumente waren im Ministerium mit Hilfe vieler Wissenschaftler ausgearbeitet worden. Sie wurden einer zentral gesteuerten, aber doch breiten und konstruktiv-kritischen Debatte an den Hochschulen, bei deren Partnern und in gesellschaftlichen Organisationen ausgesetzt und von der IV. Hochschulkonferenz im Februar 1967 bestätigt. Über 600 Änderungsvorschläge wurden gemacht, von denen viele eingearbeitet wurden. Auch der Zentralrat der FDJ machte ausführliche Vorschläge. Die Ausarbeitung der Konzeption für die Reform und ihrer Details erfolgte in einem demokratischen Prozess. Ich kann das beurteilen, denn mir oblag die Aufgabe, auf der Hochschulkonferenz über Verlauf und Ergebnis der Debatte über die Verordnungsentwürfe zu berichten. Auch aus meiner heutigen Sicht handelte es sich bei der Ulbrichtschen Hochschulreform um den Versuch, Universitäten und Hochschulen an Haupt und Gliedern umzugestalten, damit sie objektiven Erfordernissen von Wissenschaft, Ökonomie und Gesellschaft entsprachen. In den »Prinzipien« hieß es: »Das Wesen der notwendigen Veränderungen an den Hochschulen der DDR besteht darin, Lehre und Forschung entsprechend der prognostischen Einschätzung der Bedürfnisse der Volkswirtschaft, der Wissenschaften und der gesellschaftlichen Entwicklung so zu konzentrieren und zu profilieren, dass ein wissenschaftlicher Vorlauf geschaffen wird, produktiv zu nutzende Forschungsergebnisse schneller zur Verfügung stehen und sozialistische Kader ausgebildet werden, die über breite wissenschaftliche Grundlagenkenntnisse verfügen und schöpferisch und parteilich für die sozialistische Gesellschaft arbeiten. Das dient zugleich der weiteren Entwicklung der sozialistischen Demokratie.« Die Hochschulreform war auch eine Reaktion auf die kritische 68er Studentenbewegung im Westen. In der Zeit des Protestes gegen den dortigen »Mief aus tausend Jahren unter den Talaren« forderte Ulbricht die FDJ Studenten auf, in der Hochschulreform der DDR kräftig mitzumischen. Erwähnenswert ist, dass der Staatsrat eine Zeitlang bei der Hochschulreform Regie führte. Das entsprach dem Staatsverständnis Walter Ulbrichts und seinem Bestreben, neben dem Parteiapparat in Gestalt des Staatsrats, dessen Vorsitzender er war, eine eigenständige zweite Machtbasis zu schaffen. Der Staatsrat beriet unter seinem Vorsitz drei Mal – am 4. Oktober 1968, am 20. Januar 1969 und am 3. April 1969 – über die Hochschulreform, beim ersten und dritten Mal tat er dies mit zahlreichen Gästen. Es wurde eine Kommission des Staatsrats eingesetzt, die einen Beschlussentwurf vorbereitete. Der Entwurf wurde zur öffentlichen Diskussion an den Universitäten und Hochschulen und bei deren Partnern gestellt. 2.575 Änderungs- und Ergänzungsvorschläge wurden gezählt. Der Beschluss des Staatsrates der DDR vom 3. April 1969 (»Die Weiterführung der 3. Hochschulreform und die Entwicklung des Hochschulwesens bis 1975«) fasste die Anliegen der Reform zusammen. Nach dem Wechsel von Ulbricht zu Honecker 1971, also schon nach zwei Jahren, verschwand der Beschluss stillschweigend und unbemerkt aus der hochschulpolitischen Landschaft. Aus meiner Sicht kann ich nicht sagen, dass hinter der zeitweiligen »Machtübernahme« durch den Staatsrat Meinungsverschiedenheiten im ZK der SED in hochschulpolitischen Fragen steckten. Die maßgeblichen Personen aus dem ZK wirkten als Mitglieder der Kommission des Staatsrats an dieser »Machtübernahme« mit – Kurt Hager als Vorsitzender, Günter Mittag und Johannes Hörnig als Leiter der Abteilung Wissenschaft des ZK. Das Neue Ökonomische System war damals noch nicht abgeblasen. Wohl aber war die Staatsratsepisode der Hochschulreform ein bezeichnender Ausdruck des Machtgerangels zwischen Ulbricht und Honecker. Auf dem VIII. Parteitag erwähnte der neue Erste Sekretär die 3. Hochschulreform nur noch am Rande. Spätere Reformversuche waren damit aber durchaus nicht am Ende.
Klaus Huhn: Wie kein anderer Politiker trieb er die Entwicklung des Sports voran
Klaus Huhn, Jahrgang 1928, mit 17 Volontär bei der Deutschen Volkszeitung, 1945 Eintritt in die KPD, von 1946 bis 1990 tätig im Neuen Deutschland, davon die meiste Zeit als dessen Sportchef und Mitglied des Redaktionskollegiums, seit 1954 Organisationschef der Internationalen Friedensfahrt, Gründungsmitglied des DTSB und bis 1989 Mitglied des Bundesvorstandes, 1983 Promotion an der DHfK. Von 1976 bis 1993 war er im Vorstand des Europäischen Sportjournalistenverbandes (UEPS), zuletzt als Vizepräsident und Generalsekretär. Huhn gründete 1990 den spotless-Verlag. Zum ersten Mal begegnete ich Walter Ulbricht im Sommer 1945. Ich war siebzehn, der radelnde Stadtreporter des KPD-Organs Deutschen Volkszeitung, und er kam mit Wilhelm Pieck irgendwo aus Friedrichsfelde, wo die Zentrale der KPD amtierte und wohl auch logierte, in die Redaktion in der Zimmerstraße, in deren unterer Etage ein sowjetisches Sektorengrenzkommando einquartiert war. (Auf der gegenüberliegenden Straßenseite residierte das Kommando der US-Besatzungsmacht in einer ausgeräumten Kneipe.) Die beiden kamen in die Redaktion, um uns – knapp und deutlich formuliert – zu sagen, wo’s »langgeht« und was die Parteiführung von der Zeitung erwartet. Die Redaktion bestand aus einem Sextett: vier aus Moskau zurückgekommenen Emigranten darunter Wolfgang Leonhard –, einer Berliner Genossin als Sekretärin und mir. Wir saßen in drei Zimmern, deren Fenster – an Glas war nicht zu denken mit irgendwo demontierter Rollplaste vernagelt worden waren. Ge-nau kann ich mich nicht an die Details jenes Nachmittags erinnern, aber beide legten uns als Erstes ans Herz, den Lesern täglich so präzise wie möglich mitzuteilen, was sich in der Stadt verändert, denn noch standen die U Bahn-Tunnel bis zu den Ausgangstreppen unter Wasser, wurden die Straßenbahnoberleitungen mühsam meterweise geflickt und an den wenigen Omnibushaltestellen standen kilometerlange Schlangen. Das Pfund Butter kostete auf dem Schwarzen Markt um die 800 Reichsmark, und man musste beim Kauf darauf achten, dass es sich bei dem vorgewiesenen Butterstück nicht um eine Sperrholzschachtel handelte, die in betrügerischer Absicht lediglich mit goldgelber Butter umhüllt war. Begreiflich also, dass in diesen Wochen der nackten Existenzsicherung die Leser nicht so sehr interessierte, was die Alliierten in Paris oder London erörterten, sondern mehr, wann und wie man beispielsweise aus der Trümmerwüste im Zentrum nach Lichtenberg kam, um dort festzustellen, ob die Fabrikhalle, in der man bis Kriegsende tätig gewesen war, noch stand. Wir wussten, wie wichtig das für die Leser war, aber die beiden schärften es uns noch einmal ein und verwiesen darauf, dass wir uns mit umfassenden Informationen gegen die Zeitungen in den anderen Sektoren behaupten müssten und auch gegen die vom Magistrat herausgegebene Berliner Zeitung und die Tägliche Rundschau der sowjetischen Besatzungsmacht. »An den Kiosken sollen sie nach der Volkszeitung fragen, wenn sie wissen wollen, was sie am nächsten Tag zu erwarten haben!«, erklärte Ulbricht. Natürlich lag beiden auch am Herzen, dass wir intensiv über die Partei informierten und zum Beispiel mitteilten, in welchem Stadtbezirk eine neue Gruppe gegründet worden war und wo man deren Büro fand. Es lässt sich heute kaum mehr noch verständlich machen, wie schwer es damals war, die Menschen nach zwölf Jahren brutalstem Antikommunismus für die Kommunisten zu gewinnen. Ich schilderte in der Runde, dass ich kaum vorankäme, eine Jugendgruppe in meinem Wohngebiet in Britz, also im amerikanischen Sektor, zu gründen. Keiner meiner besten Freunde wollte sich bei den Besatzern unbeliebt machen. Eines Tages ließ die sowjetische Besatzungsmacht die Redaktion wissen, dass man keinen Redakteur bei der Volkszeitung akzeptiere, der im Sektor der Amerikaner wohne. Aber da ich keine Wohnung im sowjetischen Sektor bekam, empfahlen die sowjetischen Offiziere, dass ich wenigstens unter einem Pseudonym schreiben sollte. Fortan hieß ich in der Zeitung »Klaus Ullrich«, ein Name, den ich bis 1990 behalten sollte. Denn als ich später mit meinen Eltern in den sowjetischen Sektor zog, riet mir der Chefredakteur des Neuen Deutschland, ich solle bei dem bekannten Namen bleiben, denn Klaus Huhn kenne keiner. Die Folge jener nachmittäglichen Unterweisung durch Pieck und Ulbricht war, dass mich beide, wo immer ich ihnen begegnete, begrüßten. Eines Tages überreichte mir der Chefredakteur eine Essenskarte für das inzwischen von der Parteiführung bezogene Haus in der Wallstraße. Von da an hätte ich sogar behaupten können: »Ich aß oft mit Walter Ulbricht zu Mittag.« Wir saßen nämlich im gleichen Speisesaal und löffelten gemeinsam Eintopf. Bald darauf übernahm ich neben den Aufgaben des Lokalreporters auch die Funktion des Sportredakteurs, weil der bis dahin freitags und montags die Sport Texte Liefernde ausblieb. So schickte man mich am 1. Oktober 1948 in die Berliner Kronenstraße, wo FDGB und FDJ den Deutschen Sportausschuss ins Leben riefen. Ich saß neben dem Dresdner Helmut Schön, nachmals Fußballbundestrainer, der wie ich zu den Gründungsmitgliedern gehörte. Man setzte mich als eine Art Pressechef ein. Das hatte zur Folge, dass ich Anfang Februar 1949 nach Oberhof fuhr, und weil niemand Benzin für eine so lange Fahrt hatte, verkrochen wir uns auf einem Lkw, der durch einen Brennofen mit Holzgas angetrieben wurde. Am 11. Februar sollten dort die I. Wintersportmeisterschaften der sowjetisch besetzten Zone beginnen, aber bevor man den ersten Wettkampf starten konnte, waren viele Probleme zu überwinden. Die Hotelbesitzer waren nicht bereit, ihre Betten an die Sportler für nur zwei Mark pro Nacht zu vermieten, aber mehr hatte die Deutsche Wirtschaftskommission für die Übernachtung nicht bewilligt. Dann spielte uns Petrus einen Streich, als am 10. Februar Tauwetter hereinbrach. Das Sekretariat des Deutschen Sportausschusses erwog, die Wettkämpfe zu verschieben. Ich stimmte dagegen und hoffte auf die Rückkehr des Winters. Ich rief den Chef der Potsdamer Wetterwarte an, den ich als Lokalreporter kannte. Runge versicherte mir, Kälte und Schnee marschierten Richtung Oberhof. Ich stimmte die Funktionäre um und spazierte am nächsten Morgen bei Minusgraden als ausgewiesener Wetterprophet stolz durch das frisch verschneite Oberhof. Am Sonntag kam Walter Ulbricht. Seine erste Amtshandlung bestand darin, mir zu meiner meteorologischen Vorhersage zu gratulieren. Er tat dies im Kreis aller Sieger, die er zum Essen in den »Thüringer Hof« eingeladen hatte. Das war damals unglaublich, denn die Mahlzeiten selbst der Athleten waren dürftig – viele hatten sich ihre eigene Verpflegung von zu Hause mitgebracht. Es wurde aber vor allem deshalb ein turbulenter Mittag, der sich fast bis zum Abend zog, weil Ulbricht die Anwesenden aufgefordert hatte, nicht nur Fragen zur Zukunft des Sports zu stellen, sondern auch Vorschläge zu machen. Es meldeten sich zunächst die Eishockeyspieler und die Eiskunstläuferinnen zu Wort. Training und Wettkämpfe seien bei ihnen vom Wetter abhängig, darum forderten sie die Errichtung einer Eishalle. Die Berliner Eishockeyspieler schlugen vor, zwei ausgebrannte Kühlhallen des Berliner Schlachthofs könnten zu diesem Zweck zusammengeschoben werden. Deren Kühlanlagen funktionierten noch. Das Problem sei das Dach. Walter Ulbricht hörte sich diese und andere Vorschläge an und gab in Berlin den Auftrag, das Projekt einer Trümmerhalle zu prüfen. Ich erinnere mich nicht mehr aller Details, wohl aber daran, dass der zuständige Stadtrat, weil er sich energisch weigerte, versetzt wurde. Das nahm die Presse im Westen als neuerlichen Beleg für Ulbrichts diktatorischen Stil – aber 1950 wurde diese Halle feierlich eröffnet. Mannschaften aus Weißwasser, Frankenhausen, Crimmitschau und aus Berlin erhielten ihre Trainingszeiten zugeteilt, eine DDR-Meisterschaft wurde ausgetragen, und eines Tages erschien sogar die sowjetische Nationalmannschaft – überwiegend ehemalige Bandyspieler, weil Eishockey dort noch fast unbekannt war –, die sich intensiv auf ihre erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft vorbereitete. Am 22. April 1951 fand in dieser Halle auch das erste Länderspiel gegen die UdSSR statt – und wurde 2:21 verloren. Vier Monate zuvor war in der Halle die weltweit erste Amateur Radrennbahn errichtet worden, und in den folgenden Jahren fanden dort nicht nur Parteitage und Kongresse, sondern auch Box-Europameisterschaften und andere internationale Wettkämpfe statt. 1992 wurde die Werner-Seelenbinder Halle – obwohl noch völlig funktionsfähig – abgerissen, weil sich Berlin um die Olympischen Spiele 2000 bewerben wollte und auf dem Fundament dieser legendären Halle ein Velodrom sowie eine Schwimm- und Sprunghalle errichtet werden sollte. Ich erinnere an die Ursprünge dieser Sporthalle, eine der wichtigsten Berliner Sportstätten im 20. Jahrhundert, auch deshalb, weil sie dem Umstand geschuldet war, dass Ulbricht sehr genau hinzuhören verstand. Er hatte nicht nur die Klagen der Sportler vernommen, sondern aufmerksam auch ihre Vorschläge notiert. Walter Ulbricht erklärte in eben jener Halle auf der 2. Parteikonferenz, die Grundlagen für den Sozialismus schaffen zu wollen. In seiner Rede äußerte er sich auch zum Sport. »Das sozialistische Deutschland braucht gesunde, willensstarke, geschulte, zielbewusste Menschen«, sagte er damals, im Juli 1952. »Das Politbüro hat zu der Kritik und den Vorschlägen der Sportler Stellung genommen und hält es für notwendig, dass ein Staatliches Komitee für Sport und Körperkultur mit entsprechenden Organen in den Bezirken und Kreisen geschaffen wird.« Das Motiv für diese Forderung dürfte bei seinen zahlreichen Besuchen bei Sportveranstaltungen entstanden sein. Der Deutsche Sportausschuss arbeitete zu schwerfällig, geriet oft in ergebnislosen Streit über Belanglosigkeiten und versuchte seine Schwächen durch vermeintliche Erfolge bei der Mitgliedergewinnung zu kaschieren. Walter Ulbricht ließ sich nichts vormachen und hielt eine staatliche Instanz für eine sinnvolle Alternative. Er schickte die Sportführung auf Studienreise in die Sowjetunion. Wenige Tage nach der Parteikonferenz wurde das Staatliche Komitee gegründet und dazu für den Sport zuständige Instanzen in den Bezirken und Kreisen. Allerdings zeitigte auch dieser Schritt nicht den von ihm erhofften Erfolg. Auf der III. Sportkonferenz 1955 kritisierte Walter Ulbricht unmissverständlich: »Wir sind in der Entwicklung des Massensports weit zurückgeblieben, das muss korrigiert werden.« Mit scharfen Worten rügte er, dass das Staatliche Komitee ausgerechnet die Abteilung Massensport aufgelöst hatte, was einmal mehr die Behauptung widerlegte, Ulbricht sei nur an internationalen Siegen und Medaillen interessiert gewesen. Aber wie verhält es sich da mit den »Diplomaten im Trainingsanzug«, als die unsere Sportler gern bezeichnet wurden? Diese Formulierung stammt von Lord Burghley, Mitglied des britischen Oberhauses und Präsident der Internationalen Leichtathletikföderation (IAAF). Er hatte zu einem Sportfest in London auch DDR-Athleten einladen lassen, denen aber nach einer Intervention der BRD beim britischen Außenministerium die Einreise verweigert wurde. Burghley sorgte für die Rücknahme dieser Entscheidung und gratulierte dem siegreichen Langstreckler Siegfried Herrmann mit den Worten: »Sie sind ein Diplomat im Trainingsanzug.« Walter Ulbricht zitierte später den britischen Lord. Es lag auf der Hand, dass DDR Sportler – und gewiss auch Ulbricht seit der Gründung der neuen Sportbewegung von einer Teilnahme an Olympischen Spielen träumten. Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland unternahm 1952 nachweislich – und erfolgreich – alles, um den Start von DDR-Athleten bei den Spielen in Helsinki zu verhindern. 1954 begann IOC-Präsident Brundage (USA) mit der Suche nach Möglichkeiten, um sowohl dem Alleinvertretungsanspruch der BRD als auch dem Recht der DDR auf eine Teilnahme an Olympischen Spielen zu genügen. Er schlug 1955 in Paris dem IOC vor, die Mannschaften beider deutscher Staaten bei den Winterspielen 1956 in Cortina und bei den Sommerspielen in Melbourne in einem gemeinsamen Team starten zu lassen. Sporthistoriker unterschlagen gern, dass die BRD-Vertretung damals in Paris gegen diesen Vorschlag stimmte – aber mit dieser Haltung in der Minderheit blieb. In dieser Zwei-Länder-Mannschaft gewann die DDR in Cortina ihre erste olympische Medaille, DDR-Meister Harry Glaß holte Bronze im Skipspringen. Auf dem V. Parteitag der SED 1959 übte Walter Ulbricht erneut massive Kritik an der Sportbewegung, und sie galt nicht dem Spitzen- und Leistungssport, sondern dem Jugendsport in den Wohngebieten. Seine Forderung lautete knapp und konkret: »Jeder Jugendliche treibt Sport!« Dabei muss erwähnt werden, dass Walter Ulbricht zu den Ersten gehörte, die in seiner Altersklasse die Bedingungen für das DDR Sportabzeichen ablegten. Am 3. Juni 1959 fand auf einem Platz des Stadions an der Cantianstraße ein »Treffpunkt Olympia« statt. Veranstaltungen mit diesem Namen waren von der Sportredaktion der Jungen Welt erfunden worden, um DDR Olympiateilnehmer und interessierte Jugendliche zusammenzubringen. Walter Ulbricht warb für diesen »Treffpunkt« unter den Mitgliedern des Politbüros einige Volleyball-Interessierte, die dann eine Mannschaft bildeten und gegen eine Mannschaft von Jugendlichen und Sportfunktionären antrat. Fast in jedem Jahr traf ich Walter Ulbricht in Klingenthal. Er kam zu den Höhepunkten des Skisports – die DDR war, das nur nebenbei, nach der Schweiz das zweite Land, in welchem Damenskirennen stattfanden. Ulbricht erschien meist schon am Morgen mit seiner Frau auf Brettern. Abends saßen wir oft beisammen und erörterten aktuelle Sportprobleme. Einmal gerieten wir in heftigen Streit, der sich über Stunden hinzog. Es ging um die Frage, ob unsere Eiskunst-läuferinnen und läufer in einer »Revue« auftreten sollten oder nicht. Er war entschieden dagegen. Dynamo Berlin wollte zu Weihnachten in der Werner-Seelenbinder-Halle eine kleine Revue auf Kufen aufführen, an der die damals berühmtesten Aktiven mitwirken sollten. Walter Ulbricht war aus unerfindlichen Gründen strikt dagegen und ließ kein Argument gelten. Ich habe bis heute nicht diesen Streit vergessen, weil er so ungewöhnlich war. Ich hatte und habe später Ulbricht viele Male erlebt, wie er die Argumente aller zur Kenntnis nahm und dann auch akzeptierte und sich notfalls korrigierte, aber in diesem Fall ließ er sich nicht von seiner Meinung abbringen. Diese Weihnachtsrevue fand aber trotzdem statt und wurde, wegen des großen Zuspruchs, mehrere Male wiederholt. Der Streit um den »Chef de mission« gehört nicht unbedingt zum Thema Walter Ulbricht, doch es war ein Kapitel der Geschichte des DDR-Sports. Nach der schon erwähnten Abstimmung im IOC über die Mannschaft beider deutscher Staaten gab es eine Reihe von Protokollfragen zu klären. Der Begründer der modernen Spiele, Coubertin, war bekanntlich ein Franzose, und dieser hatte die Funktionen in den Mannschaften französisch bezeichnet. Der Bürovorsteher, dessen Aufgabe unter anderem darin bestand, die Omnibusse für die Mannschaften zum Training zu bestellen und Quartierfragen zu regeln, hieß Chef de mission. Wer sollte ihn in der gesamtdeutschen Mannschaft stellen? West oder Ost? Die Bundesregierung erklärte: Schon aus Prinzip könne keiner aus dem Osten Chef werden! Den sich nun schier endlos hinziehenden Streit hoffte die DDR mit dem salomonischen Vorschlag zu beenden, dass die BRD den »Chef de mission« bei den Sommerspielen stellte und die DDR den bei den Winterspielen. Da sei auch die Mannschaft wesentlich kleiner. Bonn akzeptierte auch das nicht. Der NOK-Chef der BRD, Daume, wurde nach Chicago geschickt, um den IOC Präsidenten zu veranlassen, dass der entschied: Wer die meisten Athleten in der Mannschaft stellte, nominiert auch den »Chef de Mission«. In Melbourne sah das Verhältnis 132 zu 37 aus, man wähnte sich auf der sicheren Seite. Bonn löste damit einen Wettlauf aus. Für dieses Duell bedurfte es keiner politischen Aufforderung Walter Ulbrichts, denn jeder Athlet wollte bei den Ausscheidungswettkämpfen für die gemeinsame Olympiamannschaft ein Ticket gewinnen. Der weitaus wissenschaftlicher und straffer organisierte DDR-Sport sorgte bald dafür, dass sich die Verhältnisse umkehrten. Vier Jahre nach Melbourne warnte das in Westberlin erscheinende CDU-Blatt Der Tag: »Ein roter Chef de Mission – das fehlte noch. Da gibt es nur ein Antwort: Mit allen Mitteln der Zone begegnen und sie in die Schranken zurückweisen.« Mit solchen Appellen war jedoch nicht viel zu erreichen, denn beim sportlichen Wettstreit entschieden die Leistungen und nicht die politischen Losungen! Walter Ulbrichts Begrüßungsrede nach der Rückkehr der DDR-Olympia Mannschaft aus Rom 1960 – die DDR gelangte mit 16 Medaillen auf den zwölften Rang – befasste sich allenfalls peripher mit diesem sportlichen Erfolg. Ihm ging es vor allem um Krieg und Frieden und die Rolle Deutschlands (nicht der DDR oder der BRD): »Das Auftreten und die Erfolge der deutschen Mannschaften in Rom zeigen, auf welche Weise das deutsche Volk zu Achtung und Ansehen in der Welt gelangen kann. Auf dem Schlachtfeld gibt es keine Zukunft, keinen Ruhm und keine Ehre, sondern nur Tod und Untergang. Die glückliche Zukunft des deutschen Volkes, sein Ruhm und seine Ehre sind nur zu sichern auf dem Felde der Arbeit, der Wissenschaft und der Kultur, zu der auch der Sport gehört.« Als Kronzeugen für Ulbrichts strategische Sportpolitik möchte ich gern Willi Ph. Knecht (1929-2005) einführen. Der Leiter der Abteilung Aktuelles beim RIAS, Gesellschafter des Sport Informations-Dienstes (sid) und Chefredakteur der Olympischen Sportbibliothek. Der gebürtige Rheinländer war kein Freund der DDR, aber es unterschied ihn von seinesgleichen, dass er zu einem gewissen Realismus fähig war. 1977 war ich ihm in einem Stadion begegnet, und er hatte mir angekündigt, dass er an einem Buch über den DDR-Sport arbeite. Es erschien bald darauf mit dem Titel: »Das Medaillenkollektiv. Fakten, Dokumente, Kommentare zum Sport der DDR«. Neben vielen üblen Auslassungen, die den Antikommunisten erkennen ließen, fand sich auch ein Kapitel, das ihm viel Kritik in seinen Kreisen eintrug. Es hieß: »Der Glücksfall Walter Ulbricht.« »Die Politisierung und Ideologisierung von Körperkultur und Sport in der DDR, die daraus resultierende Einstufung als gesellschaftspolitischer Faktor ersten Ranges und die damit wiederum eingeleitete Aufwärtsentwicklung bis zum heutigen Niveau des Deutschen Turn- und Sportbundes der DDR sind ursächlich das Werk eines einzigen Mannes – Walter Ulbricht. So leicht durchschaubar im Nachhinein seine ideologischen Motive und seine parteilichen Zielsetzungen auch waren: Kein anderer deutscher Politiker hat den Aufbau einer Sportorganisation so nachdrücklich unterstützt und die Weiterentwicklung des Sports zu einem allgemeinen Lebensbedürfnis so systematisch vorangetrieben wie der langjährige Generalsekretär der SED und DDR-Staatsratsvorsitzende«, schrieb dort Knecht zu meiner Verwunderung. »Von einem turn- und schwimmbegeisterten Vater angeregt und in seinem Hang zu sportlicher Freizeitgestaltung durch die frühe Mitgliedschaft im Leipziger Arbeiterturnverein ›Eiche‹ geprägt, war Walter Ulbricht Zeit seines Lebens ein Aktiver: Tägliche Morgengymnastik, mindestens zweimal wöchentlich Schwimmen, entsprechend der Jahreszeit Volleyball, Rudern, Radfahren oder Skilauf; schon über 60-jährig, nahm er noch Privatunterricht im Schlittschuhlaufen. Was mit Gymnastik und Geräteturnen im Gartengebäude des Leipziger ›Volkshauses‹ begann, mündete fast 40 Jahre später in groß angelegter Sportpolitik. Zu seinen weitestblickenden Entscheidungen gehörte seine Order zur Gründung der Deutschen Hochschule für Körperkultur in Leipzig – gegen den Widerstand eines Teils des SED Politbüros. Schon beim zehnjährigen Jubiläum dieser Kaderschmiede des DDR-Sports sah Ulbricht die Richtigkeit seiner Anordnung bestätigt: ›Im Jahre 1950 wurde die Hochschule eröffnet. Eineinhalb Jahre später, 1952, wurde der Grundstein gelegt zu den schönen, großzügigen Anlagen, die die Werktätigen der DDR der sozialistischen Körperkultur und den Sportlern zur Verfügung stellten. Damals – Sie werden sich erinnern – gab es in der DDR noch manche Leute, die sagten: Müssen wir so viel Geld für den Sport ausgeben? Haben wir denn keine dringlicheren Ausgaben? Wird hier nicht alles zu großzügig geplant? Obwohl es uns damals nicht leicht fiel, wurde zugunsten der neuen Hochschulanlagen und damit zugunsten unseres sozialistischen Sports, zugunsten unserer Jugend und ihrer harmonischen Entwicklung entschieden. Die Erfahrungen haben diese Entscheidungen gerechtfertigt. Heute gibt es niemanden mehr, der etwa sagte: Wir hätten damals das Geld für nützlichere Zwecke anwenden sollen‹«, so Ulbricht 1960, zitiert von Willi Knecht. »›Die Deutsche Hochschule für Körperkultur hat jetzt als zentrale Lehr- und Forschungsstätte mit die Verantwortung für die gesamte Entwicklung von Körperkultur und Sport auf allen Gebieten und auch für die Entwicklung des Massensports. Daraus ergeben sich für die Deutsche Hochschule für Körperkultur große Aufgaben. Sie muss durch Ausbildung und praktische Tätigkeit dem Deutschen Turn- und Sportbund helfen, den Volkssport schnell und allseitig zu entwickeln.‹ Gut zwei Jahre nach Walter Ulbrichts Tod am 1. August 1973 konnte die Deutsche Hochschule für Körperkultur zu ihrem 25-jährigen Bestehen im Oktober 1975 eine Jubiläumsbilanz vorweisen, die ihre Unentbehrlichkeit für den DDR-Sport belegt. DHfK-Rektor Professor Dr. Günther Stiehler in seinem Rechenschaftsbericht: ›Nachdem zur Eröffnung der DHfK am 22. Oktober 1950 die ersten 96 Studierenden immatrikuliert wurden, waren es im Jahre 1960 im Direkt- und Fernstudium bereits mehr als 2.000. 1953 kam das Fernstudium für Diplomsportlehrer, die Aufnahme des Studiums, für Schulsportlehrer, ab 1958 das Trainer Fachschul-Fernstudium sowie ab 1964 Studienformen für Ausländer‹«, zitierte Knecht Rektor Stiehler im Jahr 1975, um dann fortzufahren: »Neben der oftmals unter Hintanstellung anderer, gesellschaftspolitisch objektiv zumindest gleichwertiger Aufgaben lieferte Ulbricht dem DDR-Sport zwei Jahrzehnte lang zitierbare Förderungsparolen. Ob zum Volkssport oder zur Jagd nach Titeln und Medaillen: Der ›Freund der Jugend und der Sportler‹ hatte stets einen passenden Slogan zur Hand, angefangen von der für das III. Deutsche Turn- und Sportfest 1959 kreierten Parole: ›Jedermann an jedem Ort, einmal in der Woche Sport‹ lange Zeit der populärste Werbevers des DDR-Sports. Gegen Ende des Sommers 1966, der dem Deutschen Turn- und Sportbund erstmals auf breiter Basis den Durchbruch zur leistungssportlichen Weltspitze brachte, formulierte Ulbricht am 19. September beim Empfang der Medaillengewinner der Sommersportarten im Ost-Berliner Sitz des Staatsrates: ›Wir haben buchstäblich mit nichts begonnen. Aber Schritt für Schritt ging es voran. Körperkultur und Sport sind ein elementarer Bestandteil unserer sozialistischen Entwicklung, und Ihr seid die Verkörperer der höchsten Leistungen auf diesem Gebiet.‹ Nicht nur sportliche, auch hochpolitische Ereignisse nahm Ulbricht zum passenden Anlass, die Weiterentwicklung des Sports zu propagieren; er machte das Thema Sport als Redeinhalt für jede Gelegenheit hoffähig. Immer wieder nutzte er seine ganze Autorität, ›die Werktätigen und die Jugend noch stärker als bisher für Sport und Spiel zu gewinnen‹, so bei der 11. Sitzung des Staatsrates am 20. September 1968, als er alle gesellschaftlichen Organisationen zu einer noch intensiveren Förderung des Sports animierte: ›So wird deutlich, dass Körperkultur und Sport mit der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus untrennbar verbunden sind. Es gilt, diese Erkenntnis überall zu vertiefen und noch besser dafür zu sorgen, dass Körperkultur und Sport die gesunde, optimistische und schöpferische Lebensweise unseres Volkes in der sozialistischen Menschengemeinschaft mitformen. Für alle Bürger und, für die ganze Gesellschaft gilt auf dem Gebiet der Körperkultur das neue Ziel: ›Jedermann an jedem Ort – jede Woche mehrmals Sport.‹« Soweit Willi Knecht über Walter Ulbrichts Beitrag zur Sportpolitik in der DDR. Ein anderes Kapitel des DDR-Sports waren die Spartakiaden – auch sie befördert und gefördert von Walter Ulbricht. Am 8. September 1964 sprach er vor Studenten und Wissenschaftlern der DHfK und forderte Funktionäre der Partei, in den Kreis- und Bezirksbüros Tätige und vor allem natürlich die Sportbewegung auf, die Spartakiaden zu Höhepunkten zu gestalten. 1966 fand die erste zentrale Spartakiade statt, an der 12.000 Aktive in 23 Sommersportarten teilnahmen. Als die DDR zum ersten Mal mit einer eigenen Olympiamannschaft zu Sommerspielen reiste, und zwar 1972 nach München, war er schon nicht mehr Erster Sekretär des ZK der SED. Hinter der UdSSR und den USA belegte die DDR mit 20 Gold- und je 23 Silber- und Bronzemedaillen den dritten Rang der Nationenwertung vor dem Gastgeber BRD. Im Kino des Olympischen Dorfes lief vor fast immer überfülltem Saal der Thorndike-Film über eine Kreisspartakiade in Wernigerode, und das Gerücht machte die Runde, dass das Bundeswehrorchester, welches bei der Siegerehrung die Nationalhymne des Siegers spielte, für die DDR-Hymne keine Noten mehr brauchten, denn sie spielten diese auswendig – so oft hatten sie dieses »Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft zugewandt« spielen müssen. Der 79-jährige Walter Ulbricht erlebte am Bildschirm den bis dahin spektakulärsten Triumph des DDR Sports. Daran hatte er seinen Anteil.
Heinz Wuschech: Die DHfK in Leipzig war sein Kind, dort war die Quelle der Sporterfolge
Heinz Wuschech, Jahrgang 1933, nach einer Lehre als Zylinderschleifer und Abitur Studium an der Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport (DHfK), Sportlehrerdiplom 1954, danach Medizinstudium in Leipzig. Chirurgische Ausbildung in Spremberg und Berlin, Sportarzt bei der SV Dynamo seit 1962. Bis 1976 Chefarzt an der Sportärztlichen Hauptberatungsstelle Berlin und Verbandsarzt des DSLV der DDR in den nordischen Skidisziplinen und Betreuer bei Olympischen Spielen. Beendigung seiner Tätigkeit für Dynamo aufgrund von Westkontakten. Danach bis 1998 beschäftigt als Chefarzt für Chirurgie im Städtischen Krankenhaus Berlin Weißensee. Als Spezialist für Arthroskopie machte er sich einen Namen nicht nur in der Sportwelt. Es war eine große Ehre für mich, als ich als 18-jähriger Fußballspieler von Einheit Spremberg in die Landesauswahl von Brandenburg berufen wurde. In dieser Mannschaft sollte ich im Sommer 1951 bei einem Turnier während der III. Weltfestspiele der Jugend und Studenten spielen. Es war ein tolles Erlebnis. Unser Manschaft betreute Helmut Bock, ein Kölner, fünf Jahre älter als ich. Er studierte seit drei Jahren Germanistik, Geschichte und Pädagogik an der Humboldt-Universität. Er war sympathisch, redegewandt und erfüllte alle Wünsche, die wir so hatten. Nach Jahresfrist sollten wir uns überraschend wiederbegegnen. Nach einem Pokalspiel in Aue, bei dem ich für Spremberg das Siegtor geschossen hatte, fand ein gemeinsames Essen statt. Neben mir saßen Walter Tröger, ein berühmter Auswahlspieler von Aue, sowie die beiden Brüder Wolf und Binges Müller. Die drei bearbeiteten mich. Ich solle nach bestandenem Abitur nach Aue kommen und nur noch Fußball spielen. Nebenbei könne ich ein Ingenieurstudium absolvieren. Kost und Logis wären selbstredend frei, und ich würde 200 Mark »Taschengeld« bekommen. – Das klang interessant. Schließlich lud man schriftlich zum Einstellungsgespräch ein. Anfang Juli 1952 setzte ich mich in den Zug, um nach Aue zu reisen. Diese Reise sollte einen ganzen Tag dauern, viele Brücken waren im Krieg zerstört und die Gleise als Reparationen demontiert worden. Im Bahnhof in Cottbus traf ich einen Fußballer aus Brieske-Ost, mit dem ich in der Brandenburger Landesauswahl im Sommer 1951 bei dem Turnier während der Weltfestspiele in Berlin gespielt hatte. Er wollte nach Leipzig, um sich für ein Sportstudium an der soeben eröffneten Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport zu bewerben. Da ich in Leipzig vier Stunden Aufenthalt hatte, begleitete ich ihn aus reiner Neugier zur Aufnahmeprüfung. Im riesigen Vorraum des Gebäudes warteten bereits über hundert Bewerber. An verschiedenen Tischen wurde mit ihnen gesprochen. Plötzlich klopfte mir jemand auf die Schulter. »Was machst du denn hier, willst du auch Sport studieren?« Es war Helmut Bock. Seit der Eröffnung war er an der DHfK. (Er sollte 1956 als Externer an der Karl Marx-Universität das Staatsexamen als Historiker machen und von 1971 bis 1991 am Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften in Berlin arbeiten.) »Nein«, stotterte ich, »ich bin nur zufällig hier und will nach Aue!« Folgerichtig kam die nächste Frage: »Was willst du in Aue?« Ich zeigte ihm die Einladung. Er stutzte und fragte nach meinem Abiturzeugnis, was ich aus meinem ehemaligen Ranzen fingerte. »Was, so ein gutes Abitur hast du gemacht? Warum willst du nicht Sport studieren und bei Lokomotive Leipzig Fußball spielen?« Ich erzählte von den Aussichten, die ich in Aue hätte. »Bei uns wohnst du im Internat, hast alles frei, bekommst kostenlos die notwendige Sportbekleidung und ein Stipendium von 260 Mark.« Ich war sprachlos. »Hier hast du ein Direktstudium, in Aue nicht«, setzte Bock nach. Vielleicht war ein Sportstudium wirklich interessanter als ein Bergbaustudium? Außerdem gab es 60 Mark mehr! Allerdings hatte ich keine Ahnung, was die DHfK für eine Einrichtung war, was dort passierte und dergleichen. Bock erteilte Nachhilfe: Die Hochschule gäbe es seit dem 22. Oktober 1950, initiert habe sie Ulbricht persönlich, und der Schwerpunkt läge auf der Ausbildung von Sportlehrern. Im Juli wäre nach zwei Jahren Ausbildung der erste Jahrgang in die Praxis entlassen worden, der jetzige Studiengang dauere bereits drei Jahre oder sechs Semester. Ich fuhr nicht nach Aue und schrieb mich in Leipzig ein. Daheim machte ich mich schlau. Der Schwager meines Fußballfreundes Werner Noack hatte bis vor kurzem in der FDJ-Kreisleitung Spremberg gearbeitet, inzwischen war er Sekretär des Zentralrats und Mitglied des Weltjugendrates, und obendrein saß er auch noch im Brandenburger Landtag. Ich frage also diesen Oskar Fischer, ob er mir etwas zu dieser hohen Schule in Leipzig sagen könne. Konnte er. Er packte mir das Gesetz über die Teilnahme am Aufbau der DDR und die Förderung der Jugend in Schule, Beruf, bei Sport und Erholung auf den Tisch, eine Entschließung des ZK der SED über die Aufgaben auf dem Gebiet der Körperkultur und des Sports vom 19. März 1950, ein Sportecho mit einem Bericht über die Grundsteinlegung und handschriftliche Aufzeichnungen, die er selber auf der 2. Parteikonferenz angefertigt hatte … Was soll ich damit, fragte ich erstaunt, ob er mir nicht das Wichtigste in Kürze sagen könne. Oskar griente. Wir brauchen Sportlehrer und Trainer, sagte er. Und zitierte Ulbricht aus dem Sportecho: »Die Grundsteinlegung dieser Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport ist ein bedeutendes Ereignis für ganz Deutschland, denn diese Hochschule soll die wissenschaftliche Arbeit entwickeln, die für die Körperkultur und Sportbewegung im künftigen einheitlichen, friedlichen und demokratischen Deutschland richtungsweisend sein wird.« Ich verstand nur Bahnhof. In Köln gibt es seit 1947 eine Sporthochschule, die von Carl Diem geleitet wird. – Ich zog die Schultern hoch. Mann, das ist ein alter Nazi. Der hat 1936 die Olympischen Spiele in Berlin organisiert und noch am 18. März 1945 in einer flammenden Rede Hitlerjungen im Kuppelsaal des Berliner Olympiageländes zu einem »finalen Opfergang für den Führer« aufgefordert. In den folgenden Tagen starben in der Nähe des Reichssportfeldes und an den Pichelsdorfer Brücken beidseits der Heerstraße Hunderte Jugendliche bei dem Versuch, sowjetische Panzerverbände mit Handfeuerwaffen und Panzerfäusten aufzuhalten. Und der ist jetzt Chef der Sporthochschule in Köln und erzieht junge Leute? Ich konnte es nicht glauben. Verstehst du nun, warum wir hier einen anderen, antifaschistischen Neuanfang machen müssen, sagte Oskar. Ja, schon, antwortete ich, aber ich will doch nur Sport treiben. Wenn du studierst, musst du nicht nur die Muskeln, sondern auch das Hirn trainieren. Immer fragen, warum was gekommen ist, wie die Zusammenhänge und Hintergründe sind. Na, warten wir’s ab, dachte ich. Am 15. April 1953 herrschte große Aufregung an der Schule. Ulbricht kam und erkundigte sich nach dem Fortgang der Bauarbeiten und den Fortschritten bei der Entwicklung der Lehre. Im Audimax sprach er zu uns Studenten und den Lehrkräften. Dabei ging es ihm vor allem um Erziehungsfragen. Als wenn er sich mit Oskar abgesprochen hätte, kam er darauf, dass es keine Trennung geben dürfe zwischen der fachlichen Ausbildung im Unterrichts- und Trainingsprozess einerseits und der politisch-moralischen Erziehung andererseits. Das müsse als ein einheitlicher Vorgang gesehen werden. In diesem Kontext fielen Worte wie Patriotismus und Liebe zur Heimat. Ulbricht kam noch einige Male nach Leipzig, er hatte offensichtlich großes persönliches Interesse, dass hier etwas Ordentliches entstand, was weit in die Zukunft reichen würde. Auch wenn er jedes Mal betonte, dass der Massen- und Breitensport nicht vernachlässigt werden dürfe, schließlich sei er wesentlich für die Volksgesundheit, so wurden doch in erster Linie an der DHfK die Grundlagen für die Erfolge in den folgenden Jahrzehnten im Spitzensport gelegt, der ohne die Basisarbeit undenkbar war. Nicht nur ich bedauerte, als 1975, als an die Gründung der Hochschule vor einem Vierteljahrhundert feierlich erinnert wurde, der Mann, der mehr als nur den Grundstein gelegt hatte, nur mit einem einzigen Satz erwähnt wurde.
Gustav-Adolf (»Täve«) Schur: Sport nicht nur für Titel und olympische Medaillen
Gustav-Adolf (»Täve«) Schur, Jahrgang 1931, gelernter Maschinenmechaniker, seit 1950 Radsportler. 1952 erstmals Teilnahme an der Internationalen Friedensfahrt, 1953 erstmals DDR Sportler des Jahres (es folgten weitere acht dieser Titel). 1958 und 1959 Weltmeister, 1956 und 1960 Mitglied der gesamtdeutschen Olympiamannschaft, in Melbourne holte er mit der Mannschaft Bronze, in Rom Silber beim Mannschaftszeitfahren. 1963 Abschluss des Trainerstudiums mit Diplom an der DHfK in Leipzig. 1964 Ende der aktiven Sportlerlaufbahn, danach, bis 1973 Trainer. 1992 eröffnete er einen Fahrradladen in Magdeburg, der von einem seiner vier Kinder geführt wird. Er gehörte von 1958 bis 1990 der Volkskammer an, von 1998 bis 2002 saß er für die PDS im Deutschen Bundestag. Ich war 1971 mit meiner Familie nach Oberhof gefahren, um einmal ein Skispringen zu erleben. Man hatte unterhalb des Kampfrichterturms der Thüringen-Schanze einen Tribüne errichtet, von der aus wir den Sprunglauf verfolgten. Zwischen meiner Frau Renate und mir hockten unsere vier Kinder. Im Kampfrichterturm sah ich Walter und Lotte Ulbricht, und diese schien mich zu erkennen, nahm die Kamera vors Auge und drückte ab. Dieses Foto schickte sie uns später, auf der Rückseite hatte sie geschrieben: »Genossen Täve Schur: Diese Aufnahme eines Laien von oben herab während des Weihnachtsspringens in Oberhof. Alles Gute Dir und Deiner Familie – Lotte Ulbricht – Dezember 1971.« Das Bild kam als Antwort auf meine Weihnachtsgrüße 1972. Auf dem beigefügten Brief hatte es geheißen: »Lieber Täve! Eure herzlichen Festtagswünsche haben uns ganz besonders gefreut. Habe dafür herzlichen Dank. Dir und Renate wünschen wir ebenfalls von ganzem Herzen alles Gute, den Kindern – soweit sie in die Schule gehen – gute Erfolge und vor allem viel Freude bei Spiel und Sport. Herzlichst Eure Walter und Lotte Ulbricht.« Es war nicht das erste Schreiben von den Ulbrichts, es sollte jedoch das letzte gewesen sein, unter dem beider Namen stand. Erstmals hatte ich einen offiziellen Brief von ihm nach dem Sieg der Weltmeisterschaft in Reims 1958 erhalten. »Im Namen des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beglückwünschen wir Dich recht herzlich zu dem tapfer erkämpften Weltmeistertitel der Amateur Straßenfahrer. Dein großartiger Sieg ist das Ergebnis Deiner fleißigen Arbeit und hervorragenden Haltung als Sportler. Darauf sind die Werktätigen, vor allem die Jugend unserer Republik, stolz. Sie freuen sich mit Dir, weil Dein Sieg ein Teil unseres gemeinsamen Kampfes für Frieden und Sozialismus ist. Dein Beispiel ist ein Ansporn für viele, das Ansehen unserer Deutschen Demokratischen Republik in der Welt zu erhöhen. Wir wünschen Dir weiterhin alles Gute für Deine berufliche und sportliche Entwicklung.« Wer genau zu lesen vermag, wird erkennen, dass es keine Gratulation »von der Stange« war. Vor allem aber widerlegt es die These, in der DDR sei der Sport einzig deshalb gefördert worden, um Titel und Medaillen zu gewinnen. Nein, es ging um mehr: Sport war, wie Ulbricht schrieb, »Teil unseres gemeinsamen Kampfes für Frieden und Sozialismus«. Die Ruhmsucht war eher anderenorts zu Hause. Bundesinnenminister Werner Maihofer erklärte 1974 im Deutschen Bundestag: »Ob wir es wollen oder nicht: Sport als Spitzensport ist immer auch ein Wettstreit der Nationen und der Kontinente. Daran führt überhaupt nichts vorbei«, so der für den Sport zuständige Minister der BRD. »Damit wird Sport gerade heute zu einer der Hauptsachen nationaler Identifikation und nationaler Repräsentation, ja zu einem Gradmesser für die Leistungsfähigkeit des jeweiligen politischen Systems. Auch diese – ob wir dies nun wollen oder nicht staatspolitische Bedeutung des Sports können wir nicht hoch genug veranschlagen. Dieses grundsätzliche Verständnis von Sport in unserer heutigen Welt steht auch hinter der Sportpolitik dieser Bundesregierung.« Ulbricht hat nie erklärt, dass der Sport ein »Gradmesser für die Leistungsfähigkeit des jeweiligen politischen Systems« sei, er maß ihm in diesem Sinne keine »staatspolitische Bedeutung« zu. Als ich heiratete, schickte er mir und Renate Glückwünsche. Und weiter hieß es: »Lieber Genosse Schur! In Deinem bisherigen Leben hast Du bewiesen, dass Du ein treuer Sohn unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates bist. Dein bescheidenes und offenes Auftreten, Deine faire sportliche Haltung haben Dir auch in der internationalen Sportöffentlichkeit uneingeschränkte Achtung eingebracht. Zu jeder Zeit bist Du als Vertreter des neuen sozialistischen Deutschlands aufgetreten. Mit Recht wurdest Du im vergangenen Jahrzehnt zur populärsten Sportlerpersönlichkeit der DDR. Deshab sieht die Jugend in Dir ihr großes Vorbild. Wir wünschen Dir, lieber Täve, und Deiner Gattin auf Eurem gemeinsamen Lebensweg von ganzem Herzen gute Gesundheit und weiterhin große Erfolge und viel Freude im sportlichen und persönlichen Leben.« Ulbrichts Zurückhaltung bei der Instrumentalisierung des Sports durch die Politik erlebte ich auch bei einer Runde mit Sportlern und Funktionären aus West und Ost. Seit Beginn der 50er Jahre kamen sie alljährlich zu den Oberhofer Gesprächen zusammen. Diese– wie auch andere Gesprächskreise und Begegnungen – waren von der DDR ins Leben gerufen worden und als Versuch gedacht, der wachsenden Spaltung durch Westintegration und Remilitarisierung der Bundesrepublik wirksam zu begegnen. Die Losung »Deutsche an einen Tisch!« sollte uns in der DDR bis in die späten 60er Jahre begleiten. Walter Ulbricht nahm oft an diesen Runden in Oberhof teil, die sich dadurch auszeichneten, dass jeder sagen und fragen konnte, was ihn bewegte. Einmal vergewisserte sich bei mir ein westdeutscher Sportfunktionär, ob ich denn nicht auch in der Bundesrepublik freundliche Aufnahme finden würde, womit er versöhnlich sagen wollte, dass Kalter Krieg und Sport nichts miteinander zu tun hätten und auf unserem Felde alles sehr gesittet zuginge. Ja, ich könne mich nicht beklagen, antwortete ich – auch in der Bundesrepublik würde man mir meist sehr freundlich begegnen. Manchmal sogar so freundlich, dass man mir einen Platz in einem westdeutschen Sportverein anbietet und, kehrte ich nicht in die DDR zurück, auch eine recht ordentliches Fortkommen verspricht. Walter Ulbricht verzichtete auf eine Kommentierung und wechselte behutsam das Thema.
Günter Erbach: In 19 Monaten Bauzeit entstand das größte Stadion der DDR
Günter Erbach, Jahrgang 1928, 1945 Landarbeiter, 1946 SED, Neulehrer, anschließend Studium an der Universität Greifswald, 1949 bis 1953 wissenschaftlicher Aspirant an der Humboldt-Universität zu Berlin, 1953 bis 1955 Leiter der Zentralen Sportschule Strausberg, 1956 bis 1963 Rektor der Deutschen Hochschule für Körperkultur und Sport Leipzig, 1965 bis 1974 Stellvertreter des Staatssekretärs für Körperkultur und Sport, von März 1974 bis 1990 Staatssekretär. Seit 1983 Präsident des deutschen Fußballverbandes der DDR. Günter Erbach verstarb am 4. Juni 2013. Du hast den größten Teil deines Lebens im sportwissenschaftlichen Bereich gearbeitet. Kannst du dich erinnern, warum die DHfK gegründet wurde? Ausgangspunkt war das Gesetz zur Förderung der Jugend und des Sports, das am 8. Februar 1950 von der Volkskammer beschlossen wurde. Ulbricht hat es als Stellvertretender Ministerpräsident sehr leidenschaftlich begründet, was wohl auch mit seinen persönlichen Erfahrungen als Arbeitersportler zusammenhing. Mit diesem Gesetz wurde eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht, darunter auch die Errichtung einer Hochschule für Körperkultur und Sport. Am 22. Oktober 1950 erfolgte die feierliche Gründung. Das war eine weitsichtige und richtige Entscheidung, die auch bald von der Bevölkerung als solche wahrgenommen wurde. Walter Ulbricht besuchte regelmäßig seine Heimatstadt Leipzig. Du warst Aspirant an der DHfK in deren Gründungsphase. Bist du ihm dort begegnet? Im Sommer 1951 erlebte ich seine erste Visite auf der Baustelle. Zunächst war er in der Friedrich-Ebert-Straße 130, wo die DHfK seit dem Herbst des Vorjahres provisorisch untergekommen war. Die 96 Studenten und 14 Lehrkräfte begrüßten ihn, dann ging es ins Gelände, wo mit dem Aufbau des Sportforums und der Gebäude am Elsterflutbecken begonnen werden sollte bzw. bereits begonnen worden war. Lehrkräfte, Architekten, Verantwortliche des Rates der Stadt und Sportfunktionäre erlebten dabei eine lehrreiche Stunde operativer Arbeit. Auf dem Areal, auf dem der Hochschulkomplex entstehen sollte, waren in den 40er Jahren Schrebergärten angelegt worden. An der Brücke, neben der der markante Bibliotheksturm gebautt wurde, befand sich ein großer Sandwall. Der wurde gemeinschaftlich erklommen, um sich einen Überblick zu verschaffen. Lageskizzen wurden hervorgeholt, die Architekten erläuterten, Walter Ulbricht hörte aufmerksam zu. Dann kamen plötzlich einige verärgerte Kleingärtner, die sich beschwerten, dass sie ihre Gärten aufgeben sollten. Ulbricht ging auf sie zu und reagierte. Sehen Sie, sagte er, Sie wollen doch auch, dass Ihre Kinder gesund aufwachsen, dazu brauchen wir aber wissenschaftlich ausgebildete Sportlehrer. Wir müssen auch an das Morgen denken. – Tun wir ja, kam der Einwand, deshalb bauen wir Obst und Gemüse an, damit wir morgen etwas zu essen haben. Ulbricht nickte und lieferte selbst ein weiteres Argument für die Gärten: Man solle den Erholungswert nicht unterschätzen. Auch das wäre ein wichtiger Faktor. Und nun? Wir werden dafür sorgen, dass Ihnen anderenorts Ersatzflächen angeboten werden, sagte er. – Aber mit der gleichen Bodenqualität, kam die Entgegnung. Ulbricht nickte. Er wolle mit dem Rat der Stadt sprechen, dass eine gemeinsame, einvernehmliche Lösung gefunden werde, ja. Für uns, die wir dabei waren, war das eine Lehrstunde der Demokratie. Kaum ein Jahr nach dieser Projektberatung, am 17. Mai 1952, war Walter Ulbricht wieder da und legte den Grundstein. Wie war das? Es war ein festlicher Tag, jeder war sich bewusst, dass es ein historisches Datum für die demokratische Sportbewegung war. Rings um einen kleinen eingeebneten Platz, inmitten der inzwischen geräumten Kleingartenanlage, hatten sich die Studenten und Lehrkräfte versammelt. Drei Hammerschläge erklangen. In schlichten Worten artikulierte Ulbricht die Wünsche der Regierung und der Partei, dass hier künftig Sportlehrer und Trainer ausgebildet werden würden, bereit und fähig, die heranwachsenden Generationen zu körperlich gesunden, widerstandsfähigen und mutigen Menschen zu erziehen. »Denkt daran«, so forderte er uns auf, »gut und fleißig zu lehren und zu lernen, werdet überzeugte Patrioten für ein neues demokratisches Deutschland!« Die Geschichte der deutschen Sportbewegung – von Turnvater Jahn bis in die Gegenwart – ist sehr facettenreich. Was war das Besondere an dieser Hochschule? Mit der Gründung der DHfK wurde ein neues Blatt in der Geschichte der deutschen Sportwissenschaft aufgeschlagen. Es entstand ein Zentrum der Ausbildung und Erziehung von Sportlehrern und Trainern, zugleich aber auch eine Stätte sportwissenschaftlicher Forschung. Die Errichtung der DHfK war eine eindrucksvolle Dokumentation der Förderung von Körperkultur und Sport durch den Staat der Arbeiter und Bauern, ein sichtbarer Beweis für die hohe Wertschätzung und den Platz, den der Sport in der sozialistischen Gesellschaftsordnung besaß. Aufs Ganze gesehen absolvierten Zehntausende Studenten die verschiedenen Ausbildungsrichtungen. Es gab einen erfolgreich tätigen Lehrkörper, der in modernen Hallen, Instituten und Kabinetten unterrichtete und in Labors forschte. In den Sportanlagen des großzügig angelegten Sportforums wurde trainiert und die Basis für hohe sportliche Leistungen gelegt. Die DHfK hatte Promotionsrecht und unterhielt Beziehungen zu Sportwissenschaftlern aus mehr als vierzig Staaten. Von besonderer Bedeutung für die Entwicklung der Hochschule war die enge Verbindung zum Leben, zu den vielfältigen Aufgaben, die unmittelbar in der Praxis der sozialistischen Körperkultur zu lösen waren. Die Tätigkeit des Deutschen Turn- und Sportbundes und seiner Sportverbände war eng mit der Arbeit der Hochschule verknüpft. Ein Großeil der Sportlehrer, Trainer und Funktionäre des DTSB hatte sie durchlaufen. Wenn auch der Beitrag der Hochschule an den von DDR-Sportlern erzieltenWelthöchst und Spitzenleistungen im Einzelnen nicht konkret zu bemessen war, so steht außer Frage, dass er groß war. Aus deinen Darlegungen schließe ich, dass Walter Ulbricht der Entwicklung der DHfK besondere Aufmerksamkeit widmete. Das war unübersehbar. Regelmäßig überzeugte er sich davon, ob und wie es voranging. Heutzutage wird alles zur Chefsache erklärt, ohne dass dies Folgen hätte. Ulbricht hatte die DHfK keineswegs zur Chefsache erklärt, aber er behandelte sie als eine solche. Mindestens einmal pro Jahr schaute er in der Anfangszeit vorbei. Am 15. April 1953 war er wieder da und diskutierte fast vier Stunden mit Lehrkräften und Studenten. Dem schloss sich eine weitere Beratung über die Baupläne an. Wie immer gab es zu seinen Überlegungen eine lebhafte Aussprache. Walter Ulbricht erläuterte jedes Mal sehr überzeugend den inneren Zusammenhang zwischen Sport und sozialistischer Gesellschaft. Ihm ging es um die Entwicklung gesunder und gebildeter, willensstarker und zielbewusst handelnder Menschen, wozu die Schule ihren Teil leisten sollte. Er bot eine Vorlesung neuer Art für Lehrkräfte und Studenten, ein Gespräch über die Bedeutung der Wissenschaft bei der Entwicklung von Körperkultur und Sport. Wissenschaft und Sport, Politik und Sport müssten eine Einheit bilden und auch in der Praxis unserer Arbeit ein Ganzes werden. »Früher haben wir hier als Jungen Fußball gespielt und im Winter Eishockey, wir sind auf der Elster Schlittschuh gelaufen und alles ohne Anleitung«, erinnerte er sich seiner Leipziger Vergangenheit. »Ein alter Turnlehrer hat uns in den Turnstunden angeleitet. Jetzt sollt ihr, mit guten wissenschaftlichen Kenntnissen ausgerüstet, Sportlehrer unseres neuen Staates werden. So hat sich in unserer Zeit die Situation verändert. Wir brauchen die wissenschaftliche Durchdringung der Körperkultur, um auch im Sport das gute Beispiel für ganz Deutschland zu geben.« In der Folgezeit entstand die Trainerfakultät und wurde das Fernstudium für Körpererziehung eingeführt, übrigens erstmalig in der deutschen Sportgeschichte. Wissenschaftliche Konferenzen über theoretische Probleme der Körperkultur und des Sportes und anregende Lehrbücher folgten. Im Januar 1954 besuchte Ulbricht erneut die Hochschule. Inzwischen wurden bereits Beziehungen zu ausländischen Einrichtungen geknüpft und deren Erfahrungen ausgewertet und um eigene Beiträge bereichert. Walter Ulbricht förderte dieses Entwicklung aus ganzem Herzen und freute sich mit uns über die ersten Erfolge. Immer wieder forderte er, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf die Qualität der wissenschaftlichen Ausbildung und Forschung lenken sollten. Gab es in jenen Jahren besondere Themen, die sein Interesse hervorriefen? Ja. Die Biomechanik hatte es ihm angetan. Im Vorfeld des II. Deutschen Turn- und Sportfestes 1956 hatten wir eine Ausstellung dazu ausgerichtet. Es gab dabei eine politisch und fachlich sehr interessante Aussprache, an der sich neben Walter Ulbricht vor allem Alfred Neumann beteiligte. Der Berliner »Ali« Neumann, einst »Fichte«-Sportler und Sportlehrer im sowjetischen Exil, interessierte sich ebenfalls für unsere Forschungen. Solche Unterstützung half, in wenigen Jahren eine voll ausgebaute wissenschaftliche Lehr- und Forschungsstätte zu schaffen. Der bekannte britische Journalist Sefton Delmer (1904-1979) schrieb annerkennend ins Gästebuch: »Ich sehne den Tag herbei, an dem in Großbritannien eine solche Hochschule entsteht. Sie ist ein Beispiel für uns alle.« Mitte der 50er Jahre wurde das Leipziger Zentralstadion errichtet, es war damals die größte Sportanlage der DDR. Wer hatte die Idee, auch Ulbricht? Nein. Die Idee stammte aus der Zeit der Weimarer Republik und wurde von etlichen Arbeitersportlern in Leipzig neuerlich ins Gespräch gebracht, als es beschlossene Sache war, dass es im August 1956 ein zweites Deutsches Turn- und Sportfest geben würde. Das erste hatte auf einer Festwiese 1954 stattgefunden. Von der Planung bis zur Einweihung dieses 100.000 Besucher fassenden Stadions vergingen keine 18 Monate. Nun ist ein Stadion kein Flugplatz, aber angesichts der damals vorhandenen Technik war es dennoch ein grandiose Leistung aller daran Beteiligten. Im Februar 1955 wurden dem Politbüro und dem Ministerrat die Pläne zur Beratung und Entscheidung vorgelegt. Erwartungsgemäß unterstützte besonders Ulbricht die kühnen Vorschläge, indem er formale und bürokratische Hindernisse aus dem Weg räumte. Überzeugt vom Aufbauwillen und der Sportbegeisterung der Leipziger orientierte er zugleich auf die freiwillige Mitarbeit der Bevölkerung im Rahmen des Nationalen Aufbauwerks. Wenige Monate nach der Entscheidung besuchte er im Juli 1955 erstmals die riesige Baustelle. Täglich arbeiteten dort etwa 2.000 bis 2.500 Menschen, die Betonmischer liefen rund um die Uhr, Lkw und Dumper bewegten Erdmassen und Kies, Bagger und Planierraupen fraßen sich in den Grund. Wie üblich führte er intensive Gespräche auf der Baustelle mit Arbeitern, freiwilligen Helfern, Architekten und Ingenieuren. Es heißt, er soll wiederholt unangemeldet auf der Baustelle erschienen sein. Das stimmt. Wenn er in der Stadt aus anderen Gründen zu tun hatte, machte er sich stets selbst vom Fortgang der Arbeiten ein Bild. In den frühen Morgenstunden des 4. August 1956 erfolgte der letzte Hammerschlag. Das war knapp, ja. Am Vormittag fanden – unter aktiver Mitwirkung aller Mitarbeiter und Studenten der DHfK die letzten Proben statt. Die Premiere der Sportschau am Nachmittag war der Höhepunkt des II. Deutschen Turn- und Sportfestes. Zum 10. Jahrestag der Gründung der DHfK gab es eine Festwoche, auf der auch Walter Ulbricht zugegen war. Welche Erinnerungen hast du an dieses Ereignis? Du warst ja inzwischen Rektor der Hochschule. Wir alle waren Tage zuvor und besonders am Morgen des 22. Oktober 1960 voller Erwartung. Die Festwoche zum Jubiläum bot eine eindrucksvolle Bilanz. Gäste aus dreizehn Ländern, darunter aus afrikanischen Nationalstaaten, und Vertreter des Weltrates für Körpererziehung und Sport waren erschienen. An der Konferenz nahmen auch Kollegen aus befreundeten sozialistischen Staaten teil. Walter Ulbricht kam, obwohl stark erkältet. Hinter ihm lag eine ausgedehnte, anstrengende Reise durch die südlichen Bezirke unserer Republik mit vielen Terminen. Dabei hatte er sich derart erkältet, dass ihm das Sprechen sichtlich Mühe bereitete. Dennoch blieb er einen ganzen Tag an der Hochschule und machte keine Abstriche am Programm. Er hatte zugesagt und hielt sein Versprechen, obwohl es jeder verstanden hätte, wenn er sich ins Bett gelegt hätte, wo er auch hingehörte. Auf der Festveranstaltung betonte er: »Die Anforderungen an die Hochschule werden wachsen, und was gestern noch gut war, kann morgen nicht mehr ausreichen. Das Bessere möge stets der Gegner des Guten sein.«
Gerhard Mendl: Ich schwamm mit Ulbricht vor Warnemünde um die Wette
Gerhard Mendl, Jahrgang 1928, nach Besuch der Grundschule von 1943 bis 1946 Maschinenschlosserlehre, 1946 Mitglied der FDJ, 1947 der SED, von 1947 bis 1971 in ehrenamtlichen bzw. hauptamtlichen FDJ-Funktionen. 1953/54 Besuch der Hochschule des Komsomol und von 1971 bis 1974 der Parteihochschule der KPdSU in Moskau. Von 1954 bis 1960 in Rostock 1. Sekretär der Bezirksleitung der FDJ. Danach, bis 1971, Vorsitzender des Komitees für Touristik und Wandern der DDR. Von 1974 bis 1989 verschiedene Funktionen der SED im Bezirk Erfurt. Aktuell Vorsitzender einer Basisorganisation der Partei »Die Linke« in Erfurt. Es war gegen 11 Uhr an einem sonnigen Sonnabend im Juli. Die Ostsee, die durch ihre kurzen, tückischen Wellen bekannt ist, zeigte sich ruhig, als ob sie schliefe. Die Ostseewoche neigte sich bereits dem Ende zu. Die Bezirksleitung der SED, der Rates des Bezirkes, die Spitzen der anderen demokratischen Parteien, der Oberbürgermeister und Bürger, die sich um den sozialistischen Aufbau des Ostseebezirks verdient gemacht hatten, standen in der Empfangshalle des Hotels »Stoltera« in Rostock-Warnemünde und warteten. Sie erwarteten den ersten Mann des Staates und der Partei, der seit 1958, als die Ostseewoche erstmals begangen wurde, alljährlich im Juli an die Küste kam. Die Wagen fuhren vor, die Begrüßung verlief in freudiger Stimmung und optimistischer Erwartung. Was würde WU sagen? Er wollte in der nur wenige Meter entfernten Ostsee schwimmen und dabei von den Gastgebern begleitet werden. Betretenes Schweigen verbreitete sich im Raum, niemand war darauf vorbereitet, keiner hatte Badezeug dabei. Karl Mewis, 1. Sekretär der Bezirksleitung, entschied wie gewohnt: kurz und bündig und ohne Rücksprache: »Unser Jugendsekretär vertritt uns alle. Er ist der Jüngste und am widerstandsfähigsten.« Dabei zeigte er auf mich. Widerspruch war hier nicht angebracht, das war mir bewusst. Ulbricht reagierte gelassen: »Nun gut, machen wir es so!« Auf dem Weg zum Strand stellte er mir Fragen. Er wollte wissen, was die Jugend im Bezirk so mache, ob es Initiativen der FDJ-Bezirksorganisation gäbe und dergleichen mehr. Ich informierte über den Verlauf der Ostseewoche und das Lager der Jugend der Ostseeländer und Islands. Ulbricht interessierte sich auch über den Fortgang der Bauarbeiten am Rostocker Überseehafen. Künftig sollten in diesem Hochseehafen nicht nur Schiffe, mit 3.000 BRT gelöscht werden, sondern auch 10.000-Tonner. In wenigen Monaten waren für den Ausbau der Hafen-Mole 3,5 Millionen Mark von der Bevölkerung der DDR, vor allem von den Mitgliedern der Freien Deutschen Jugend und den Pionieren der Pionierorganisation »Ernst Thälmann« gespendet worden und vor allem: Steine gesammelt. Wir stiegen ins Wasser, die Personenschützer blieben am Ufer zurück. Wahrscheinlich hatten sie auch keine Badehosen dabei. Als wir außer Hörweite waren, rief er mir zu: »Komm, wir schwimmen um die Wette!« Nach etwa 100 Meter ging mir die Luft aus. Ulbricht schwamm mir davon. Ich hatte verloren. Am darauffolgenden Tag schrieb die Junge Welt: »Walter Ulbricht schlägt FDJ-Sekretär im Schwimm-Wettbewerb in der Ostsee!« Nun, es gab Schlimmeres.
Erich Postler: Wie mich Ulbricht als Einzelbauer auf dem FDJ Parlament rettete
Erich Postler, Jahrgang 1940, Staatlich geprüfter Landwirt, 1962 LPG »Komsomol« in Fürstenwerder, dann Sekretär für Landjugend und 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung Schwerin, Komsomolhochschule Moskau, 1969 Sekretär für Landjugend, ab 1976 2. Sekretär des Zentralrates der FDJ, von 1981 bis 1989 2. Sekretär der SED-Bezirksleitung Schwerin, Mitglied des ZK der SED von 1976 bis 1989. Im November/Dezember 1989 in Gera 1. Sekretär der SED Bezirksleitung, Rückkehr nach Mecklenburg und Tätigkeit im VEG Banzkow. Ab 1995 ehrenamtlich aktiv im Solidaritätskomitee für die Opfer der politischen Verfolgung in Deutschland. Meine wichtigste und sehr persönliche Begegnung mit Walter Ulbricht ist rasch erzählt. Ihre Folgen für meinen Lebenslauf zu berichten würde viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Mit 17 Jahren wollten die Mitglieder der FDJ in meinem thüringischen Heimatdorf, dass ich Sekretär, also Vorsitzender, ihrer gerade gebildeten Grundorganisation (damals noch Grundeinheit) sein sollte. Das Vertrauen überraschte und verwunderte mich sehr. Ich hatte noch nie vor einer solchen Entscheidung gestanden. Ein paar Sekunden schmeichelte es mir, aber dann sah ich ungewohnte Aufgaben auf mich zukommen und sträubte mich heftig. Aber es half nichts. Meine Freunde trauten mir mehr zu als ich selbst, und Erika Richter, die Greizer Kreisvorsitzende, sagte Anleitung und Hilfe zu. Die Mitglieder – alles Jugendliche meines Alters – schworen, aktiv zu sein und mich zu unterstützen. Also: alles halb so schlimm, du wirst es schon schaffen! Von zehnklassiger und Berufsschule inspiriert, war ich der Politik der DDR durchschnittlich und mit manchen Vorbehalten zugetan. Jedenfalls stand ich ihr nicht ablehnend gegenüber. Für Letzteres gab mir das Haus meiner Pflegeeltern auch keinen Anlass. Erich Reinhold, mein Pflegevater, war auf seinem Pachthof ein angesehener Bauer. Er konnte keiner Fliege etwas zuleide tun und nur schwer »Nein« sagen. Das war wohl auch ein wichtiger Grund dafür, dass er als Parteiloser im Gemeinderat, dem Ortsausschuss der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, und im Ortsvorstand der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB-BHG) viele Jahre ehrenamtliche Arbeit leistete. Reden war nicht seine Stärke. Wir konnten einen ganzen Tag schweigend miteinander arbeiten. Aber seine Geradlinigkeit und seinen Gemeinsinn wussten die Leute zu schätzen. Das erleichterte es mir, trotz der langen Arbeitstage auf dem Bauernhof – dazu gehörten zehn Hektar die nötige Zeit für meine neue Aufgabe zu bekommen. Ich vermute, dass meine Wahl zum Dorfsekretär der FDJ in meinem Elternhaus zwiespältig aufgenommen wurde: ein bisschen Stolz, dass man es dem Jungen zutraute, und ein wenig Furcht, er könne zu oft auf dem Acker und im Stall fehlen. Letzteres war natürlich nicht unbegründet. Zu meiner Überraschung ließ sich die FDJ-Arbeit im Dorf besser an, als ich befürchtet hatte. Die Anleitung vom Kreis fehlte nicht. Wenn man wollte, konnte man etwas daraus machen. Das Interesse eines Teiles der Dorfjugend (die Bauernkinder hielten sich weitgehend fern), die Freizeit gemeinsam zu verbringen, bildete die Basis für ein durchaus vielfältiges Jugendleben, das die Dorfbevölkerung mit gewisser Neugier verfolgte. Im Schaukasten informierten wir über uns, gratulierten den Dorfbewohnern zu den Feiertagen, und dass zum ersten Mal ein Tannenbaum in der Dorfmitte erstrahlte, wusste man uns zu danken. Der Bürgermeister, der froh war, endlich die Kritik los zu sein, keine FDJ-Gruppe im Ort zu haben, mietete uns bereitwillig einen Jugendraum, den wir uns nach eigenem Gusto und aus eigener Kraft, natürlich mit Fördermitteln der Gemeinde, einrichteten. Davon wiederum profitierten auch andere, so die Frauen mit ihrer DFD-Gruppe,[Anmerkung 79] die Freiwillige Feuerwehr und auch die Gemeindevertretung, die einen zusätzlichen Raum für Sprechstunden und anderes hatte. Unsere Versammlungen, Arbeitsgemeinschaften und Veranstaltungen waren öffentlich, und so nahmen oft viel mehr Jugendliche teil, als unsere Gruppe Mitglieder zählte. Es war kein Triumphzug, zumal sich die Gruppe von 17 FDJlern kaum erweiterte, aber wir nützten uns und anderen. Es war nicht die große Politik, die anzog, sondern es waren in erster Linie die unmittelbaren Interessen der Jugendlichen, an die wir anknüpften. Natürlich blieb unser Tun nicht unbeachtet, und so erschien Reinsdorf manchmal auf der Kreisseite der Volkswacht. Im Frühjahr 1959 durfte ich zum ersten Mal in einem Präsidium sitzen, das war auf der Kreisdelegiertenkonferenz der FDJ. In der Diskussion berichtete ich über die Aktivitäten meiner Freunde und unsere Erfahrungen. Mit dem mir angeborenen Streben nach Vollständigkeit hatte ich alles aufgezählt, was wir so machten und wie wir das zustande gebracht hätten. Andere Dorfgruppen konnten da offenbar nur schwer mithalten. Das wunderte mich sehr, denn wir hatten ja gerade erst angefangen, während andere schon viel länger existierten. So nahm das Schicksal seinen Lauf. Ich erfuhr Anerkennung, die, wie ich es empfand, weit über der erbrachten Leistung lag, und landete auf der Kandidatenliste für das Präsidium des VI. Parlaments der FDJ, das vom 12. bis 15. Mai 1959 in Rostock stattfand. Im Protokoll wurde ich geführt als »Erich Postler, FDJ Gruppenleiter und Einzelbauer im Bezirk Gera«.[69] Das war natürlich nicht korrekt, denn ich war noch Lehrling auf dem elterlichen Hof und hatte dies stets bekundet. Aber ich wurde den Einzelbauern nie los und habe zu dementieren irgendwann aufgegeben. Wie ich bald merkte, ging es auch gar nicht um meine konkrete soziale Stellung, sondern darum, dass ich ein Jugendlicher aus der privaten Landwirtschaft war, unter denen die FDJ damals kaum Einfluss hatte. Meine Freunde von der Bezirksleitung Gera, die mich auf dem Parlament zu reden aufforderten, wollten, dass die Delegierten – gleichsam aus berufenem Munde – zu einem sehr aktuellen Thema eine authentische Meinung zu hören bekamen: zur Umgestaltung der Landwirtschaft, dem Übergang zum genossenschaftlichen Wirtschaften. Es kann gut sein, dass wir vom Ergebnis unterschiedliche Vorstellungen hatten, aber für manche meiner Argumente hatten sie sogar die Fakten geliefert. So angeregt gab ich meine Wortmeldung ab und machte mich an die Formulierung. Ich schrieb abends und nachts nach den Beratungen in einem Privatquartier für Delegierte in Warnemünde, das ich mit Heinz Przibylla teilte, einem Hauer der SDAG Wismut und Held der Arbeit. Ein Glück, dass ich nicht am ersten, sondern erst am dritten Beratungstag dran war. Ich hätte keine Zeile gehabt. Keiner hatte meine Rede vorher gesehen, keiner wollte sie sehen. Nur meinem Quartierkollegen Heinz las ich die kritischen Stellen vor. Der bestärkte mich, und so ging ich zwar hinreichend aufgeregt, aber ohne Argwohn in den neuen Beratungstag und noch am Vormittag ans Mikrofon. Noch nie hatte ich vor so vielen Leuten gesprochen, und ich war auch noch nie so weit weg von meinem Dorf. Rückblickend wundere ich mich immer wieder über meine damalige Courage. Ein Desaster. Der Saal murrte, war über weite Strecken empört, meine Förderer zeigten sich enttäuscht bis entsetzt. Nur der festen Überzeugung von der Richtigkeit meiner Meinung kann ich es zuschreiben, dass ich das Manuskript bis zur letzten Zeile vortrug. Was war geschehen? Es begann damit, dass ich eine Passage im Referat des 1. Sekretärs des Zentralrats, Karl Namokel, kritisierte, der die Ausbildung an der Sense für nicht mehr zeitgemäß hielt, was ich nicht verstehen konnte. Ich stellte unumwunden klar, dass die FDJ unter der einzelbäuerlichen Jugend kaum Einfluss habe und beschwerte mich, dass man mich als Vorzeige-Bauer benutzte. Ich fand es ungerecht, dass im Präsidium des Parlaments zwar fünf FDJler aus LPG und VEG säßen, aber ich sei der einzige, der aus der privaten Landwirtschaft käme. Wenn von der Landjugend die Rede ist, so kritisierte ich, blieben die jungen Einzelbauern unbeachtet. Sodann versuchte ich zu vermitteln, was in den Köpfen von Einzelbauern und ihren Kindern vor sich gehe, wenn sie über den Eintritt in eine Genossenschaft nachdachten, und warnte vor überzogenen Erwartungen. Ich forderte Geduld und handfeste Argumente, vor allem gute Genossenschaften mit hohem Einkommen. Lese ich diese Rede heute, so führt sie mir meine eigene innere Zerrissenheit und eine gewisse Ratlosigkeit vor Augen. Im Kern war ich dem Neuen, dem Sozialismus zugetan, auch und gerade auf dem Lande. Mit dem Weg dorthin hatte ich meine Schwierigkeiten. Viele Fragen und zu wenig Antworten. So war der Dissens zwischen mir und einem Großteil der Delegierten unvermeidlich. Vorwärts hieß für sie, Lösungen und Taten auf den Tisch! Ich aber hatte damals mehr Probleme. Es gehört wohl zu den Glücksmarken auf meinem Lebensweg, dass Walter Ulbricht im Saal saß und mir aufmerksam zuhörte. Am nächsten Tag sprach er und erteilte meinen zahlreichen Widersachern unaufgeregt eine überzeugende Lektion: »Ihr habt hier die Darlegungen des Jugendfreundes gehört, der noch auf dem Hof eines Einzelbauern arbeitet. Er hat aufgezeigt, wie kompliziert es ist, die wohlhabenden Mittelbauern zu gewinnen. Einige von euch haben geknurrt, als er hier sprach. Aber der Jugendfreund hatte Recht, dass er hier offen alle diese komplizierten Fragen der Entwicklung des Einzelbauern zum Eintritt in die LPG dargelegt hat. (Beifall) Das ist doch leicht. Ein solcher Jugendfreund soll den alten Besitzer des Bauernhofes überzeugen, dass er in die LPG geht. Wie kann er ihn überzeugen? Am besten dadurch, dass in diesem Ort die LPG schnell entwickelt wird und zu solch hohen Arbeitseinheiten kommt, dass die Bauern sagen: Jawohl, wir gehen in die LPG. Also, wir verstehen sehr gut, was der Jugendfreund gesagt hat, und wir wollen ihm helfen, damit die Altbauern gewonnen werden. Wir müssen ins Dorf gehen und auf dem Bauernhof diese Frage klären.«[70] Noch am selben Tag wurde ich als Jüngster in den Zentralrat der FDJ gewählt. Am Abend gab die Regierung der DDR einen Empfang für Delegierte und Gäste des Parlaments. Walter Ulbricht, der in seiner Funktion als Erster Stellvertreter des Ministerpräsidenten Otto Grotewohl vertrat, war debattierend unterwegs. Irgendwann stand er auch vor mir. Er erkannte mich. Freundlich, auch ein wenig nachdenklich, aber sehr bestimmt und zuversichtlich sagte er zu mir: »Die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft ist eine schwierige Aufgabe. Es wird dauern, aber ich denke, wir werden es schaffen.« Wahrscheinlich wäre mein Leben auch ohne Ulbrichts Rettung ein politisches geworden. Aber ob ich es ohne dieses Lehrstück in Sachen sozialistischer Demokratie und vertrauensvollem Disput so überzeugt gelebt hätte, steht dahin.
Margarete Müller: Er wollte Praktiker im Politbüro. Ich war jung, qualifiziert, Frau und leitete eine Genossenschaft
Margarete Müller, Jahrgang 1931, nach Besuch der Volksschule Tätigkeit in einer Gärtnerei, von 1948 bis 1950 Traktoristin auf einer Maschinen Ausleih-Station (MAS), und Lehre auf dem Versuchsgut Gustavshof, danach Studium an der Fachschule für Landwirtschaft in Demmin. 1951 Eintritt in die SED. Von 1953 bis 1958 Studium am Landwirtschaftlichen Institut in Leningrad, danach Agronomin in der LPG Brohm und seit dem 26. Januar 1960 Vorsitzende der LPG Kotelow. Von 1973 bis 1976 Leiterin der Kooperativen Abteilung Pflanzenproduktion beziehungsweise später der LPG Pflanzenproduktion in Kotelow, danach der Agrar-Industrie Vereinigung Friedland. Von 1963 bis 1989 Mitglied des ZK der SED und Kandidat des Politbüros, Volkskammerabgeordnete, und seit 1971 auch Mitglied des Staatsrates. Am 26. Januar 1990 Ausschluss aus der SED-PDS. Margarete Müller lebt allein in Kotelow, einem kleinen Dorf in Mecklenburg-Vorpommern. Margarete, wie geht es dir gesundheitlich? Ach, ganz gut. Nur beim Gehen werde ich immer langsamer. Du musst Gymnastik machen. Egon, ich habe viertausend Quadratmeter Garten allein zu bewirtschaften, da habe ich Gymnastik genug. Gibt es keine Hilfe? Der Nachbarsjunge hilft im Moment. Es gibt ja im Ort nur noch die Agrargenossenschaft. Wir haben damals unsere Leute im Winter beschäftigt, es gab genug Arbeit in der Werkstatt. Heute ist die Technik so kompliziert, dass das nicht mehr geht. Und um Personalkosten zu sparen, werden die Bauern von November bis März in die Arbeitslosigkeit geschickt. Wir haben hier mit einer kleinen Genossenschaft von 800 Hektar angefangen. Dann wurde sie Kooperation, schließlich Agrar Industrie-Vereinigung. Und jetzt gibt es die Agrargenossenschaft, die Ackerbau und Viehzucht betreibt und aufs Geld achten muss. Und hast du die »Wende« gut überstanden? Wenn du damit meinst, ob es Ärger gab? Nein. Ein 15-Jähriger hat mal eine Bierflasche durchs Fenster geworfen, das war aber nicht politisch motiviert, der war betrunken. Und im Jagdkollektiv hat einer gestänkert, aber da ich auf die Rente zuging, hatte ich ohnehin vor, meine Mitgliedschaft zu beenden. Nein, es gab keinen Ärger. Als Kotelow unlängst seine 625-Jahr-Feier beging, wurde ich sogar gebeten, die Festrede zu halten. In unserem einstige Herrenhaus befanden sich bis 1989 die Dorfgaststätte, der Konsum und unser sehr gut besuchter Konsultationsstützpunkt. Dann stand das Haus leer. Ein westdeutsches Ehepaar hat, vermutlich fürn Appel und ’n Ei, das Barockgebäude inklusive sieben Hektar Land und Forst erworben und daraus ein Hotel gemacht. Das sieht jetzt alles sehr hübsch aus, und ich stelle nicht in Abrede, dass dort sehr viel Kraft und auch Geld investiert worden ist. Aber es schmerzte natürlich, wenn man bei der Eröffnung 2007 in Hochglanzblättern unter der Überschrift »Wohnen nach Gutsherrenart« lesen durfte: »Jagdschloss Kotelow: 1733 erbaut, zu DDR-Zeiten vernachlässigt, jetzt liebevoll restauriert.« Und: »Lampen aus dem Libanon, Möbel aus Dänemark, eine steinerne Terrassentreppe aus Berlin ...« Das hatten wir natürlich alles nicht. Aber es war unser Schloss, keine Designerherberge für »Gutsherren« aus dem Westen. Und wir haben es in Ordnung gehalten. Warst du inzwischen mal dort? Nein. Der Besitzer traf mich aber einmal auf der Straße und erkundigte sich, ob ich »die Frau Müller« sei. Ja, sagte ich, er könne mal gern zu mir zum Kaffee kommen, ich wohne da vorn unweit der Kirche. Hat er bis heute noch nicht geschafft. Und du hast zum Jubiläum gesprochen? Das ganze Dorf war gekommen, fast 300 Menschen. Ich lebe seit dem 26. Januar 1960 in Kotelow, fing ich an. Damals bin ich zum ersten Mal, mit 29 Jahren, zur LPG-Vorsitzenden gewählt worden. Und ich berichtete, wie es war, als wir anfingen. Es gab keine befestigten Straßen, die Stiefel blieben im tiefen Schlamm stecken. Und dann kam Hilfe: von der NVA, von der Sowjetarmee, sogar von der Staatssicherheit, die haben erst einmal die Wege mit ihrer Technik befestigt. Stück für Stück haben wir dieses Dorf, sagen wir ruhig, zivilisiert und vorangebracht. Über jedes neue Haus, jeden neuen Stall, jede neue Scheune, über die Milchviehanlage, die Schweineställe, die wir gemeinsam errichtet haben, haben wir uns auch gemeinsam gefreut. Wir haben zusammen gefeiert und uns auch gemeinsam geärgert, wenn es nicht so lief, wie wir es uns wünschten. Wir waren eine Gemeinschaft. Und selbst im Sommer konnten Bauern in den Urlaub fahren, und die Kinder qualifizierten sich an Hoch- und Fachschulen und kamen mitunter wieder zurück, weil sie selbst in dem kleinen Kotelow für sich und ihre Familie eine Perspektive sahen. – So habe ich geredet. Was meinst du, was ich da für einen Beifall bekommen habe. Nur die Jungs von der Feuerwehr haben mich anschließend kritisiert. »Frau Müller, alles haben Sie erwähnt. Nur unsere Freiwillige Feuerwehr haben Sie vergessen.« Stimmt. Das tat mir wirklich leid. Der Schlossbesitzer und seine Frau, eine Ärztin, kamen auch auf mich zu und meinten fast mitleidsvoll, sie hätten gar nicht gewusst, wie schwer wir es gehabt hätten. Nein, sagte ich, leicht war der Anfang wirklich nicht. Aber wir hatten ein Ziel vor Augen, und das gab uns Kraft. – Ich weiß nicht, ob sie das verstanden haben. Wenn sie heute das Angerfest feiern, wird eine Hüpfburg für das halbe Dutzend Kinder, das noch im Dorf lebt, aufgeblasen und die Kinder werden geschminkt, es gibt laute Musik, und die Alten trinken dazu ihr Bier aus Plastikbechern. Ach, Margarete, sagen sie dann, früher konnten wir wenigstens noch richtig feiern. Die Kneipe im Nachbardorf hat auch dichtgemacht, die Leute gehen weg, ich meine inzwischen jeder Vierte. Ein Wohnblock, den wir damals errichtet hatten, wurde auch schon abgerissen. Der eine Nachbar, der bisher immer in den Westen zum Arbeiten fuhr, hat den Job aufgegeben. Benzin, Miete und Lebenshaltung dort kosteten soviel, wie er verdiente. Das lohne sich wirklich nicht. Da bleibe er lieber zu Hause und kümmere sich um Haus und Garten. »Wenn Sie mal was zu tun haben, Frau Müller, ich helfe gern.« So was ansehen zu müssen, ist bitter. Erzähl mal etwas über deine Familie. Wir lebten in einem Dorf 15 Kilometer von hier. Wir waren vier Geschwister, jetzt ist nur noch eine Schwester übrig. Mein Bruder Manfred spielte bei ASK Vorwärts in der Fußballoberliga. Er hat bis in die 90er Jahre hinein in Neubrandenburg als Trainer gearbeitet. Dann kam er an einem Mittwoch ins Krankenhaus und am Sonntag war er tot. Mit 68. Nie getrunken, nie geraucht, immer gesund gelebt. Deine Biografie nach der Volksschule ist eine reine ostdeutsche, sie wird von typischen DDR-Begriffen begleitet: Traktoristin, Agronomin, MAS (für Maschinen-Ausleih-Station), MTS, LPG, Kooperative Abteilung, Agrar Industrie-Vereinigung. Sie dokumentieren zugleich Entwicklungsstufen der DDR Landwirtschaft. Kannst du dazu etwas sagen? Die Maschinen-Ausleihstationen waren, kurz gesagt, die Hilfe der Arbeiterklasse für die Landwirtschaft, ihr Vorgänger waren die VdgB[Anmerkung 80] Maschinenhöfe. Sie gingen auf einen Befehl der SMAD zurück. Mit den dort konzentrierten Maschinen sollte Neubauern sowie Klein- und Mittelbauern geholfen werden. Mit der Gründung von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften wurden daraus Maschinen-Traktoren-Stationen, MTS. Die Maschinen und Traktoren waren volkseigen und gingen nicht ins Eigentum der Genossenschaft über, die MTS blieben juristisch selbständige Betriebe, die Mitarbeiter – ich als Traktoristin – waren angestellt. Wir verstanden uns als Stützpunkt oder Brückenkopf der Arbeiterklasse auf dem Lande. Anfang der 60er Jahre, als wir vollgenossenschaftlich waren, wurden die Maschinen ins Eigentum der Genossenschaften überführt und die MTS 1964 zu Kreisbetrieben für Landtechnik (KfL), die die Maschinen warteten und reparierten. Mein MAS-Direktor sagte immer zu uns: Mädchen, Mädchen, lernt was. Ihr müsst irgendwann den Laden hier schmeißen! Aber was sollten wir lernen? Wir haben auf dem Dorf gelebt, waren Umsiedler aus Oberschlesien, besaßen nichts, nicht einmal Pläne. Wir kamen aus der Stadt. Vater hatte zwar dort auf dem Stadtgut gearbeitet, aber er war kein Bauer. Wenn mich Mutter damals fragte: Mädchen, was willst du mal werden?, habe ich geantwortet: alles, nur nichts in der Landwirtschaft. Aber als wir 1945 in Vorpommern landeten, blieb uns, auch mir, nichts anderes übrig, als in die Landwirtschaft zu gehen. Vater kam alsbald aus der Kriegsgefangenschaft und fing auf dem VdgB-Maschinenhof als Traktorist an. Und so kam auch ich dazu. Im Februar 1949 erhielt die Ostzone 1.000 Traktoren als Hilfe aus der Sowjetunion.[Anmerkung 81] Wir kriegten auch eine »Nati-Raupe« ab, das war ein Kettenschlepper mit 50 PS aus Charkow. Und den durfte ich fahren. Hast du dich darum beworben oder sagte man: Los, Mädel, jetzt steig auf den Bock? Sie hatten für mich keine andere Arbeit. Ich hatte bereits auf dem Lanz Bulldog Treckerfahren gelernt und war dadurch eine der ersten Traktoristinnen. Das hing auch mit der FDJ-Aktion »Jugend auf die Traktoren« zusammen, bei der ich in Schwerin einen entsprechenden Lehrgang besucht hatte. Schließlich delegierte man mich zu einem weiteren Lehrgang nach Neubrandenburg. Dort war auch der Direktor der Landwirtschaftsfachschule in Demmin. Der sagte, ich müsse eine richtige Ausbildung machen. Er überzeugte mich. So war ich denn ein Jahr in Demmin und zwei Jahre in Güstrow. Nach dem Fachschulabschluss war ich Agronom.[Anmerkung 82] Aber, kaum fertig, suchten sie welche für ein Studium in der Sowjetunion. Wir waren sieben Deutsche, die nach Leningrad kamen acht Jahre nach dem Krieg! Das war nicht einfach. Bei der praktischen Ausbildung, beim Pflügen, liefen Soldaten mit Minensuchgeräten vor unserem Traktor. Meine Diplomarbeit beschäftigte sich mit Sommerweizen, dazu musste ich auch ein Stück Feld anlegen. Im Institut waren wir in der Agrofak 25 Mädchen, zu einigen habe ich noch heute Kontakt, die meisten sind inzwischen auch nicht mehr. Später, als ich dann schon LPG-Vorsitzende war, lud ich sie zu mir ein. Sie waren dann jeweils drei, vier Wochen bei uns in Kotelow zu Besuch und schauten sich die Landwirtschaft in der DDR an. Natascha, die die Leningrader Blockade überlebt hatte, ist 2012 verstorben. Als ich sie nach ihrem ersten Besuch bei uns zum Bahnhof brachte, hat sie mich umarmt und gesagt, sie habe sich gefreut, normale Deutsche in Deutschland kennenzulernen. Ich ahnte, was sie damit sagen wollte. Das Trauma der Belagerung quälte alle Leningrader und bestimmte das Bild von »den Deutschen«. Ach, ich merkte aber, dass meine Russischkenntnisse nachließen. Ich freute mich darum, als die ersten russlanddeutschen Aussiedler ins Dorf kamen, und ich hoffte, die Sprache wieder aktivieren zu können. Aber die wollten nur Deutsch sprechen, um sich rasch zu integrieren. Das verstand ich. Jetzt lebt von ihnen noch eine Familie in Kotelow. Wir sprechen nun häufiger wieder miteinander russisch. Sie sagen mir: Wenn sie gewusst hätten, was sie hier erwartete, wären sie lieber zu Hause, in Russland, geblieben. Du warst damals in Leningrad die einzige Deutsche in eurer Klasse? Ja, die sechs anderen hatten andere Ausbildungsrichtungen. Und dann bist du 1958 in die DDR zurückgekehrt. Wo bist du da gelandet? Ich wurde in die LPG Friedrichshof an die dortige MTS delegiert. Friedrichshof war ein kleiner Ort, aber das erste vollgenossenschaftliche Dorf im Bezirk Neubrandenburg. Zum Erntefest kamen Max Steffen[Anmerkung 83] und eine Gruppe des Bolschoi aus Moskau, die gerade in Neubrandenburg gastierte. Tänzer aus dem weltberühmten Tanztheater hier in diesem winzigen Dorf, das kaum auf der Landkarte zu finden ist? So ist es. Die Dolmetscherin war so aufgeregt und bat mich zu helfen, ich käme doch soeben aus Leningrad und könne gewiss mit Russen umgehen. Das war mir peinlich. Die Frauen auf dem Lande, ich auch, trugen damals selten Hosen. Ich lief im Rock über die Stoppelfelder und hatte folglich völlig zerkratzte Waden. Und dazu die makellosen Beine der Balletttänzerinnen … Der Unterschied fiel selbst den Bauern auf, die unten vor der Bühne standen. Es war trotzdem ein wunderschönes Fest. Dann ging der LPG-Vorsitzende von Kotelow nach Meißen, und ich wurde so lange bekniet, bis ich einwilligte, seine Funktion zu übernehmen. Natürlich nur befristet, wie man mir sagte. Als Traktoristin verdiente ich damals etwa 600 Mark, als LPG-Vorsitzende bekam ich die Hälfte ... Du bist ziemlich rasch politisch aktiv geworden, bist in die Bezirksleitung Neubrandenburg der SED gekommen, in den Bezirkslandwirtschaftsrat … Da war es vermutlich nur eine Frage der Zeit, dass du mit Walter Ulbricht zusammengetroffen bist. Wann bist du ihm zum ersten Mal begegnet? Das war im Herbst 1960. Max Steffen4 und etliche aus der Bezirksleitung, darunter auch ich, wurden nach Berlin ins Politbüro einbestellt, und dort wurde uns eröffnet, dass Steffen abgelöst werde. Es sollte dann nach einem kurzem Interregnum »Schorsch« Ewald[Anmerkung 84] diese Funktion übernehmen. Er kam, anders als Steffen, aus der Landwirtschaft und sollte erfolgreicher als sein Vorgänger den Agrarbezirk entwickeln. Als er von Rügen wegging, war das ein großer Verlust für uns: Schorsch Ewald war der 1. Kreissekretär der SED auf Rügen, als ich dort FDJ-Funktionär wurde. Von dem habe ich viel gelernt, das war ein toller Kerl. – Welchen Eindruck hattest du damals von Ulbricht? Ich war ein kleines Mädchen vom Lande. Ich war überrascht und fasziniert zugleich, weil dieser große Mann – er war immerhin der Erste in Partei und Staat – sich ganz normal und ohne Distanz zu unsereinem verhielt. 1963 wurde ich zum Parteitag delegiert, dort saß ich auch im Präsidium. Ich bekam die Aufforderung, mich in einem bestimmten Zimmer zu melden, was ich auch tat. Dort wartete bereits Schorsch Ewald. »Margarete, du auch?«, sagte er überrascht, wobei diese Frage andeutete, dass er wusste, was uns bevorstand. Schließlich kam Walter Ulbricht und sagte, man sei der Meinung, dass ich Kandidat des Politbüros werden solle. Ich wehrte ab und erklärte, dass ich nicht reden könne. Ich verstünde aber mit den Bauern zu sprechen, sagte Ulbricht, das wäre viel wichtiger als irgendwelche Reden zu halten. Hat er darüber gesprochen, was da im Einzelnen im Politbüro auf dich zukäme? Ich meine, du warst 32 Jahre alt und wohl kaum mit den Innereien der politischen Führung vertraut. Nein, darüber hat er nicht mit mir gesprochen. Ich wurde, wie man so sagt, ins kalte Wasser geworfen. Du hast dich aber auch werfen lassen, dein Widerstand war nicht nur mäßig, sondern auch, wirst du zugeben, argumentativ nicht überzeugend. Der Begriff »Parteidisziplin« war mir schon damals vertraut. Andererseits, und das hatte ich durchaus verstanden, wollte Ulbricht in der Führung Praktiker aus der Landwirtschaft, also Menschen, die sich auf diesem Felde im Wortsinne auskannten. Zudem war ich jung und obendrein Frau, bei Letzteren herrschte erkennbar Mangel an der Spitze. Nimm die Titelseite des Neuen Deutschland mit den Köpfen der Politbüromitglieder, die der VI. Parteitag wählte: Ich bin dort die einzige Frau! Und was das Alter angeht: Ulbricht zog systematisch junge Leute nach. Er wollte keinen Generationswechsel, sondern eine kontinuierliche Erneuerung des Führungspersonals. Auch darin zeigte sich sein strategisches Denken. Außerdem: Als Kandidat war man ja nicht so intensiv in die politische Arbeit in Berlin eingebunden, ich konnte also weiter in Kotelow in der LPG arbeiten. Aber in den Politbürositzungen spielte das keine Rolle. Da wurde nicht zwischen Kandidat und Vollmitglied unterschieden. Allenfalls bei Abstimmungen. Und abgestimmt wurde im Politbüro, zumindest zu meiner Zeit, äußerst selten. Ich kann mich nur an ganze drei Abstimmungen in den zwölf Jahren, als ich diesem Gremium angehörte, erinnern. In der Regel wurde Einmütigkeit erarbeitet. Oder war das unter Ulbricht anders? Nein. Und wurde diskutiert? Ja, sehr. In der ersten Zeit saß ja noch Otto Grotewohl[Anmerkung 85] mit ihm vorn. Und da wurde lebhaft debattiert. Nach Ottos Tod saß Walter eine ganze Zeit allein vorn. Irgendwann rückte dann Erich Honecker an seine Seite, er leitete ja bereits die Sekretariatssitzungen. Konnte Walter Ulbricht auch grob sein? Daran kann ich mich nicht erinnern. Gab es damals Reibereien zwischen den älteren und den jüngeren Genossen im Politbüro? Die Alten hatten andere Lebenserfahrungen, waren im Exil oder in Nazihaft und konnten darum nicht studieren – ihr aber hattet studiert, wart fachlich qualifizierter als manch anderer. Dergleichen habe ich nicht gespürt. Im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, dass sich die Älteren um die Jüngeren bemühten, ihnen halfen. Hermann Axen[Anmerkung 86] zum Beispiel suchte immer das Gespräch, fragte, ob ich Unterstützung brauche. Hat Ulbricht dich mal aufgefordert, zur Diskussion zu sprechen? Nein, nie. Er kannte meine Hemmungen. Es lag in meinem Ermessen, ob ich mich meldete oder es unterließ. Ulbricht hat mich nie genötigt. Mit dir kam auf dem VI. Parteitag noch ein weiterer Landwirtschaftsexperte ins Politbüro: Karl-Heinz Bartsch.[Anmerkung 87] Er blieb nur wenige Tage in diesem Gremium und wurde am 28. März 1963 auf Antrag der Zentralen Parteikontrollkommission aus der SED ausgeschlossen. Er hatte seine Zugehörigkeit zur Waffen-SS verschwiegen. Wurde darüber im Politbüro diskutiert? Was sollte man da noch groß diskutieren? Er hatte sich im April 1941 freiwillig zur Waffen-SS gemeldet, war in Frankreich und in der Sowjetunion, kämpfte 1943 im Kursker Bogen und als SS-Unterscharführer seit 1944 in der 17. SS-Panzergrenadier-Division »Götz von Berlichingen« an der Westfront. An Nazi- und Kriegsverbrechen war er nicht beteiligt, aber er hatte allen verschwiegen, dass er die schwarze Uniform dieser Verbrecherorganisation getragen hatte, zudem auch noch freiwillig. Die hatten auch andere getragen – aber niemand in der Führung der durch und durch antifaschistischen SED. Der eigentliche politische Skandal, so empfand ich, war jedoch der Vertrauensbruch. Er war gegenüber seinen Genossen nicht ehrlich gewesen. Und dafür wurde er seiner Ämter enthoben. Du kanntest ihn persönlich? Ja, er leitete seit 1965 die Bullenzuchtstation in Woldegk bis in die 80er Jahre und war bis zum Eintritt ins Rentenalter LPG-Vorsitzender. Er meldete sich gelegentlich telefonisch bei mir und bot, sofern ich sie benötigte, mir Hilfe an. Er machte seine Arbeit ordentlich. Hast du eine Fahrerlaubnis? Nein, nie. Ich wurde zu den Sitzungen in Berlin mit dem Wagen abgeholt und wieder gebracht. Auto, Fahrer und Begleiter waren in Neubrandenburg stationiert. Sie brachten noch am Samstag die Dienstpost, dann war ich allein. Ich habe die Straße vor meinem Grundstück allein gefegt wie jeder andere im Dorf, den Rasen gemäht. Einmal – da war gerade Lusja aus Moskau zu Besuch – habe ich mich beeilt, damit wir mehr Zeit füreinander hatten. Dabei schnitt ich mir mit dem Rasenmäher in den großen Zeh. Das musste genäht werden. Da lag ich dann zwei, drei Tage im Krankenhaus. Danach musste der Personenschutz bei mir den Rasen mähen. Vermutlich hatten sie Ärger wegen meines Unfalls gekriegt. Alles andere habe ich aber unverändert allein besorgt: das Kleinvieh, den Garten. Vater und meine Schwager haben mir dabei geholfen, sonst niemand. Du hattest noch Hühner, als du Kandidat des Politbüros warst? Ja. An die fünfzig Stück. Da gab es mal eine schöne Geschichte. Frieda Sternberg[Anmerkung 88]– erste LPG-Vorsitzende der DDR und ZK-Mitglied – sagte ich, dass ich einen Hahn brauche. Da brachte sie mir zur ZK-Sitzung einen aus ihrer LPG im Bezirk Leipzig mit. Wir standen vorm ZK-Gebäude, und sie holte den Hahn aus dem Auto: »Schau mal, was für ein hübsches Tier«, sagte sie, strich ihm bewundernd übers Gefieder, und dann habe ich ihn in meinen Volvo geladen. Meine Hühner haben ihm sehr zugesetzt. Als ich aus dem Urlaub kam, wurde ich vom Fahrer in Schönefeld mit Leidensmiene begrüßt: Genossin Müller, es ist etwas Schlimmes passiert. Ich rechnete mit allem, nur nicht mit der Mitteilung: Der Hahn ist tot. Er hatte den Stress nicht überstanden. Was hast du mit den Hühnereiern gemacht? Die habe ich abgeliefert wie alle, und dafür gab es Korn. Nach der »Wende« hatte sich das erledigt. Da musste ich die Eier selber essen. Wenn ich das richtig verstanden habe, waren hier in Kotelow nicht ständig Personenschützer um dich herum? In Kotelow haben die Bauern auf mich aufgepasst. Du hast acht Jahre lang, von 1963 bis 1971, Walter Ulbricht in jeder Woche mindestens einmal getroffen, nämlich zur Politbürositzung. Und ihr seid gemeinsam bei Protokollveranstaltungen, Bauernkongressen, Besuchen der agra in Markkleeberg und in Landwirtschaftsbetrieben etc. aufgetreten. War er jemals in Kotelow? Nein. Wie wirkte er auf dich? Väterlich und irgendwie sehr gesetzt. Lag das am Alter, am Charakter oder an der Funktion? Ich glaube, das entsprach seiner Natur. Hattest du auch Kontakt zu Lotte Ulbricht? Ja. Ich erinnere mich an einen Frauenkongress in Klink. Tage vorher kam Erika Jahnke aus der Frauenkommission nach Kotelow. Es gab damals noch keine feste Straße im Dorf. Sie stieg also aus und ihre Pumps blieben im Modder stecken. Das muss sie wohl Lotte erzählt haben. Denn in Klink, mich begleiteten noch einige Frauen aus meinem Dorf, gab sich Lotte erstaunt, dass wir so schicke und saubere Schuhe trügen. Wie denn das? Ach, sagte ich, wir haben unsere Gummistiefel im Auto. Und das war nicht gelogen. Willi Stoph kam auch einmal. Dem widerfuhr das gleiche Malheur. Danach haben wir eine feste Straße gekriegt. Die haben wir allerdings nicht geschenkt bekommen, die wurde in den Dorfentwicklungsplan und in unseren Haushalt eingebunden. Nach der »Wende« haben wir dann mit Fördermitteln eine neue schicke Straße bekommen – ohne Bürgersteig. Das heißt: Das Dorf selbst hat damals die Straße bezahlt. Kann man so sagen. Ich frage deshalb nach, um zu klären, ob die Gemeinde von deinem politischen Amt profitiert hat. Definitiv nein. Das, was wir mit der Genossenschaft auf die Beine gestellt haben, hätten wir auch ohne meine Funktion in Berlin erreicht. Ich war so wenig privilegiert wie das Dorf. Ich will dir mal die bescheidenen Möglichkeiten eines Politbüromitgliedes bzw. -kandidaten an einem Beispiel schildern. Du hast am Dorfeingang gewiss das leerstehende Torhaus gesehen. Früher ging die gepflasterte Dorfstraße hindurch, jetzt schlägt die Asphaltpiste darum einen Bogen. Damals sind wiederholt die LPG-Fuhrwerke dort hängengeblieben, einmal brach sogar eine Deichsel durchs Mauerwerk, als die Pferde durchgingen: Und hinter der Wand stand das Kinderbett … Abriss schien die beste aller Lösungen. Ich habe es dem Agrarmuseum in Alt-Schwerin als das letzte Torhaus in Mecklenburg angeboten, die Kollegen dort hatten schließlich auch schon ein altes Bauernhaus abgetragen und im Freilandmuseum wieder aufgebaut. Doch sie winkten ab. Als einmal in der Nähe ein Panzer der NVA unterwegs war, bin ich hin und habe dem Fahrer tausend Mark geboten, wenn er mal zufällig mit seinem … Der Soldat hat nur den Kopf geschüttelt und gesagt: Genossin Müller, das mache ich nicht. Das Gebäude steht doch unter Denkmalschutz. Das Torhaus verrottet nun seit Jahren und steht zum Verkauf.
Dietrich Steinfeldt: Warum der Agrarbezirk Schwerin die Arbeiterklasse stärken sollte
Dietrich Steinfeldt, Jahrgang 1932, geboren und aufgewachsen in Hamburg, ausgebombt und zu den Großeltern nach Mecklenburg gezogen. Nach dem Abitur Studium der Wirtschaftswissenschaften, zunächst in Rostock, dann in Berlin. Mit Diplom zum Rat des Kreises Perleberg, dort für Finanzen zuständig, bis 1965 Chef der Kreisplankommission. Danach Wechsel zur Bezirksplankommission, deren Vorsitzender er bis 1975 war. Von 1975 bis 1989 Sekretär für Wirtschaft der Bezirksleitung der SED Schwerin, danach Rentner. Ende Juni 1967 besuchte Walter Ulbricht Schwerin, um in der Kongresshalle auf einer Kundgebung zu sprechen. Am 2. Juli waren Volkskammerwahlen. Er kam einen Tag früher, um, wie es hieß, mit dem Sekretariat der Bezirksleitung der SED aktuelle Aufgaben und Probleme zu beraten, konkret sollte es um Fragen der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft sowie des Bauwesens gehen. Der 1. Sekretär, er hieß seit 1952 Bernhard Quandt,[Anmerkung 89] hatte sich einen gründlichen Bericht erarbeiten lassen, die Diskussionsredner waren benannt, Kartenmaterial und Modelle vorbereitet. Ich gehörte seit geraumer Zeit der Bezirksplankommission an und konnte der Zusammenkunft gelassen entgegensehen, da ich nicht sprechen musste. Außerdem hielt sich, mit Verlaub, meine Begeisterung für Ulbricht in Grenzen, wofür es gewiss Gründe gab, die man wohl ahnen kann. Außerdem fragte ich mich ein wenig nassforsch: Der Mann war mehr als doppelt so alt wie ich, was sollte der mir Neues zu erzählen haben? Ich saß etwa drei Meter von ihm entfernt und konnte ihn studieren, wie er aufmerksam und konzentriert die Redebeiträge verfolgte und dabei Notizen machte. Der Bezirk Schwerin war erkennbar ein Agrarbezirk, mehr als die Hälfte des Bruttoproduktes wurde von Betrieben der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft erzeugt. An der Industrieproduktion der DDR war der Bezirk lediglich mit 1,6 Prozent beteiligt und belegte damit den vorletzten Platz aller Bezirke. Gut, irgendeiner musste schließlich hinten marschieren, das schien mir wenig dramatisch. Allerdings zeigten unsere Analysen auch, dass in den nächsten zehn Jahren geburtenstarke Jahrgänge in den Berufsprozess einsteigen würden, wir rechneten mit einem Zuwachs von etwa 13.000 Personen. Auf der anderen Seite würden aufgrund der fortschreitenden Modernisierung der Landwirtschaftsbetriebe dort etwa 4.000 Arbeitsplätze verschwinden. Und schon jetzt verbrauchte der Bezirk mehr vom Nationaleinkommen, als er selbst erzeugte, das heißt, selbst die Landwirtschaft brachte nicht die Zuwächse, die sie hätte bringen müssen. Quandt, dessen Herz nicht nur wegen seiner Herkunft für die Landwirtschaft schlug, glaubte darauf mit der Stärkung und Entwicklung der Agrarbetriebe reagieren zu müssen. Am Ende der Zusammenkunft wurde Ulbricht gebeten, das Schlusswort zu sprechen. Ich erwartete, dass er – wie man es aus dem Fernsehen kannte nunmehr eine vorbereitete Rede aus der Tasche ziehen und die üblichen Gemeinplätze verkünden würde. Doch Ulbricht sprach wider Erwarten frei und schaute nur hin und wieder auf seine Notizen, um auf bestimmte Aussagen einzugehen. Das war für mich die erste große Überraschung. Die zweite war sein Fazit: Die Arbeiterklasse habe sich im Bezirk nicht in dem Maße entwickelt, wie es notwendig sei, weshalb auch die Landwirtschaft zurückbliebe. Kurzum, wir müssten die Industrie im Bezirk ausbauen, damit die Landwirtschaft vorankäme. Das verblüffte, zumal alle am Tisch der Meinung waren, dass eine beschleunigte Entwicklung der Industrie den Hauptproduktionszweig des Bezirkes, nämlich die Landwirtschaft, schwächen würde. Darum war alles auf die Entwicklung eines modernen Agrarbezirkes ausgerichtet – und nun kam Ulbricht und forderte, die Industrie zu entwickeln. Hier, in Mecklenburg? Selbst in der Prognosegruppe des Ministerrates »Standortverteilung der Produktivkräfte in der DDR«, der ich angehörte, sah man es anders. Ackerbau und Viehzucht sollten auch künftig im Bezirk dominieren, allenfalls der Tourismus, damals nannten wir es noch Erholungswesen, sollte forciert werden. Ulbricht verlangte schließlich – oder wie es politisch korrekt hieß: er schlug vor –, noch in diesem Jahr gemeinsam mit der Staatlichen Plankommission Vorstellungen zur Grundrichtung der Entwicklung des Bezirkes bis 1980 zu entwickeln. Und noch in diesem Jahr brauche man einen Bezirksperspektivplan bis 1970 sowie einen Generalverkehrs- und bebauungsplan für den Zeitraum bis 1980. So geschah es denn auch. Am 7. Dezember 1967 behandelte die Bezirksleitung diese Strategiepapiere, dann wurden sie vom Bezirkstag diskutiert und beschlossen. Auf dieser Basis entstand beispielsweise in wenigen Jahren der Industriekomplex Schwerin-Süd mit Großbetrieben wie dem Plastmaschinenbau, dem Hydraulikwerk und dem Lederwarenbetrieb mit mehreren Tausend Beschäftigten. Und natürlich die dazugehörigen Wohnungen. Unterm Strich verdoppelte sich in der Folgezeit der Grundmittelbestand in der Industrie des Bezirkes, vervierfachte sich von 1971 bis 1989 die Produktion im Maschinen- und Fahrzeugbau sowie in der Leichtindustrie. Drei Jahre nach der von Ulbricht angeregten Weichenstellung wurde ich nach Berlin gebeten, um auf einer Sitzung des Staatsrates zu sprechen. Sie stand unter dem sperrigen Titel »Die weitere Gestaltung des Systems der Planung und Leitung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung, der Versorgung und Betreuung der Bevölkerung in den Bezirken, Kreisen, Städten und Gemeinden – zur Entwicklung sozialistischer Kommunalpolitik«. Ich sollte dort über die Koordinierung von Investitionen am Beispiel des Industriekomplexes Schwerin-Süd sprechen. Quandt hatte mir zwar aufgegeben, auch etwas zu seinem Lieblingsthema, der Landwirtschaft, zu sagen, doch angesichts der sehr präzisen Vorgabe meines Themas war das schlechterdings nicht möglich. Ich fuhr also im April 1970 zur 24. Sitzung des Staatsrates in die Hauptstadt, Ulbricht erteilte mir schon als zweitem Diskussionsredner das Wort. Ich sprach über unsere Erfahrungen, Ulbricht dankte und reagierte umgehend darauf, es sollte seine einzige Replik auf einen Redebeitrag an diesem Tage sein. Er unterstrich meine Einschätzung, dass der Aufbau des neuen Industriezentrums im Süden Schwerins eine sehr komplizierte, weil sehr komplexe Aufgabe sei, weshalb sich zurecht die staatliche Leitung und die politische Führung in Schwerin schwerpunktmäßig auf die Errichtung des Industrie- und Wohngebietes konzentriere. Alles andere sei zweitrangig. Damit nahm er möglicher Kritik die Spitze, dass andere Probleme im Bezirk, die ebenfalls einer Lösung bedurften, zunächst hintangestellt wurden. Angesichts der Entwicklung des Bezirkes Schwerin, die mit Ulbrichts nun, sagen wir ruhig – Vorgabe erfolgt war, konnte man sehen, dass diese strategische Orientierung völlig richtig war. Es war der endgültige Aufbruch einer vormals zurückgebliebenen Region in die Moderne.
Gerhard Schneider: »Schont die Landschaft und steigert trotzdem die Produktion«
Gerhard Schneider, Jahrgang 1933, 1945 Umsiedelung aus Ostpreußen, Lehre in der Landwirtschaft. Seit 1952 Dienst in den bewaffneten Organen der DDR. 1964 Entlassung als Major der Reserve. Studium an der Ingenieurschule für Landtechnik in Berlin-Wartenberg. 1967 Chefingenieur, danach bis zur Auflösung in verschiedenen Leitungsfunktionen des VEG Zingst tätig. Danach arbeitslos, jetzt Rentner. Unser Volkseigenes Gut Zingst befand sich unweit vom Ostseebad Dierhagen, wo Ulbricht im Sommer Urlaub machte. Wenn er auf dem Darss war, musste man immer mit Überraschungen rechnen. Mal tauchte er hier, mal dort auf. Einmal stand er vor dem Rathaus in Ribnitz und wünschte den Bürgermeister zu sprechen. Der war aber nicht dort, denn im Rathaus amtierte der Rat des Kreises. Ulbricht war aber der Meinung, dass Rathäuser Häuser sein müssten, in denen die Bürger, so sie denn Rat suchten, ihn auch vom Bürgermeister bekommen sollten. Er veranlasste, dass der Rat sich eine andere Bleibe suchen musste und der Bürgermeister wieder ins Rathaus zurückkehren konnte. Solche populären Interventionen sprachen sich natürlich herum. Es war logisch, dass über kurz oder lang Ulbricht auch bei uns im VEG auftauchen würde. Er entschied stets kurzfristig, wohin er sich wandte, um keinen Rummel auszulösen. Hätte er zum Beispiel erfahren, dass die Häuptlinge in der Bezirkshauptstadt Rostock veranlasst hatten, dass zwischen Born und Ahrenshoop extra ein Hügel für ihn aufgeschüttet wurde, damit er – im Bedarfsfall – von dort einen Blick auf die Landschaft werfen könne, wäre er gewiss aus der Haut gefahren. Auf dem Ostzingst wurde aus gleichem Grund ein Fahrweg über den Deich bis hin zum Wattenmeer angelegt, damit er so viel wie möglich von dieser schönen Landschaft sehen konnte. Der Volksmund hatte für beides schnell einen Namen: »Ulbricht-Hügel« und »Ulbrichtstraße«. Ulbricht erfuhr auch von der Straße nichts. Gottlob, da hätte es gerumst. Ich war damals Chefingenieur im VEG und gehörte zum Leitungsgremium des Betriebes. Eines Tages geschah es dann doch. Wir erhielten Nachricht, dass Walter und Lotte Ulbricht zu Besuch kämen. Wir konnten gerade noch organisieren, dass sich vor der Zentralwerkstatt und dem Verwaltungsgebäude des VEG (heute befindet sich darin das Hotel »Vier Jahreszeiten« und ein Supermarkt) einige Mitarbeiter versammelten, um Spalier zu bilden. Plötzlich rollte ein einzelner schwarzer Tatra auf den Hof. Keine Polizei, keine Eskorte oder Begleitfahrzeug. Ulbrichts stiegen aus, schüttelten Hände, redeten, und der Direktor, um entsprechende Auskunft und Führung gebeten, zeigte ihm unser Einzugsgebiet. Zunächst ging es zur Ostspitze der Halbinsel, dem Pramort. Die »Ulbrichtstraße« wurde links liegengelassen. Der Direktor erklärte. Ostwärts schlossen sich das Wattenmeer sowie die Inseln Werder und Bock an. Der Blick ging frei bis zu den Inseln Hiddensee und Rügen. Unsere Gäste waren von der Schönheit überwältigt. Der Direktor des VEG erläuterte unsere Vorstellungen. Wir wollten ungenutztes, brachliegendes Territorium wirtschaftlich erschließen, um noch mehr Nahrungsmittel zu produzieren. Ulbrichts hörten sehr konzentriert zu, und wir meinten, sie würden unseren Überlegungen folgen. Doch Walter Ulbricht schüttelte den Kopf. Es sei zutreffend, dass in der Welt noch großer Hunger herrsche, der überwunden werden müsse, doch wir sollten diese schöne, einmalige Natur nicht zerstören, sondern stattdessen dafür sorgen, dass weltweit der Kapitalismus, der mit Profitstreben und Spekulation für den Hunger in weiten Teilen der Welt verantwortlich sei, überwunden werde. Es scheine ihm sinnvoller, wenn wir auch die Lebensmittelproduktion intensivierten, statt extensiv zu arbeiten und Landschaft zu vernichten. Dann fuhren wir zum Großtrockenwerk in der Sundischen Wiese und besichtigten es bei laufender Produktion. Als Chefingenieur erläuterte ich den Bau, die aktuelle Rekonstruktion, mit der wir einerseits die Produktion steigern und andererseits die Arbeits- und Lebensbedingungen verbessern wollten. Dafür fand der Staatsratsvorsitzende anerkennde Worte. Anschließend gab es einen Imbiss mit Smalltalk mit den hinzugekommenen Gästen aus dem Bezirk. Leider hatte ich mich mit meinem Vorschlag nicht durchsetzen können, auch Werktätige hinzuzubitten. Harry Tisch, 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung, hatte gemeint, Ulbrichts seien im Urlaub, die wollten ihre Ruhe, daher sollte alles in kleiner Runde bleiben. Doch Tisch hatte seine Rechnung ohne Walter Ulbricht gemacht. Denn kaum saß er auf der Bank und hatte die umsitzenden Schlipsträger gemustert, fragte er: »Warum sind denn keine Arbeiter hier?« Tisch fragt den Direktor: »Warum sind denn keine Arbeiter hier?«, als wenn er sich die Antwort nicht hätte selber geben können. Der Betriebsleiter wandte sich mit der gleichen Frage an mich. Ich ging ins Trockenwerk hinüber und holte sechs Frauen und Männer, die entbehrlich waren. Sie wussten nicht, was sie erwartete. Ulbrichts tranken Saft, was die Offiziellen mindestens so störte wie die Tatsache, dass sie als Gesprächspartner abgemeldet waren. Sie langten erst nach dem Wodka, als Ulbrichts davonfuhren und die Arbeiter wieder an ihre Maschinen zurückgekehrt waren. Den Kollegen aus dem Trockenwerk hatte Ulbricht einen Kasten Bier spendiert. »Aber erst nach Feierabend trinken«, hatte er lachend gerufen, als er sich verabschiedete und ins Auto stieg. »Denkt an den Hunger in der Welt und an die Intensivierung der Produktion! Da muss man nüchtern sein und einen klaren Blick haben.«
Johannes Chemnitzer: »Herzlich willkommen, liebe Genossin Walter Ulbricht«
Johannes Chemnitzer, Jahrgang 1929, Eintritt in die KPD 1945, Besuch der Fachschule für Landwirtschaft in Zwickau, danach, von 1955 bis 1958, Sekretär für Landwirtschaft in der Kreisleitung Zwickau der SED und anschließend Besuch der Parteihochschule in Moskau. Von 1958 bis 1962 Sekretär für Landwirtschaft der Bezirksleitung Gera der SED sowie 1961/62 Vorsitzender der Ständigen Kommission für Landwirtschaft des Bezirkstages Gera. 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Neubrandenburg von 1963 bis 1989 und seit 1963 Abgeordneter der Volkskammer (bis 1989), von 1967 bis 1989 Mitglied des ZK, im November 1989 Kandidat des Politbüros und ZK-Sekretär, im Dezember aus der SED ausgeschlossen. Als kaufmännischer Lehrling bekam ich noch im März 1945 eine Uniform, die ich aber, auf Vorschlag eines Bauern und wegen der von ihm genährten Furcht, ich käme damit in amerikanische Kriegsgefangenschaft, rasch wieder auszog, um bei ihm, zumindest für kurze Zeit, auf dem Hof zu arbeiten. Dann kehrte ich doch nach Hause zurück und Vater aus der Kriegsgefangenschaft heim. Der amerikanischen Besatzung war im Spätsommer die Rote Armee gefolgt, in Wildenfels, einer Kleinstadt südöstlich von Zwickau gelegen, erfolgten jene Veränderungen und Umbrüche wie überall in der sowjetischen Besatzungszone. Der lokale Graf wurde enteignet, seine Äcker wurden Bodenreformland, und mein Vater erhielt eine Neubauernstelle. Dort wurde ich nun Landarbeiter. In der Folgezeit erlebte ich die mitunter harten Auseinandersetzungen auf dem Lande. Es ging um Soll, »freie Spitzen«, Preise, Zuteilungen, staatlichen Aufkauf, um fehlendes Saatgut, Düngemittel, Ersatzteile und vieles mehr. In den Bauernversammlungen zeigten sich die bestehenden Gegensätze und unterschiedlichen Interessen. Die starken Bauern führten das Wort und verweigerten die Erfüllung ihrer Veranlagungen. Sie machten kein Hehl daraus, dass sie die Entwicklung unter den neuen politischen Verhältnissen mindestens kritisch sahen, wenn nicht gar ablehnten. Oft fuhr ich nach solchen hitzigen Debatten unzufrieden, um nicht zu sagen verärgert nach Hause. Nach dem Besuch der Parteihochschule wurde ich Landwirtschaftssekretär in der Bezirksleitung Gera. Der V. Parteitag der SED hatte darauf orientiert, die sozialistische Umgestaltung auf dem Lande zu vollenden. Der Erste Sekretär machte erkennbar Druck. Auch in Gera. Dort hinkte man der Entwicklung ziemlich hinterher. Es gab geharnischte Kritik und eine Kommission, die die Ursachen untersuchte. Am Ende wurde der 1. Sekretär der Bezirksleitung abgelöst, an seine Stelle trat Paul Roscher, ein erfahrener Agrarpolitiker. Auch in Berlin gab es Veränderungen. Auf der 7. Tagung des Zentralkomitees im Winter 1959 löste Gerhard Grüneberg den bisher für die Landwirtschaft zuständigen ZK-Sekretär Erich Mückenberger ab. In der Folgezeit gab es wiederholt Beratungen von den für Agrarpolitik Verantwortlichen. In guter Erinnerung ist mir ein Treffen mit Ulbricht zu Beginn des Jahres 1960, als er uns darauf einschwor, alle Bauern im Land für die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften zu gewinnen. Wir sollten für eine »Atmosphäre der sozialistischen Umgestaltung« sorgen. Alle Bauern sollten den Schritt vom Ich zum Wir vollziehen, weil es der Republik, aber auch jedem einzelnen Landwirt nützte. Dabei sollten Stadt und Land Hand in Hand gehen und die demokratischen Parteien und Massenorganisationen mobilisieren. In Gera entwickelte auf Initiative der Bezirksleitung die Ständige Kommission Landwirtschaft des Bezirkstages einen Plan zur Entwicklung der Viehwirtschaft. Dabei wurde sie von der Landwirtschaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität in Jena unterstützt. Die Bildung von Genossenschaften ging voran. 1963, im Jahr des VI. Parteitages der SED, war unser Bezirk vollgenossenschaftlich. Offenkundig war man mit meiner Arbeit zufrieden. Im November 1962 beschloss der Ministerrat, mich zum Stellvertretenden Leiter der Ständigen Kommission Landwirtschaft im RGW zu berufen. Und das Politbüro war der Meinung, dass ich im Agrarbezirk Neubrandenburg an die Spitze der dortigen Parteiorganisation treten sollte. Am 17. Februar 1963 wurde ich zum 1. Sekretär der Bezirksleitung gewählt. Fortan bekam ich es nunmehr regelmäßig mit Walter Ulbricht zu tun. Viele Genossenschaften im Territorium waren leistungsschwach, es fehlte an qualifizierten, erfahrenen Kadern. Insbesondere in der Uckermark sah es nicht gut aus. Walter Ulbricht forderte: »Industriearbeiter in den Norden!« Dem Ruf folgten viele. Am 20. April 1963 erschien auf einer ganzen Seite im Neuen Deutschland ein von Ulbricht unterzeichneter »Brief des Zentralkomitees an die Werktätigen der sozialistischen Landwirtschaft«, in dem es um Realisierung der Parteitagsforderung ging, die Bevölkerung »besser mit Nahrungsmitteln und die Industrie mit Rohstoffen aus der eigenen Produktion zu versorgen«. Unter der Zwischenüberschrift »Futter und nochmals Futter« hatte es dort geheißen: »Eine hohe Futtererzeugung ist die Voraussetzung für eine hohe Produktion von Fleisch, Milch und Eiern. Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass mehr ertrag- und eiweißreiche Kulturen an Stelle der ertrag- und eiweißarmen angebaut werden.« Dann folgte eine Aufzählung, welche damit gemeint waren. In der gleichen Zeitung erschien in jener Zeit ein Beitrag, in welchem der Rückstand bei der Frühjahrsbestellung in unserem Bezirk kritisiert wurde. Unter der Überschrift »Schaupflügen statt Haferaussaat« glaubte ein Journalist den Grund für unsere Rückstände ausgemacht zu haben. Das führte dazu, dass Walter Ulbricht sofort zum Hörer griff und bei mir anrief. Ich war allerdings nicht im Büro, sondern im Bezirk unterwegs. So bekam Hans Gerlach, der 2. Sekretär der Bezirksleitung, stellvertretend für mich das ganze Donnerwetter ab. Es war nun wirklich reichlich albern, dass das traditionelle Wettpflügen für die Planrückstände herhalten musste, die Vorhaltung war nicht nur ungerecht, sondern gründete sich auch auf Unkenntnis. Aber sie genügte, mir ein doppelt schlechtes Gewissen zu bereiten: erstens, weil wir tatsächlich bei der Frühjahrsbestellung zurücklagen, und zweitens, weil mich mein Chef nicht ans Telefon bekommen hatte. So etwas hinterlässt nie einen guten Eindruck. In der Folgezeit schaute wiederholt der Landwirtschaftsminister Hans Reichelt vorbei. Gemeinsam besuchten wir Genossenschaften, erkundigten uns danach, ob und wie Unterstützung gegeben werden sollte. Allerdings bekamen wir auch viel unsachliche Kritik zu hören, die deutlich machte, dass es noch etliche Kräfte in den Dörfern gab, die die Arbeit der Genossenschaften behinderten, wenn nicht gar störten. Und auch die Genossenschaftsbäuerinnen sollten stärker in die Entwicklung eingebunden werden. Ende November 1963 versammelten sich Bäuerinnen aus allen Kreisen des Bezirkes Neubrandenburg im Urlauberdorf Klink, um mit Lotte Ulbricht in ihrer Funktion als Mitglied der Frauenkommission beim Politbüro und mit Margarete Müller, Vorsitzende der LPG Kotelow und Kandidat des Politbüros, über die Lage zu beraten. Hans Beiser, Leiter des Büros für Landwirtschaft der Bezirksleitung, sorgte für den ersten Lacher im Saal und bei Lotte Ulbricht für leichte Verstimmung: Er begrüßte sie als »Genossin Walter Ulbricht«. Nach der lebhaften Diskussion, auf der viele über ihre Erfahrungen und Erfolge berichteten, lobte Lotte Ulbricht die großen Talente und organisatorischen Fähigkeiten der Bäuerinnen und monierte, »dass die Bäuerinnen noch nicht die notwendige Unterstützung erhalten. Das beginne bei der Bezirksleitung der Partei. Genossin Ulbricht schlug vor, im Bezirk einen komplexen und konkreten Plan für die Förderung der Bäuerinnen auszuarbeiten. Nur wenn die Frauen entsprechend ihrer Stellung in der Gesellschaft in die Leitung der Genossenschaft einbezogen werden, kann der Bezirk die Produktion maximal steigern.«[71] Anschließend kam sie zu mir. Sie hatte unser Agitationsmaterial in der Hand und meinte, was das solle mit dieser industriemäßigen Produktion in der Landwirtschaft. Ich war irritiert und sagte, dass die Partei es so beschlossen habe. Und baute darauf, dass ihr Walter daheim erläutere, was damit gemeint sei. Uns war das offensichtlich mit unserem Material nicht gelungen. Irgendwie schien unsere Beziehung unter keinem glücklichen Stern zu stehen. Im darauf folgenden Jahr wollten wir den 20. Jahrestag der demokratischen Bodenreform mir einem Staatsakt in Neubrandenburg begehen und zugleich das 1. Zentrale Erntefest der DDR feiern. Nachdem im Frühjahr die Ernteaussichten gut standen, sorgte ein nasser Sommer für gewaltige Einbrüche. Die Halme knickten unterm Regen, die Getreidefelder lagen flach. Auch wenn die Mähdrescherbesatzungen sich tapfer mühten, waren die Einbußen groß. Mit Berlin entschieden wir, das Erntefest abzusagen. An die Bodenreform und den schweren Anfang wollten wir dennoch erinnern. Der Karl-Marx-Platz in Neubrandenburg war bis auf den letzten Meter gefüllt, so viele wollten Ulbricht sehen und sprechen hören. Während er in einer Fernsehrunde mit LPG-Vorsitzenden saß, sollte ich mit Lotte Ulbricht hinauf zur Aussichtsplattform des Hauses der Kultur und Bildung fahren, um ihr die Stadt von oben zu zeigen. Doch o Schreck: Der Fahrstuhl fuhr nicht. Was für eine Blamage. Der Techniker war hilflos, drückte die Knöpfe, und auch mir wurde unwohl. Da bückte sich Lotte Ulbricht und polkte etwas aus der Führungsnut der Tür. Triumphierend hielt sie uns den Kronkorken einer Bierflasche vor die Nase. Offenkundig hatte doch jemand das Erntefest gefeiert. Die Fahrstuhltür schloss und es ging aufwärts ...
Kurt Blecha: Im Juni 1961 hatte niemand die Absicht, eine Mauer zu errichten
Kurt Blecha (1923-2013), sowjetische Kriegsgefangenschaft 1943, aktiv im Nationalkomitee »Freies Deutschland« seit dessen Gründung. 1946 Eintritt in die SED. Bis 1952 tätig bei der »Schweriner Volkszeitung«, danach, bis 1958, Stellvertretender Leiter des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR, das er schließlich bis 1989 leitete. Das Gespräch fand am 26. Januar 2013 nach einem Krankenhausaufenthalt statt. Kurt Blecha verstarb am 1. März 2013 kurz nach seinem 90. Geburtstag. Du hast jene denkwürdige Pressekonferenz am 15. Juni 1961 im Großen Festsaal des Hauses der Ministerien geleitet. Es waren etwa 350 Journalisten erschienen. Neben dir saßen Walter Ulbricht sowie Gerhart Eisler, damals Stellvertretender Chef des Staatlichen Rundfunkkomitees, das Politbüromitglied Albert Norden, Hermann Axen als Chefredakteur des Neuen Deutschland und Gerhard Kegel als Ulbrichts Mitarbeiter. Da ging es also um den Bau einer Mauer quer durch Berlin? Unsinn. Am gleichen Tag, einem Donnerstag, hatte Chruschtschow in Moskau im sowjetischen Fernsehen über sein Treffen mit US-Präsident Kennedy in Wien[Anmerkung 90] berichtet. Der Auftritt wurde live von der Intervision[Anmerkung 91] übertragen, wir kannten vorab die Erklärung, die auch anderentags auf der ersten Seite des Zentralorgans der SED unter der Überschrift veröffentlicht wurde: »Friedensregelung noch in diesem Jahr. Hauptsache: Totale Abrüstung.« Ulbrichts Pressekonferenz war die Reaktion darauf. Sie stand unter der These: »Nutzen wir die große Chance für den Friedensvertrag und die Wiedervereinigung.« Die Vorschläge Chruschtschows zur Lösung der Berlin-Krise[Anmerkung 92] zielten auf eine sogenannte Drei-Staaten-Lösung. Westberlin sollte als Freie Stadt einen »rechtlich fundierten und international garantierten Status« erhalten, die vier Siegermächte sollten endlich mit Deutschland, d. h. mit den beiden deutschen Staaten, einen Friedensvertrag auf der Basis des Potsdamer Abkommens schließen, der drittens – »ein erster und wichtiger Schritt zur militärischen Neutralisierung« sein sollte. Von »Wiedervereinigung« war bei Chruschtschow nicht die Rede. Das ist richtig. Das war auch einer der Gründe, weshalb Ulbricht der Meinung war, die DDR müsste der Welt ihre Position zu Chruschtschows Vorstoß mitteilen. Ulbricht sah darin eine Möglichkeit, »zwischen den Partnern der Antihitlerkoalition und zwischen den beiden deutschen Staaten eine Verständigung über die friedliche Lösung der deutschen Frage zu erreichen«.[72] Das war in seinen Augen eine »große Chance« zur »nationalen Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender und demokratischer Staat«, ein »Ausgangspunkt für eine neue Entwicklung in Deutschland«. Den Abschluss eines Friedensvertrages wertete er als einen »sehr großen Beitrag zur Sicherung der friedlichen Koexistenz in Deutschland und zur Wiedergeburt Deutschlands«. Ganz klar also: Walter Ulbricht setzte nationale Akzente. Seine Formel von der »nationalen Wiedergeburt« benutzte er in seinem Eingangsstatement mehrere Male. Ich war, wie Ulbricht, seinerzeit bei der Gründung des Nationalkomitees »Freies Deutschland« 1943 dabei: Die dort versammelten Antifaschisten wollten die nationale Wiedergeburt. Ulbricht zog diese Linie ganz bewusst. Als Traditionslinie? Er wollte damit wohl sagen, dass erstens das Ziel, wofür damals das NKFD als Teil der Antihitlerkoalition und damit die Siegermächte – angetreten war, noch nicht erreicht sei, dass also diese Rechnung seit sechzehn Jahren unverändert offen ist. Und dass zweitens die fatale Nachkriegsentwicklung in Gestalt der deutschen Zweistaatlichkeit, also der Teilung Deutschlands, korrigiert werden müsse. Dieser Aspekt spielt in den Berichten heute absolut keine Rolle. Von der Pressekonferenz wird lediglich – und das wieder und wieder, weil sie doch angeblich Ulbricht der Lüge überführt– nur diese Sequenz gezeigt, als er auf eine Frage von Annamarie Doherr[Anmerkung 93] von der Frankfurter Rundschau antwortet: »Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.« Mit diesem Zitat wird nicht nur der ganze historisch-politische Kontext ausgeblendet, sondern auch das, was er davor und danach sagte. Diese Praxis ist ein – wenngleich übler – Beweis für die Tatsache, dass mitunter halbe Wahrheiten ganze Lügen sein können. Ein amerikanischer Journalist – die Pressekonferenz lief schon geraume Zeit– erkundigte sich bei Ulbricht, was dieser von dem Vorschlag halte, den gestern US-Senator Mike Mansfield[Anmerkung 94] gemacht habe. Der Fraktionschef der Demokraten wollte ganz Berlin, nicht nur den Westteil, zur Freien Stadt machen. Ulbricht sagte: »Die Hauptstadt der DDR ist kein Gegenstand von Verhandlungen.« Aber es sei selbstverständlich, dass nach Abschluss eines Friedensvertrages »Einzelverhandlungen über eine Reihe Fragen stattfinden müssen, die die Westberliner Bevölkerung und die Verwaltung in Westberlin interessieren und die das Verhältnis zur Deutschen Demokratischen Republik betreffen. Das wird man alles in sachlichen Verhandlungen klären und vereinbaren.« Daraufhin meldete sich Annamarie Doherr, nannte ihr Blatt und sagte: »Ich möchte eine Zusatzfrage stellen, Herr Vorsitzender! Bedeutet die Bildung einer Freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen?« Darauf strich sich Ulbricht über den Bart und antwortete: »Ich verstehe Ihre Frage so, dass es in Westdeutschland Menschen gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR dazu mobilisieren, eine Mauer aufzurichten. Mir ist nicht bekannt, dass eine solche Absicht besteht. Die Bauarbeiter unserer Hauptstadt beschäftigen sich hauptsächlich mit Wohnungsbau, und ihre Arbeitskraft wird dafür voll eingesetzt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich habe vorhin schon gesagt: Wir sind für vertragliche Regelung der Beziehungen zwischen Westberlin und der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik. Das ist der einfachste und normalste Weg zur Regelung dieser Fragen. Die Staatsgrenze verläuft, wie bekannt, z. B. an der Elbe usw. Und das Territorium Westberlins gehört zum Territorium der Deutschen Demokratischen Republik.[Anmerkung 95] In gewissem Sinne gibt es selbstverständlich staatliche Grenzfragen auch zwischen Westberlin und der Deutschen Demokratischen Republik, wenn die Neutralisierung Westberlins erfolgt. Aber es besteht ein Unterschied zwischen den Regelungen, die für die Staatsgrenze mit Westdeutschland gelten, und den Regelungen, die für Berlin getroffen werden.« Das war Ulbrichts ganze und ziemlich komplexe Antwort an Doherr. Und daraus wurde, als aufgrund des in Moskau sechs Wochen später gefassten Beschlusses tatsächlich eine Mauer rings um Westberlin errichtet wurde, dieser eine Satz genommen, weil dort zufällig das Wort »Mauer« vorkam. Abgesehen davon finde ich schon allein die Tatsache bemerkenswert, dass Ulbricht sich mehrere Stunden einigen Hundert Journalisten stellte und in freier Rede auf alle Fragen der einheimischen wie auch der Journalisten aus den USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Belgien, Niederlande, Schweiz, Österreich, Schweden und der Bundesrepublik, nicht gerechnet jene aus den sozialistischen Bruderstaaten und aus jungen Nationalstaaten, sehr kundig und souverän reagierte. Ja, da hatte er keine Scheu, ihm gefiel das. Ich habe in meiner Funktion als Leiter des Presseamtes viele solcher Pressekonferenzen in den 60er Jahren organisiert. Später nicht mehr. Ulbricht stellte immer wieder die Frage von Krieg und Frieden und den Abschluss eines Friedensvertrages heraus. Auch die Ökonomie zwang zum Handeln, ferner die Überwindung der Hallstein-Doktrin, also die Anerkennung der DDR ... Er hatte eine Prioritätenliste. Diese Punkte waren für ihn nachgeordnet. »Ob die eine deutsche Regierung die andere anerkennt«, sei zweitrangig. »Ob wir uns gegenseitig anerkennen oder nicht – das ist eine ganz untergeordnete Frage. Die beiden deutschen Staaten existieren nun einmal. Und jeder, der real denkt, nimmt das zur Kenntnis. Ob das diesem oder jenem passt oder nicht, das ist dabei ganz unwesentlich.« Der Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hakte nach: »Sie hatten aus Anlass des 15. Jahrestages der SED erstmals davon gesprochen, dass der sogenannte Menschenhandel, wie Sie sagten, die Republikflucht, die Bürger der DDR jährlich über eine Milliarde kostet. Steht die Dringlichkeit des Friedensvertrages und die Lösung des Westberlin-Problems auch damit in Zusammenhang?« Ulbricht reagierte auch darauf, wenngleich indirekt: »Die Abwerbung von Menschen aus der Hauptstadt der DDR und aus der Deutschen Demokratischen Republik gehört zu den Methoden des Kalten Krieges. Mit Menschenhandel beschäftigen sich viele Spionageagenturen, westdeutsche, amerikanische, englische, französische, die in Westberlin ihren Sitz haben. Wir halten es für selbstverständlich, dass die sogenannten Flüchtlingslager in Westberlin geschlossen werden und die Personen, die sich mit dem Menschenhandel beschäftigen, Westberlin verlassen. Dazu gehören also nicht nur die Spionagezentralen der westdeutschen Bundesrepublik, sondern auch die Spionagedienste der USA, Frankreichs und Englands. Ich möchte hinzufügen, dass es selbstverständlich Menschen gibt und geben wird, die die Absicht haben, ihren Wohnsitz zu ändern. Die einen wollen aus der Deutschen Demokratischen Republik nach der westdeutschen Bundesrepublik umsiedeln, die anderen wollen aus der Bundesrepublik in die Deutsche Demokratische Republik umsiedeln. Besonders viele Soldaten wollen aus der westdeutschen Bundesrepublik in die DDR umsiedeln. Das darf selbstverständlich alles nur auf gesetzlichem Wege geschehen. Die Ein und Ausreise von Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik ist – so wie auch in anderen Staaten – durch Gesetz geregelt. In den USA wie in Großbritannien, in allen Ländern, gibt es eine bestimmte Ordnung für die Ein- und Ausreise und auch für das Übersiedeln in ein anderes Land. Dieselbe Ordnung gibt es in der Deutschen Demokratischen Republik, und diese Ordnung wird eingehalten werden. Wer also von den Organen der Deutschen Demokratischen Republik, vom Innenministerium, die Erlaubnis erhält, der kann die DDR verlassen. Wer sie nicht erhält, der kann sie nicht verlassen. Wer von der westdeutschen Bundesrepublik die Erlaubnis erhält, nach der DDR umzusiedeln, der wird umsiedeln. Wer die Erlaubnis nicht erhält, der kann nicht umsiedeln. Das ist eine Ordnung, wie sie in jedem Staat besteht. Wir denken, es müsste doch eine Selbstverständlichkeit sein, dass die Gesetze der Deutschen Demokratischen Republik, die sich in dieser Beziehung nicht von den Gesetzen der USA oder anderer Länder unterscheiden, genauso eingehalten werden, wie die Gesetze zum Beispiel der westeuropäischen kapitalistischen Länder eingehalten werden.« War Ulbricht da ein wenig blauäugig? Ich denke, er war diplomatisch. Und die Rolle des Anklägers, des Opfers, dem andere übel mitspielten, worüber es sich beklagte, war ihm wesensfremd. Er wusste sehr wohl, warum seit über zehn Jahren in Westberlin das Travel Board Office[Anmerkung 96] existierte, weshalb es keinen normalen Reiseverkehr zwischen Ost und West und West und Ost gab. »Die Bewegungsfreiheit der Deutschen in Deutschland wird gegenwärtig durch die westdeutsche Regierung verhindert. Die Bürger der DDR, die nach Westdeutschland kommen, normale Aussprachen mit westdeutschen Bürgern haben und Familienbesuche machen, werden gegenwärtig in großer Zahl in Westdeutschland verhaftet. Das heißt, Westdeutschland hat einen Eisernen Vorhang errichtet. Das geht so weit, dass Herr Adenauer sogar erklärt hat, er sei gegen die Begegnung der Sportorganisationen und der Sportler. Das sei sozusagen Landesverrat«, erklärte Ulbricht auf die diesbezügliche Frage der britischen Daily Mail. Der Chefredakteur der Jungen Welt, Dieter Kerschek, später, von 1972 bis Ende 1989 Chefredakteur der Berliner Zeitung, wollte wissen, ob denn ein separater Friedensvertrag der Sowjetunion mit der DDR denkbar sei, der von Chruschtschow für den Fall angedroht wurde, dass sich die Westmächte nicht auf einen gemeinsamen Friedensvertrag mit ganz Deutschland einlassen würden. Darauf reagierte Ulbricht abschlägig. Also optimistisch, dass es doch zu einem solchen gemeinsamen Vertrag käme. Kann man so sehen. Er ging nicht auf die These ein, dass ein solcher Vertrag die »endgültige Spaltung Deutschlands« bedeuten würde. Er war ganz pragmatisch und spekulierte nicht, Spekulationen der Art »Was wäre wenn?« beschäftigten ihn nicht. Er erklärte stattdessen: »Die Frage steht heute ganz einfach so: entweder durch den Friedensvertrag den Weg zur deutschen Einheit freimachen, oder wie es z. B. der Kriegsminister Strauß wünscht – Westdeutschland geht den Weg der Konföderation der imperialistischen Westmächte und verzichtet auf eine nationalstaatliche Politik Deutschlands. Da wir für die Wiedervereinigung Deutschlands sind, wünschen wir, dass der Friedensvertrag mit den beiden deutschen Staaten beschleunigt abgeschlossen wird. Ich darf daran erinnern, dass die Westmächte mit Westdeutschland eine ganze Reihe Verträge abgeschlossen haben. Ich erinnere an die Vereinbarung über die Schaffung der Separatwährung, an die Vereinbarung über die Schaffung der Bizone, an die Pariser Verträge, an die Eingliederung Westdeutschlands in die NATO. Ich stelle die Frage an die Regierungen der Westmächte: Haben Sie jemals beim Abschluss dieser Verträge, die einen offenen Bruch des Potsdamer Abkommens darstellen, die Meinung des Vertragspartners der Antihitlerkoalition, der Sowjetunion, respektiert? Niemals! Die USA haben auch mit Japan einen Friedensvertrag abgeschlossen, ohne die Sowjetunion vorher zu fragen. Die Sowjetunion dagegen handelt loyal, handelt im Zeichen des Verständigungswillens, indem sie jetzt den Westmächten gemeinsame Verhandlungen über den Friedensvertrag mit Deutschland – und Verhandlungen der beiden deutschen Staaten ebenfalls über die Frage des Friedensvertrages vorschlägt. Die Methode der Sowjetunion ist also eine andere Methode als diejenige der Westmächte beim Pariser Abkommen, beim Japanvertrag, bei der Eingliederung Westdeutschlands in die NATO. Ich darf daran erinnern, dass die Abkommen, die in Paris mit Westdeutschland abgeschlossen worden sind, nicht etwa von der westdeutschen Bevölkerung gebilligt wurden. Die westdeutsche Bevölkerung wurde gar nicht gefragt. Eine Volksabstimmung über die Pariser Verträge und die Eingliederung in die NATO wurde von Herrn Adenauer verhindert. Das ist allgemein bekannt.« Soweit ich informiert bin, strebte seinerzeit die DDR die Kontrolle des Luftverkehrs an. Wenn Tempelhof und Gatow in Westberlin – den Flugplatz Tegel gab es noch nicht – geschlossen und der gesamte Flugverkehr von Berlin ins Bundesgebiet etwa in Schönefeld abgewickelt werden würde, so die völlig logische Überlegung, würde das Loch im Zaun geschlossen werden können. Denn bekanntlich »flohen« die Ostdeutschen nach Westberlin, und von dort flogen sie in die Bundesrepublik. Dieses Problem hätte sich damit auf elegante Weise erledigt. Ja, deshalb nahmen Fragen und Antworten Ulbrichts zu diesem Komplex ziemlichen Raum ein. Auf eine entsprechende Frage eines Vertreters der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung erklärte er unumwunden: »Wir haben nicht die Absicht, den Verkehr zu unterbrechen. Wir haben die Absicht, mit den betreffenden Regierungen über die Neuregelung des Luftverkehrs zu verhandeln. Wir sind gar nicht daran interessiert, den Luftverkehr zu unterbrechen. Wozu auch? Wir sind daran interessiert, dass eine Neuregelung erfolgt, d. h. dass eine vertragliche Basis für den Luftverkehr geschaffen wird.« Daraufhin kam die Zwischenfrage des Korrespondenten der New York Times, ob er das so verstehen solle, dass im Falle einer solchen Vereinbarung der Flughafen Tempelhof stillgelegt werden solle, was allgemeine Heiterkeit im vollbesetzten Saale auslöste, wobei mir nicht klar, weshalb gelacht wurde: Weil die Idee so abseitig war, oder weil der Mann es noch immer nicht begriffen hatte, dass es Ulbricht genau darum ging. Ulbricht darauf sibyllinisch: »Das hängt nicht von mir ab. Vielleicht legt er sich selbst still. Das ist für uns kein Problem. Wir erwarten die Vorschläge der Westmächte über diese Fragen. Wir machen unsere Vorschläge, und sie werden ihre machen. Wenn die Vertreter der Westmächte oder Westberlins vorschlagen, dass der Flughafen Tempelhof stillgelegt werden soll, werden wir uns darüber unterhalten.« Wie sahen die Reaktionen aus? Offiziell? Keine. Das führte ja letztlich zur Entscheidung in Moskau, eine andere als die mit dem Friedensvertrag angestrebte Lösung für das Berlin- und Grenz-Problem zu suchen. Es gab allerdings vernünftige Äußerungen aus der zweiten und dritten Reihe. Feldmarschall Montgomery[Anmerkung 97] forderte nach Ulbrichts Pressekonferenz die Anerkennung der DDR, Lord Beaverbrook[Anmerkung 98] pflichtete ihm eine Woche später im Massenblatt Sunday Express bei. »Ostdeutschland ist eine Tatsache. Dies anzuerkennen, würde Westberlin nicht mehr gefährden, als es gegenwärtig gefährdet ist. In der Tat, wenn wir klug sind, könnte ein Zustand der Anerkennung noch festere Vereinbarungen für seine Sicherheit bringen. Dies würde die Russen befriedigen, es würde die Berliner befriedigen, und es würde Großbritannien befriedigen. Die einzigen Gegner wären Dr. Adenauer und jene, die gleich ihm nicht wollen, dass Ostdeutschland anerkannt wird.« Das britische Volk sei jedenfalls nicht bereit, für Westberlin »zu kämpfen«. Und die Sunday Times kommentierte: »Man muss auch anerkennen, dass an dem sowjetischen Argument, die Zeit sei in den 16 Jahren seit dem Potsdamer Abkommen nicht stehengeblieben, etwas Richtiges ist.« Und als nichts geschah, sandte Ulbricht am 28. Juni ein Telegramm an Kanzler Adenauer und an den Bundestagspräsidenten Gerstenmayer. »Getragen von der Sorge um die Zukunft der deutschen Nation, entschlossen, zur Sicherung des Friedens in Deutschland und Europa und dadurch zur Wiedervereinigung Deutschlands beizutragen, wendet sich der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik an den deutschen Bundestag und an die Regierung der deutschen Bundesrepublik mit der Aufforderung, unverzüglich der Einleitung von Verhandlungen zwischen Vertretern beider deutscher Staaten über eine Friedensregelung mit Deutschland und Fragen der Wiedervereinigung zuzustimmen. Eine historische Chance für die deutsche Nation gilt es wahrzunehmen! Nach dem Vorschlag der Sowjetunion sollen die vier Mächte von vornherein erklären, dass sie jede Vereinbarung über eine Friedensregelung und Fragen der Wiedervereinigung, die von den Deutschen getroffen wird, anerkennen. Dadurch können wir gemeinsam sichern, dass im Friedensvertrag, der auch die Westberlinfrage lösen wird, die nationalen Interessen des deutschen Volkes gewahrt werden. Der Staatsrat der Deutschen Demokratischen Republik appelliert an den deutschen Bundestag und an die Regierung der deutschen Bundesrepublik, nicht wieder eine große Chance für unsere Nation leichtfertig zu verspielen, wie es leider allzuoft in der Geschichte Deutschlands zum Unglück unseres deutschen Volkes geschehen ist.« Das war nicht der erste Versuch, Bonn zum Einlenken zu bewegen. Es sollte jedoch der letzte vor dem 13. August 1961 bleiben. Für mich ist damit die Mitschuld und die Mitverantwortung des Westens am Bau der Mauer bewiesen.
Wiktor G. Kulikow: Die DDR war souverän, aber nicht auf militärisch politischem Gebiet
Wiktor G. Kulikow, Jahrgang 1921, Bauernsohn, Soldat seit 1939, kommandierte Panzereinheiten an der Belorussischen und an der Ostsee Front. Besuch der Frunse Militärakademie und der Militärakademie des Generalstabes in den 50er Jahren. Befehlshaber der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD) von 1969 bis 1971. Danach bis 1977 Chef des Generalstabes der Sowjetischen Streitkräfte. Von 1977 bis 1989 Oberkommandierender der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages. Am 14. Januar 1977 wurde ihm der Rang eines Marschalls der Sowjetunion verliehen. Abgeordneter der russischen Duma seit 1989. Der »Held der Sowjetunion« Kulikow verstarb kurz vor Drucklegung des Buches am 27. Mai 2013 in Moskau. Genosse Marschall, Sie waren zwischen 1969 und 1971 Chef der sowjetischen Streitkräfte in der DDR, also in jener Zeit, als Walter Ulbricht die Funktion als Erster Sekretär des ZK verlor. Welche Erinnerungen haben Sie daran? Meine Erinnerungen an »Genossen Walter«, wie wir ihn in der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland vertrauensvoll nannten, sind nicht umfangreich und auch widersprüchlich. Dafür möchte ich zwei Begebenheiten nennen: Nach einem Manöver, auf dem wir gefechtsnah probten, welche militärische Macht notwendig war, um Angriffe der NATO zurückzuschlagen, sagte er: »Genosse Marschall, tun Sie alles, dass ein solcher Krieg nicht stattfindet! Unsere Waffen sollen dem Frieden dienen und nichts und niemandem sonst.« Diese Friedenssehnsucht eines gestandenen deutschen Kommunisten hat mich stark beeindruckt. Unvergessen ist mir die zweite Begebenheit ganz anderer Art: Im Frühjahr 1971 fand aus Anlass des 15 jährigen Bestehens der Nationalen Volksarmee der DDR wieder ein Manöver statt. Nach dem Vorbeimarsch der Truppen in Magdeburg wurde ausgewertet. Den Bericht erstattete DDR-Verteidigungsminister Armeegeneral Heinz Hoffmann. Danach haben wir uns zu dritt – unser Botschafter Pjotr Abrassimow, Erich Honecker und ich – von den übrigen Anwesenden entfernt und unter sechs Augen über die Lage in der DDR gesprochen. Dabei ging es im Wesentlichen um »Genossen Walter«. Er habe viel für Deutschland getan: im Nationalkomitee »Freies Deutschland« und beim Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes. Aber es falle ihm immer schwerer, die politische Realität wahrzunehmen, so Honecker. Möglicherweise läge das am Alter immerhin war Ulbricht damals fast achtzig Jahre alt. Der Bruch zwischen dem Ersten und dem Zweiten Sekretär der Partei[Anmerkung 99] war nicht zu übersehen. Als sowjetische Militärs hat uns das sehr betroffen gemacht, denn wir hatten nicht vergessen, dass er damals an unserer Seite gegen die Faschisten kämpfte. Wir waren gewissermaßen Waffenbrüder. Wie die Sache ausgegangen ist, wissen Sie. Mit Ulbrichts Namen ist der sogenannte Mauerbau verbunden. Wie haben Sie die »Mauer« gesehen? Als die Berliner Mauer gebaut wurde, war ich als Leiter einer Gruppe sowjetischer Militärexperten in der Republik Ghana tätig, um beim Aufbau von Streitkräften technische Hilfe zu leisten. Als ich dann später, 1977, Oberkommandierender der Streitkräfte der Staaten des Warschauer Vertrages wurde, habe ich die heute so geschmähte Berliner Mauer schätzengelernt. Durch den Beitritt der BRD zur NATO hätte aus jedem Grenzzwischenfall zwischen den beiden deutschen Staaten ein atomarer Weltkrieg werden können, weil dann der Bündnisfall eingetreten wäre. Die Grenzsicherungsmaßnahmen 1961 klärten die Verhältnisse. Vor diesem Hintergrund wurden Entspannungspolitik, Verträge und Abrüstungsgespräche erst möglich. Es war eine friedenssichernde Maßnahme. Auch wenn es eine richtige Entscheidung des Bündnisses war, wobei natürlich wir als Führungsmacht das entscheidende Wort sprachen, so bezog allein Ulbricht dafür die Prügel. Er wurde im Westen angegriffen. Bis auf den heutigen Tag wird er verleumdet und steht als »Mauerbauer« und »Lügner« in vielen Geschichtsbüchern. Das geht zu großen Teilen auf unser Konto. Wir hätten damals und später deutlich sagen müssen: Nicht Ulbricht und nicht die DDR haben die Grenzmaßnahmen am 13. August 1963 veranlasst, sondern der Warschauer Vertrag. Ulbricht lag, um in unserer Sprache zu reden, im ersten Schützengraben und zog das Feuer auf sich. Und dort haben wir ihn leider lange allein kämpfen lassen. Sie haben im Juni 1996 ein Schreiben[73] an das Landgericht Berlin gerichtet, das auch Armeegeneral Gribkow – er war von 1976 bis 1989 Chef des Stabes der Vereinten Streitkräfte – unterzeichnete. Sie erteilten darin den deutschen Juristen Nachhilfeunterricht in Geschichte, als diese gegen Grenzsoldaten der DDR und Mitglieder des Politbüros vorgingen. Sagen wir so: Wir wollten politische und geschichtliche Zusammenhänge sichtbar machen. Die »innerdeutsche Grenze« hatte Mitte der 50er Jahre aufgehört zu existieren. Mit dem am 9. Mai 1955 vollzogenen Beitritt der BRD in die NATO und dem Beitritt der DDR am 15. Mai des gleichen Jahres in die Organisation des Warschauer Vertrages war nicht nur die Spaltung Deutschlands endgültig zementiert. Diese Grenze war auch die sensible Trennlinie zwischen den beiden mächtigen militärischen Gruppierungen, deren zuverlässige militärische Sicherung eine erstrangige Bedeutung hatte. Deshalb darf man die Ereignisse an dieser Grenze in den Jahren von 1961 bis 1989 nicht aus dem historischen Kontext des Kalten Krieges und der ständigen Konfrontation der bedeutenden militärischen Potentiale herauslösen, die die Lage auf unserem Kontinent in dieser Periode kennzeichneten. In den seit 1961 gängigen Darstellungen über Ulbricht und seinen Beitrag am »Mauerbau« wird so getan, als sei er allein dafür verantwortlich, einige Historiker verstiegen sich sogar zu der Behauptung, er habe Moskau gedrängt, wenn nicht gar gezwungen, diese Maßnahme zu ergreifen. Alle wichtigen Entscheidungen, die mit den Problemen der Verteidigung der DDR einschließlich der Grenzsicherung im Zusammenhang standen, wurden unter Berücksichtigung der Interessen der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages getroffen. Deshalb waren auch die Sicherungsmaßnahmen vom 13. August 1961 in Berlin das Ergebnis eines Beschlusses des Politisch Beratenden Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages. Diese Grenze und die Grenzsicherungsmaßnahmen hatten in der Periode des Kalten Krieges eine große Bedeutung für die Aufrechterhaltung des Friedens in Europa. Deshalb wurde von unserer, von sowjetischer Seite, immer aktiv und wirksam Einfluss auf alle Grenzsicherungsmaßnahmen genommen, der pioniermäßige Ausbau der Staatsgrenze eingeschlossen. Ausgehend davon wurden die Fragen des Grenzregimes sowohl durch Vereinbarungen zwischen der DDR und der UdSSR als auch im Rahmen des Warschauer Vertrages geregelt. Die DDR als unser wichtigster Verbündeter hat sich immer und mit großer Disziplin im Interesse unseres Bündnisses den »Empfehlungen« und »Bitten«, die faktisch Weisungen darstellten, untergeordnet. Wie sah der »aktive und wirksame Einfluss auf alle Grenzsicherungsmaßnahmen« konkret aus? Das Oberkommando der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages war immer über Stärke, Struktur, Bewaffnung und Ausbildung der Grenztruppen der DDR sowie alle Grenzsicherungsmaßnahmen einschließlich des pioniermäßigen Ausbaus der Staatsgrenze informiert. Auf Weisung der sowjetischen militärpolitischen Führung haben wir aktiv Einfluss auf diese Maßnahmen genommen. Da die Nationale Volksarmee und die Grenztruppen der DDR im Verteidigungszustand dem Oberkommandierenden der Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland unterstellt worden wären und im Bestand der von ihm geführten Front ihre Aufgaben zu erfüllen gehabt hätten, nahmen das Oberkommando und der Stab der Vereinten Streitkräfte Einfluss auf die Ausbildung der Grenztruppen und den Ausbau der Staatsgrenze. Alle wichtigen Unterlagen über die Staatsgrenze einschließlich der Minenfelder befanden sich beim Stab der GSSD. Es gab keinen sowjetischen Regimentskommandeur, Divisionskommandeur oder Armeebefehlshaber, der nicht regelmäßig mit den Offizieren der DDR Grenztruppen »seinen Grenzabschnitt« inspiziert hätte. 70 Prozent der an der Grenze der DDR zur BRD eingesetzten Grenztruppen wären im Verteidigungsfalle den sowjetischen Kommandeuren und 30 Prozent den Divisionskommandeuren der NVA unterstellt worden. Da die 45.000 Angehörigen der Grenztruppen der DDR, auch wenn sie im Frieden nicht zu den Vereinten Streitkräften gehörten, in ihren operativen Plänen zu den Gefechtselementen gezählt wurden und ihre konkreten Aufgaben hatten, wurden in den Befehlen und Direktiven des Oberkommandierenden der Vereinten Streitkräfte konkrete Aufgaben für die Verteidigung und Sicherung der Staatsgrenze und für das Zusammenwirken der Landstreitkräfte mit den Grenztruppen gestellt. Aus diesem Grund nahmen die Grenztruppen an gemeinsamen Übungen der Sowjetarmee und der Nationalen Volksarmee teil. Der Oberkommandierende der Vereinten Streitkräfte und sein Stab waren immer durch den Vertreter des Oberkommandierenden bei der NVA der DDR über die Lage an der Staatsgrenze und über schwerwiegende besondere Vorkommnisse im Grenzgebiet informiert. Dieser sowjetische General, der den Oberkommandierenden der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages bei der NVA vertrat und im Verteidigungsministerium der DDR arbeitete, erhielt jeden Tag um 8.00 Uhr die operative Tagesmeldung, nahm an allen Kollegiumssitzungen und Kommandeurstagungen in der DDR teil und hatte das Recht, Kontrollen in den Teilstreitkräften und bei den Grenztruppen in der DDR durchzuführen. Nun war doch aber die DDR ein souveräner Staat … Die DDR war ein souveräner Staat, Mitglied der UNO und von 138 Staaten diplomatisch anerkannt. Sie war auf allen Gebieten souverän – aber nach unserer Einschätzung nicht auf militärpolitischem und militärischem Gebiet. Dafür gab es zwei Gründe. Erstens: die exponierte militärgeografische Lage der DDR in Europa als Vorposten des Warschauer Vertrages und die dortige Präsenz einer 500.000 Mann starken, in ihrer Kampfkraft unvergleichlichen Elitegruppierung der sowjetischen Truppen, ausgerüstet mit modernster Bewaffnung und Ausrüstung einschließlich von Kernwaffen auf dem Territorium der DDR. Dadurch bedingt verlief der vordere Rand der ersten strategischen Verteidigungslinie der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages entlang der Staatsgrenze der DDR und der BRD. Deshalb hatte die sowjetische Seite auch das militärische Sagen auf dem Territorium der DDR. Zweitens: die feste Eingliederung der DDR und ihrer bewaffneten Organe in die Militärorganisation des Warschauer Vertrages sowie die Einbindung der NVA und der Grenztruppen der DDR im Verteidigungsfalle in die Front der GSSD, die von Moskau gestellte Aufgaben zu erfüllen hatte. Deshalb war die Organisation der Landesverteidigung der DDR, deren Stärke, Bewaffnung, Ausrüstung, Dislozierung und Ausbildung stets den Ausgangsorientierungen aus Moskau untergeordnet. Diese beiden Faktoren und andere zum Teil noch aus der Besatzungszeit rührende Fragen waren die Ursachen dafür, dass die DDR auf militärisch politischem Gebiet nicht souverän war. Wenn ich Sie also richtig verstehe, war weder Walter Ulbricht noch die DDR zu irgendeinem Zeitpunkt in der Grenzfrage Herr des Geschehens? Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen war sowohl die politische als auch die militärische Führung der DDR nicht frei in ihren Entscheidungen. Die Führung der DDR konnte an der Grenze zur BRD und zu Westberlin eigenständig nichts unternehmen. Jegliche Veränderung der Ordnung an der gemeinsamen Grenze der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages erforderte die Abstimmung mit ihm, das heißt mit den höchsten Organen seiner Teilnehmerstaaten. Alleinige Entscheidungen der Führung der DDR in diesen Fragen waren ausgeschlossen, da Alleingänge die Interessen des Warschauer Vertrages berührt und ihn dadurch bedroht hätten. Das wäre von Vertragsmitgliedern, in erster Linie von der Sowjetunion, niemals zugelassen worden.
Manfred Wekwerth: Brecht war Kommunist
Manfred Wekwerth, Jahrgang 1929, geboren und aufgewachsen in Köthen, 1948 Abitur, 1949/50 Neulehrer, 1951 Leiter einer Laienspielgruppe in der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, ab 1. März 1951 am Berliner Ensemble, seit 1952 als Regieassistent Brechts, 1953 SED, 1955 Regisseur am BE, 1960 Chefregisseur, 1968 aus dem BE ausgeschieden, weil Helene Weigel nur noch Brecht und keine Gegenwartsstücke mehr spielen wollte. Regisseur am Züricher Schauspielhaus 1973 bis 1976 (mit seiner Frau Renate Richter als Schauspielerin), dort 1976 das Angebot, die Leitung des Hauses zu übernehmen. Nebenbei Regierarbeiten am Deutschen Theater und Gastregie am National Theatre London (1971). Von 1971 bis 1979 auch Filmregie in Babelsberg. 1977 Intendant des BE. 1979 und 1983 Gastregie am Wiener Burgtheater, nach dem Tod Konrad Wolfs 1982 Präsident der Akademie der Künste, 1986 Mitglied des ZK der SED, 1988 Karl-Marx-Orden, dreifacher Nationalpreisträger der DDR. Du warst bis zu seinem Tod 1956 Brechts engster Mitarbeiter. Wie war dessen Verhältnis zu Ulbricht? Zunächst: Ich fand Ulbricht allein schon deshalb sympathisch, weil er ins Theater ging. Sein Nachfolger war in dieser Hinsicht, ich formuliere es vorsichtig, ein wenig zurückhaltender. Mir gegenüber hat das Honecker einmal so begründet: Wenn Ulbricht was auf der Bühne oder im Kino sehe, äußere er sich hinterher. Gefiele ihm was, fänden es alle anderen auch gut, und wenn es ihm nicht gefiele, würde es verrissen. Er wolle das nicht, sagte Honecker, bleibe darum zu Hause und sehe fern. Naja, das war eine sehr wohlfeile Entschuldigung, aber nicht ganz abwegig. Es gab einige, die aus eben diesem Grunde Ulbricht einluden. Mäde[Anmerkung 100] machte das gern. Als er mal in Rostock bei einem Gastspiel mit einem sowjetischen Stück schwer attackiert wurde, weil angeblich darin die Rotbannerflotte beleidigt wurde, sagte er: Wieso, dem Genossen Ulbricht hat das Stück sehr gut gefallen. Wupps, und schon schwenkten sofort alle Kritiker um. Wenn Ulbricht ins Theater kam: Rauschte er nur durch, oder gab es dann auch Begegnungen mit den Theaterleuten? Er redete gern mit den Leuten, vor allem mit den Damen. Gisela May hatte es ihm besonders angetan. Kam er mit großem Gefolge oder nur mit Lotte? Das Gefolge kam vorher und nachher. Zuvor wurden das ganze Haus inspiziert und die Telefone abgeklemmt. In meinem Arbeitszimmer im Turm installierte die Sicherheit immer ihre Telefone, wenn hoher Besuch kam. Die Leitung ging hinüber in den Friedrichstadtpalast, und ich durfte in dieser Zeit nicht mehr in mein Zimmer. Einmal kehrte ich anderentags zurück, da stand noch das rote Telefon. Ich nahm den Hörer ab und meldete mich: »Wekwerth, Berliner Ensemble, ihr habt ein Telefon bei mir vergessen.« Barsch kam die Antwort: »Wir vergessen nichts!« Gut, sagte ich und legte auf, dann ist es meins. Den Apparat schenkte ich unserem Chefdramaturgen, der brauchte gerade einen, und unserem Techniker sagte ich, er könne sich dreißig Meter Kupferdraht bei mir abholen, der hinge aus meinem Fenster und sei herrenloses Gut. Der hat sich darüber sehr gefreut. Kupferleitungen waren rar. Hast du mal Ulbricht im BE begrüßt? Ich war ein kleiner Regieassistent … Es gab in den frühen 50er Jahren Differenzen zwischen Ulbricht und Brecht. Die waren nicht persönlicher Natur, sondern gingen auf die Formalismus Diskussion in Moskau zurück. Davon waren alle Exilanten irgendwie geprägt. Gegen diese Truppe mit Rodenberg[Anmerkung 101] Valentin,[Anmerkung 102] usw. hatte es Brecht sehr schwer. Ohne die riesigen Gastspiel Erfolge in Paris mit der »Mutter Courage« und »Arturo Ui« wäre die Existenz des BE kaum sicher gewesen. Aber: Obwohl Ulbricht diese Art Theater ablehnte – im Übrigen wie viele Intellektuelle auch –, war er tolerant genug und verhinderte, dass da ein existenzieller Kulturkampf hochkam. Ulbricht soll dem BE sogar einen Anbau spendiert haben …? Das geht auf die Weigel[Anmerkung 103] zurück. Sie war auch im Alter noch sehr charmant und konnte Menschen umgarnen. Bei Gelegenheit einer Auszeichnungsfeier im Roten Rathaus – das BE hatte 1961 für die Inszenierung von »Frau Flinz« den Nationalpreis erhalten – holte sie Ulbricht an unseren Tisch. Er redete etwa eine Dreiviertelstunde mit uns, die Weigel scheuchte unterdessen alle weg, selbst Minister, die was von ihm wollten. Am Ende rückte Walter das Geld raus und hatte, quasi als Gegenleistung, von uns eine Lektion über episches Theater erhalten. Es wurde ja immer unterstellt, dass Brecht und seine Stücke nur auf den Kopf und nicht aufs Gefühl zielten. Von dieser Vorstellung war auch Walter nicht frei. Ulbricht war kunstinteressiert. Durchaus, aber er hielt sich auch für einen Architekten. Wenn ihm ein Modell vorgestellt wurde, verrückte er grundsätzlich die Gebäude, das musste eben so sein. In Kenntnis dieser Unart hatte Henselmann[Anmerkung 104] bei einem Modell von Weimar die Häuser mit Schrauben an der Platte befestigt. Das kam nicht so gut. Ein andermal haben sich beide gekabbelt, was, wie ich meine, beide sympathisch machte. Henselmann pries den Berliner Fernsehturm, von ihm entworfen, als Wahrzeichen der neuen Zeit und verglich ihn mit den Pyramiden, weil diese auch für eine Epoche stünden. Doch dann, in der Abendsonne, bildete sich auf der Kugel ein Kreuz, was nun nicht unbedingt als ein Symbol des Sozialismus galt. Walter war außer sich und ließ Henselmann kommen. Wo sehe er da ein Kreuz, erkundigte sich Henselmann scheinheilig, und schüttelte den Kopf, als Ulbricht auf die Kugel wies. Er sehe dort kein Kreuz, sagte Henselmann, das sei ein Plus. Das Plus als Zugewinn der sozialistischen Ordnung! Am 17. Juni 1953 hast du einen Brief Brechts zu Ulbricht getragen. Drei Briefe. Die anderen brachte ich zu Semjonow[Anmerkung 105] und zu Ministerpräsident Grotewohl.[Anmerkung 106] Ich habe damals als Oberschüler im »Neuen Deutschland« einen Teil des Briefes an Ulbricht gelesen, erst nach der Wende den ganzen Text.[Anmerkung 107] Kannst du aufklären, wie es zu dieser Kürzung kam? Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese auf Weisung Ulbrichts oder des Politbüros vorgenommen worden ist. Der Brief war doch sehr gut. Ich denke, dass war damals Konsens in der Partei, dass man keine Volksaussprache, keine Fehlerdiskussion wollte, zu der ja Brecht aufgefordert hatte. Da wird der Chefredakteur, das war Rudolf Herrnstadt, schon selbst Hand angelegt haben. Ich nahm damals an der Parteiaktivtagung im Friedrichstadtpalast am 16. Juni teil, nach der man nach dem Gesang der »Internationale« beruhigt ins Bett ging und meinte, damit sei die Sache ausgestanden. Brecht rief die Rülicke[Anmerkung 108] Palitzsch,[Anmerkung 109] und mich danach nach Weißensee in seine Wohnung und meinte: Das fängt jetzt erst an! Die Partei habe von den Arbeitern eine Ohrfeige bekommen, sagte er später, aber eine Backpfeife sei auch eine Berührung. Für ihn war das also nicht negativ, sondern eine Art Verfremdung, ein Aufbruch, eine neue Sicht auf etwas. Deshalb schrieb er diesen Satz, an dem ihm sehr gelegen war, welcher jedoch gestrichen wurde, dass die Partei eine große Volksaussprache über die Errungenschaften – die Bodenreform, die Bildungsreform, die Wirtschaftsreform etc. – führen müsse, um diesen gesellschaftlichen Fortschritt zu sichten und zu sichern. Man solle deutlich sagen, dass hier ein Bruch mit der kapitalistischen Vergangenheit erfolgt ist. Wir erklärten stattdessen, dass wir Traditionen fortsetzten, dass wir die bürgerlichen Traditionen bewahrten, um die Leute nicht zu verschrecken. Nein, die DDR war ein Bruch in der deutschen Geschichte. Und das, so Brecht, müsse den Menschen bewusst gemacht werden. Man hätte sie erschrecken müssen und eben nicht beruhigen sollen! Brecht wollte nach dem 17. Juni bei den Menschen durchaus Schuldbewusstsein wecken. Die kapitalistische Nazizeit war ideologisch keineswegs zu Ende. Ich war kein Nazi, war in der Hitlerjugend, aber die preußischen Tugenden, die uns vermittelt wurden, waren verinnerlicht. Und so ging es wohl den meisten Ostdeutschen. Dieses Bewusstsein musste radikal zerstört werden. Aber hatten nicht jene auch recht, die damals erklärten: Wir, der sozialistische deutsche Staat, bewahren die bürgerlich-humanistischen Traditionen, welche die kapitalistische Gesellschaft der Bundesrepublik zerstört? Das war sicherlich richtig, aber eben nur eine Aufgabe. Darüber durfte man die andere nicht vergessen. Nämlich den radikalen Schnitt zu führen. Brecht war ein begeisterter Kommunist. Deshalb war ihm klar, dass ungeheuer viel für den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus getan werden musste, obgleich wir uns ihn 1952[Anmerkung 110] materiell gar nicht hätten leisten können. Umso dringlicher waren neues Denken und neues Handeln. Als Brecht am 17. Juni 1953 die sowjetischen Panzer rollen sah, sagte er, jetzt beginne »unsere Demonstration«. Kannst du mal kurz erläutern, wie er das gemeint hat? Brecht war zwar der Meinung, dass die Arbeiter in der Stalinallee recht hatten zu streiken. Zugleich aber sah er auch den Beginn der Konterrevolution. Und er fürchtete den Ausbruch eines neuerlichen Weltkrieges, wenn sich der Westen einmischen würde. Die Amerikaner waren ausnahmsweise mal klug genug und taten es nicht, sie untersagten Egon Bahr beispielsweise, im Rias diese Resolution zu senden. Wir, also Brecht, Rülicke, Palitzsch und ich, saßen gegen Mitternacht in Weißensee und waren über die Entwicklung deprimiert, als die sowjetischen T 34 draußen vorbeirollten. Da sagte Brecht jenen Satz. Er hat damals auch erwogen, in die Partei einzutreten. Ja, aber den Gedanken hat er bald verworfen. Es ist auch besser so gewesen. Vermutlich. Dann wäre er mit der Parteidisziplin möglicherweise in Konflikt gekommen. Am 17. Juni waren Brecht, Strittmatter, Rülicke und ich Unter den Linden und mischten uns unter die Leute. Brecht hat mit denen diskutiert. Vor den Panzern rollte ein Jeep mit dem Stadtkommandanten, und die Panzer fuhren mit offenen Luken. Die Soldaten sahen die Menschen und meinten, sie jubelten ihnen zu, was aber ein Irrtum war. Das merkten sie erst, als ein Steinhagel einsetzte. Daraufhin schlossen sie die Luken und schossen in die Luft. Auf dem Schlossplatz stand noch die Tribüne vom 1. Mai. Ein Volkspolizist stieg hinauf, und wir dachten, was alle anderen in dem Moment auch dachten: Jetzt wird er die Staatsmacht herauskehren. Aber der sagte im schönsten Sächsisch, es sei ein einzelner Schuh gefunden worden, der Besitzer möge sich bei ihm melden. Seine Mitteilung löste eine solche Heiterkeit aus, dass sich danach bald alles verlief. Über den 17. Juni 1953 wird viel geredet. Dass es fünf Jahre zuvor in der Bizone einen Generalstreik gegen Preiserhöhungen, für höhere Löhne und für Mitbestimmung gab, ist kaum bekannt. Am 28. Oktober 1948 kam es in Stuttgart zu schweren Unruhen. US Militärpolizei setzte Tränengas und Panzer ein. Am größten Streik seit dem Kapp-Putsch 1920 nahmen 79 Prozent der westdeutschen Arbeiter teil. Er wurde von den Amerikanern niedergeschlagen.[Anmerkung 111] Darüber wird jedoch – im Unterschied zum 17. Juni in der DDR – kein Wort verloren. Ja. Ihre eigene Geschichte arbeiten sie ja nicht auf. In deiner Autobiografie berichtest du von der Gewerkschaftsversammlung am 24. Juni 1953, auf der Brecht eine bemerkenswerte politische Rede gehalten hat. Erwin Geschonneck,[Anmerkung 112] damals Gewerkschaftsvorsitzender am BE, verdanken wir das Protokoll dieses Auftritts. Ja, ich finde diese Rede aktueller denn je. Jede Rücksicht, jede Schonung des Kleinbürgertums sei falsch, man müsse die großen Errungenschaften in den acht Jahren seit Kriegsende herausstellen, sagte Brecht. Alle anderen Fragen etwa die Pflege des bürgerlich humanistischen Erbes – seien nachgeordnet. Wir haben unseren Staat schlecht »verkauft«, die Mehrheit glaubte, sie lebe noch immer in einem bürgerlichen Staat mit allenfalls sozialistischer Tendenz. Ich habe diese spontane Rede von Brecht erst sehr viel später gelesen. Vermutlich in der jungen Welt, wo ich sie vor einigen Jahren aus dem von dir genannten Grund publiziert habe. Das trifft zu. Dann lass mich näher darauf eingehen. »Die Regierung sagt selbst, dass Gründe da waren. Die Erbitterung hatte ihre Gründe. Zu gleicher Zeit ist das nicht so einfach hinzunehmen, dass Provokateure die erbitterte Bevölkerung dazu bringen konnten, in solcher Weise aufzutreten. Das ist schon bedenklich. Ich will sagen, wenn ich das ansehe, was zu sehen war, so hatte ich den Eindruck in der Frühe, dass es eine ernste und entsetzliche Angelegenheit war, dass gerade Arbeiter hier demonstrierten. Ich spreche ihnen auch hundertprozentig jede Berechtigung zu. Ich wusste, dass sie abgehalten worden waren, ihrer Erbitterung Luft zu verschaffen, und sie verschafften sich Luft. Was aber zwischen elf, zwölf, dreizehn Uhr geschah, zeigt jedenfalls anderes – ich spreche von dem, was ich gesehen habe. Dieses Berlin ist in einem geistigen Zustand, in dem es anscheinend in der Nazi-Zeit war« hier also kommt, worauf du schon hingewiesen hast, dieser Ideologiebezug. »Da sind noch ungeheure Rückstände geblieben. Es ist einer der Hauptfehler der SED – nach meiner Meinung – und der Regierung, dass sie diese Nazi-Elemente in den Menschen und in den Gehirnen nicht wirklich beseitigt hat. Es ist ein Fehler, wir wissen das von unserem Kunstgebiet, dass es ein Tabu war, ein Verbot, von der Nazibarbarei zu sprechen. Es wurden Bücher am Herauskommen gehindert, wenn darin davon gesprochen wurde. Man hat von der herrlichen Kultur des deutschen Volkes gesprochen, von dem Positiven. Da war kürzlich diese überflüssige Diskussion über Eislers FAUSTUS-Text. Vor Jahren bei unserem Stück DER HOFMEISTER erfuhren wir einen ähnlichen scharfen Angriff, weil wir den Leuten ihre Misere vorführten. Die ganze Nazi-Bande ist aber immer noch da. Sie herrscht nicht mehr, aber geistig ist sie noch immer ganz lebendig. Das sollte vertuscht werden, dem hat sich niemand gestellt. Das ist eine Sache, die in Zukunft ausgegraben werden sollte. Man sollte erklären, was wirklich Sozialismus ist, das hat man überhaupt nicht getan. Man hat sozialistische Einrichtungen geschaffen, ungeheure Leistungen vollbracht, die nur ganz wenigen bewusst sind. Das ist ein großes Versagen, man hat diese großen Verdienste zwar ständig in Art von Lobhudeleien und Phrasen zur Sprache gebracht, aber nicht wirklich bekannt gemacht. Da kann Kunst sehr viel helfen. Sie muss versuchen, die Wurzel des Nazismus und Kapitalismus, die in einer spezifisch deutschen Weise da sind, in der unglücklichen und schmutzigen Geschichte weit zurückgehend, aufzudecken, zu behandeln, zu klären und zur gleichen Zeit wirklich erklären, was neu gemacht wurde: diese großen Umwälzungen auf dem Lande, Vertreibung der Junker, Vernichtung der Monopole, Bildung für die, die von Bildung ausgeschlossen waren, statt Bildung nur für eine kleine herrschende Klasse, Übernahme der Betriebe. Das sind Sachen, die nicht wirklich ins Bewusstsein eingebracht worden sind«, erklärt Brecht sieben Tage nach dem 17. Juni 1953. »Das ist der Hauptfehler der SED – nach meiner Meinung … Der Westen kritisiert ja nicht die Fehler, die hier wirklich gemacht wurden, sondern kritisiert die Vorzüge dieses Staates. Diese Herren stört die Veränderung der Eigentumsverhältnisse an Produktionsmitteln. Für sie herrscht hier zu viel Sozialismus, wo wir gerade davon reden, dass zu wenig Sozialismus herrscht.« In dem Zusammenhang erinnere ich mich an einen Auftritt von Günter Mittag[Anmerkung 113] in der Akademie. Mitglieder des Politbüros mussten bekanntlich regelmäßig vor dem Plenum der Akademie der Künste Rede und Antwort stehen. Das gab es in keinem anderen Land. Dort waren alle Fragen zugelassen. Am besten, nimm’s mir nicht übel, gefiel uns Armeegeneral Heinz Hoffmann, der als Verteidigungsminister sich einmal zu Tucholskys Feststellung, Soldaten sind Mörder, sehr überzeugend äußerte. Er machte auf die Dialektik aufmerksam, dass dies eine Frage des politischen Systems sei. Günter Mittag nun hatte eine Heidenangst und glaubte, uns gnädig zu stimmen, in dem er drei Computer übergab. Peter Hacks,[Anmerkung 114] davon ungerührt, meldete sich. »Herr Mittag, ich habe da mal eine Frage: Warum führen Sie in der DDR wieder den Kapitalismus ein?« Mittag kriegte einen roten Kopf. Hacks begründete seine Frage unter anderem mit dem Hinweis, dass sich die wirtschaftlichen Vorgaben und Prämissen in der DDR immer nur an den kapitalistischen Vorgaben orientierten. Wir würden nur den Westen kopieren, statt uns unserer eigenen Maßstäbe zu bedienen. Das war auch die Sorge Brechts, dass die kommunistischen Werte unter den Tisch fallen könnten, wenn wir zu sehr bürgerlich-humanistische Traditionspflege betrieben. Eben. Darin bestand doch auch der Konflikt zwischen Brecht und Langhoff,[Anmerkung 115] zwischen BE und Deutschem Theater, zwischen Brecht und Rodenberg. Natürlich hat auch Brecht das bürgerliche Erbe »gepflegt«, aber er hat es sozialistisch verändert. Die 50er, 60er Jahre waren politisch ästhetisch die produktivsten Jahre, die die DDR hatte. Es gab eine lebhafte und kontroverse Auseinandersetzung, auch wenn beispielsweise Busch[Anmerkung 116]– der den Klassenkampf in seinen Liedern beschwor – eine Zeitlang nicht gespielt wurde, da sie die gewünschte Harmonie angeblich störten. Es wurde nicht nur theoretisiert. Die Theateraufführungen wurden gegeneinander gestellt: »Egmont« im Deutschen Theater gegen »Winterschlacht« im BE. Wenn eine Revolution auf der Hälfte steckenbleibt, kann sie in den Feudalismus zurückfallen, heißt es bei Volker Braun[Anmerkung 117] im »Großen Frieden«, eines seiner besten Stücke. Die Aufführung wurde nicht sehr gemocht, sie wurde 1979 aber vom DDR Fernsehen »für Archivzwecke« aufgezeichnet. Als Braun im Jahr 2000 den Büchner-Preis, den bedeutendsten Literaturpreis in der Bundesrepublik Deutschland, bekam, regte er an, dass man vielleicht die Aufzeichnung des Revolutionsstücks von damals senden könne. Die Fernseh-Verantwortlichen schauten sich die Aufnahme an – und lehnten die Ausstrahlung ab. Die Inszenierung, hieß es, widerspräche dem DDR-Bild, das eben auf Kulturlosigkeit und Dogmatismus festgelegt war. Lass uns wieder auf Ulbricht zu sprechen kommen. Wie dachtest du damals über ihn, wie siehst du ihn heute? Ich bewunderte an ihm sein Organisationstalent. Wenn er etwas in die Hand nahm, funktionierte das. Ich erinnere mich jener Ausstellung, die er am Rande des VI. Parteitages 1963 organisieren ließ. Dort standen die neuesten technischen Gerätschaften aus aller Welt – und daneben unsere. Das hat mir aus zwei Gründen imponiert: Einerseits offenbarte es die eigene Unzulänglichkeit, und andererseits deshalb mussten sich auch alle Betriebsdirektoren die Exposition anschauen – verstand Ulbricht das als Herausforderung. Er wollte sie provozieren. Hingegen störte mich immer seine Sprache. Es heißt, dass Stalin ihm geraten habe, zum Logopäden zu gehen, damit das gemildert werde. Stalin hatte mit seinem Georgisch ähnliche Probleme. Diesen Rat befolgte Ulbricht nicht. Wir machten uns im Beisein von Brecht über sein Sächsisch lustig. Ein Staatsmann dürfe doch nicht so reden. Brecht antwortete – und das meinte er ernst – wir sollten mal schön still sein. Das sei endlich mal ein Politiker, der darauf angewiesen sei, dass der Inhalt stimme, bei dem die Aussagen bedeutender sein müssten als seine Rhetorik. Brecht mochte keine Blender. Ist der Ratschlags Stalins verbürgt? Das hat mir Falin[Anmerkung 118] erzählt. Stalin kannte das Problem mit der Sprache. Deshalb hat er selbst nur wenige Reden im Rundfunk gehalten. Seine Mundart kam bei vielen Menschen in der Sowjetunion nicht gut an. 1951 sah Ulbricht die Premiere von »Die Verurteilung des Lukullus« von Brecht/Dessau in der Staatsoper. Pieck und Grotewohl suchten anschließend das Gespräch mit Brecht, während ihn Ulbricht offen kritisierte. Hat das mit den sowjetischen Debatten zu tun, von denen du vorhin gesprochen hast? Ich meine ja. Das sowjetische Politbüromitglied Shdanow[Anmerkung 119] hatte diese unsinnige Formalismus-Debatte losgetreten, die in der Musik selbst die größten sowjetischen Tonkünstler wie Prokofjew und Schostakowitsch traf. Seine Shdanowschtschina überlebte ihn, bekanntlich war er selbst schon 1948 verstorben. Und da war Ulbricht ein wenig, sagen wir ruhig, disziplinierter als etwa Pieck und Grotewohl. Ein gewisser »Orlow« – man vermutet Semjonow dahinter – hatte am 21. Januar 1951 in der Täglichen Rundschau, der Zeitung der sowjetischen Besatzungsmacht, »Wege und Irrwege der modernen Kunst« publiziert. Darin sprach sich der Autor gegen »die antidemokratische Richtung der Modernisten, Formalisten, Subjektivisten und so weiter« aus. Die daraufhin in der DDR einsetzende »Diskussion« warf uns in der Kulturpolitik mindestens zwanzig Jahre zurück. Und in dieses Verdikt geriet auch »Lukullus«, eine der besten zeitgenössischen Opern. Dessau[Anmerkung 120] hatte aus dem Orchester die Streicher herausgenommen, der Klang war sehr ungewöhnlich. Ich hatte Karten vom FDJ-Zentralrat und die Weisung bekommen, besonders auf die »Volkstümlichkeit« zu achten. Das war ja das Shdanowsche Verdikt: Volkstümlichkeit statt »rein individualistische Empfindungen einer kleinen Gruppe auserwählter Ästheten«. Die Aufführung hat mich überwältigt, ich war verwirrt. Natürlich war die Musik ungewohnt, doch wenn man sich darauf einließ, war sie durchaus akzeptabel. Aber die Partei hatte sich darauf verständigt, dass sie abzulehnen sei. Und es gab entsprechend präparierte Gruppen im Saal. Doch am Ende standen die meisten Zuschauer jubelnd auf ihren Stühlen. Einen solchen Erfolg hatte noch nie eine moderne Oper erzielt. Und genau darin bestand die Schwierigkeit: Das Stück sollte niedergemacht werden, aber es wurde übermäßig vom Publikum gelobt. Daraufhin hat der versöhnliche Pieck zehn Änderungsvorschläge an Brecht gegeben, die dieser befolgte. Ulbricht aber war auf der sowjetischen Linie. Man brauchte ein Musikstück für die Formalismusdiskussion, und da traf es wohl eher zufällig den »Lukullus«. Dessau war ahnungslos. Er hatte das Beste gewollt. Wir Jungen aber nahmen Brecht übel, dass er den Titel änderte. Er machte aus dem »Verhör des Lukullus« die »Verurteilung des Lukullus«, womit er das Resultat vorwegnahm und gegen seine eigenen Theatergrundsätze verstieß. Der ursprüngliche Titel war offen, der Zuschauer sollte am Ende selber entscheiden, ob Lukullus zu verdammen oder zu loben war. Es heißt, Brecht hat einmal von »entnazen« gesprochen. Das soll auf eine Rede Ulbrichts zurückgegangen sein, die dieser 1948 zur Enteignung von Nazi- und Kriegsverbrechern gehalten habe. Ja, das Zitat im Arbeitsjournal lautete exakt: »das deutsche bürgertum entnazen heißt entbürgern, es hat keinen weg vor sich, nur immer diesen oder jenen ausweg.« 1953 hat Brecht kritisiert, dass es versäumt wurde, das mit der notwendigen Radikalität zu praktizieren. Wir sprachen darüber bereits. Nach dem 1. Deutschlandtreffen 1950 wurden westdeutsche Teilnehmer an der Grenze mehrere Tage festgehalten. Dazu hatte Brecht einen Text geschrieben, den »Herrnburger Bericht«, und Dessau schrieb dazu die Musik. Das Werk war den III. Weltfestspielen im Sommer 1951 und der FDJ gewidmet, und er schickte es darum vorab an den FDJ-Vorsitzenden »Honegger«. Der bestand darauf, jene Zeile zu streichen, in der es hieß: »Und wenn Ernst Busch singt, wär’t ihr doch dabei.« Anderenfalls würde das Stück nicht gespielt werden. Brecht lehnte die Korrektur ab, Busch sei einer der besten Sänger und Darsteller der Welt! Dessau aber, geprügelt wegen »Lukullus«, strich die Zeile. Ernst Busch rächte sich auf seine Weise. Ihm gehörte das Plattenunternehmen »Lied der Zeit«. Als er dort die »Mutter Courage« herausbrachte, schrieb er auf der Hülle zum Lied, dem berühmtesten im Stück und natürlich von Dessau, »Ihr Hauptleut’, lasst die Trommeln ruhn«: »Nach einem alten Marseiller Hafenarbeiterlied.« In welchem Zusammenhang hat Brecht gesagt: Ich habe meine Meinungen nicht, weil ich hier bin, sondern ich bin hier, weil ich meine Meinungen habe? Das hat er in einem Brief an einen westdeutschen Schriftsteller geschrieben, der ihm vorgeworfen hatte, sich am 17. Juni falsch verhalten zu haben. Die Beisetzung Brechts fand im kleinen Kreis von etwa zwanzigig Personen statt. Anderentags, am 18. August 1956, gab es eine große Trauerfeier im BE, auf der auch Ulbricht, Becher, Wandel, Strittmatter und Lukacs gesprochen haben. Kannst du dich daran noch erinnern? Nein, nur daran, dass ich zusammen mit drei anderen den Sarg tragen musste und dass dieser wahnsinnig schwer war. Brecht war bekanntlich in vielen Dingen abergläubisch und hatte die schreckliche Vorstellung, dass er nicht tot, sondern nur scheintot in den Sarg käme. Deshalb hatte er angeordnet, dass ihm die Ärzte nach seinem klinischen Tod ein Stilett ins Herz zu stechen hätten. Und dass er aus Ekel vor den Würmern, die ihn möglicherweise auffressen würden – in einem Zinksarg bestattet werden möchte. Ein Berliner Betrieb hat das Ding über Nacht angefertigt, das sah aus wie eine Munitionskiste, die in den Holzsarg kam. Und wir vier schmächtigen Assistenten mussten diesen schweren Sarg tragen. Auch wenn du dich nicht mehr an Ulbrichts Trauerrede an Brechts Grab erinnerst: Wie fällt dein Urteil über Ulbricht heute aus? Von den Kommunisten, die die schwere Nazi- und die Sowjetzeit überlebt hatten, war er der fähigste Organisator in jedem Sinne, also auch im Denken. Und er unterließ es, was ich bedauerte, etwas gegen sein wenig freundliches Bild in der Öffentlichkeit zu unternehmen. Die meisten Menschen schätzten durchaus, was er tat, aber viele mochten ihn nicht. Er hatte es geschafft, dieses kleine Land in Form zu bringen, aber scheiterte daran, alle Menschen mit- und für sich einzunehmen. Castro hat weitaus größere Fehler gemacht als Ulbricht, er hat den Kubanern Härten auferlegt, die in der DDR zur Katastrophe geführt hätten aber Castro besaß Charisma, eine Aura, weshalb ihm die Kubaner vieles nachsahen und ihm folgten. Es gibt diesen Satz von Bloch, den ich nicht unterschreibe, aber ganz abwegig ist er nicht: Ein Mann ohne Sexappeal solle keine Politik machen. Ulbricht konnte nichts dafür, dass er nicht wie Pieck war, dessen Güte diesen nahbar und väterlich machte. Ulbricht wirkte unnahbar, das was seine spröde Art. Ulbrichts organisatorische Fähigkeiten und Piecks Menschlichkeit in einer Person vereint: Das wäre ein Sonnenaufgang für die sozialistische Idee in Deutschland gewesen. Ich denke, dass Ulbrichts größte Leistung im Neuen Ökonomischen System bestand, in dieser Idee des reformierten Sozialismus, in der das Volkseigentum von einer formalen Kategorie zu tatsächlich empfundenem kollektiven Eigentum werden sollte. Das half mir über manches hinweg. Ich kann nämlich nicht behaupten, dass ich Ulbricht liebte. Aber für diese strategische Überlegung mochte ich ihn. Das das NÖSPL nicht realisiert wurde, war eine Tragödie. Und mir hat er persönlich Leid getan, als dieses Bild im Neuen Deutschland zu seinem Geburtstag erschien: er im Morgenrock und mit Latschen. Weshalb aber mochtest du ihn nicht? Ulbricht las viel, was ich großartig fand. Aber er missverstand manches. Max Walter Schulz, Chefredakteur von Sinn und Form, meldete sich und bat darum, dass die jungen Lyriker, auch wenn sie nicht veröffentlichten, materiell sichergestellt werden sollten. Da hielt Ulbricht eine anderthalbstündige feurige Rede: Die sollen nachts schreiben, lautete die Botschaft. Sie, also Ulbricht und andere seiner Generation, hätten damals auch tagsüber schwer arbeiten müssen, um die Existenz zu sichern, und danach erst hätten sie geschrieben. Er generalisierte immer, übertrug seine Erfahrungen auf die Gegenwart, und wenn er für sich sprach, glaubte er, er spräche für die ganze Klasse. Was meinst du? Es war zwischen dem V. und VI. Parteitag, also nach der sogenannten Tauwetterperiode, als Kurella – im Politbüro für die Kultur zuständig Künstler empfing und erklärte, noch nie zuvor sei die Verbindung von Partei und Kunst so gut und eng wie eben jetzt. Wir saßen also im Sitzungssaal des ZK und hatten die aktuelle Diskussion im Kopf, die im ND über graue Metallvasen geführt wurde, welche auf der Kunstausstellung in Dresden Ulbrichts Unmut erregt hatten. Die Diskussion lief in die Richtung: Es gäbe Intellektuelle, die der Arbeiterklasse die Farbe nehmen wollten! Dagegen wetterte Gisela May.[Anmerkung 121] Baierl[Anmerkung 122] und ich hatten dazu ein Gedicht geschrieben. Die Partei habe schon manchen Kulturkampf gewonnen, hieß es darin, und wir zählten dann die sinnlosen Kämpfe gegen Ringelsöckchen, Niethosen, Beatmusik etc. auf – sinnlos insofern, als wir in der DDR wenig später diese selber produzierten, nachdem wir uns zuvor ideologisch damit scharf auseinandergesetzt und uns dabei wechselseitig verletzt hatten. Anna Seghers[Anmerkung 123] explodierte ebenfalls. Sie sprach zum ersten Mal von einer geistigen Enge in diesem Lande, die überwunden werden müsse. Konrad Wolf[Anmerkung 124] monierte, dass sowjetische Filme »gefiltert«, also aussortiert würden. Fritz Cremer[Anmerkung 125] protestierte gegen die Einmischung in die Kunst durch irgendwelche unwissenden Kulturfunktionäre … Ulbricht saß vorn auf einem Stuhl, es gab kein Präsidium. Nach meinem Eindruck war er von Kurella schlecht vorbereitet worden, er wusste von diesen Widersprüchen nichts. Dann kam auch Paul Wiens[Anmerkung 126] auf die grauen Vasen zu sprechen, und Ulbricht unterbrach ihn wiederholt und diskutierte mit ihm. Das konnte er wirklich gut. In seinem Schlusswort ging er darauf erneut ein und erklärte, die Kunst wolle also der Arbeiterklasse Farblosigkeit, Düsternis und wenig Lebensfreude vorschreiben. Was keiner verlangt hatte. Deshalb rief ich: »Was Sie da sagen, Genosse Ulbricht, stimmt nicht!« Nicht »die Künstler« wollten graue Vasen, sondern Gisela May wolle eine graue Vase. Ich liebe im Übrigen auch graue Vasen, andere bevorzugen eben farbige. Sie schätzen bunte Vasen, Genosse Ulbricht, in Ordnung. Das ist doch keine politische, sondern eine Geschmacksfrage. Also lassen Sie die Leute selbst entscheiden. Ulbricht bedankte sich und kam zum Ende. Am nächsten Tag wurden Baierl und ich zu Sindermann[Anmerkung 127] bestellt. Alles sei gut, es habe keine Folgen, dass ich Ulbricht ins Wort gefallen sei, er habe hinterher selber darüber gelacht. Wunderbar, dachten wir, Brecht hatte also doch recht, man kann mit Worten nicht nur die Welt, sondern auch Ulbricht verändern … Ja, sagte Sindermann, wir haben Ulbricht gesagt, ihr hättet vor lauter Aufregung in der Pause am Buffet eine Flasche Wodka geleert und seid darum vom Alkohol ein wenig befeuert gewesen. Die Partei hatte mal wieder recht und wir uns geirrt.
Hartmut König: »Also du bist der, der immer die Lieder macht?«
Hartmut König, Jahrgang 1947, Abitur mit Berufsausbildung als Kühlanlagenbauer. Nach dem Volontariat beim »Neuen Deutschland« Journalistikstudium an der Karl-Marx Universität Leipzig von 1967 bis 1971, 1974 Promotion. König spielte bei »Team 4« (später »Thomas Natschinski und seine Gruppe«) von 1964 bis 1971 und beim »Oktoberklub« (1966-1973). Nach einer Tätigkeit als Chefredakteur beim Internationalen Studentenbund in Prag wurde er Sekretär des Zentralrats der FDJ (1976) und Mitglied der Kulturkommission beim Politbüro (1979). Dem ZK der SED gehörte er seit 1981 als Kandidat an, ab 1986 als Mitglied. 1989 wurde er Stellvertretender Kulturminister. Nach dem Ende der DDR arbeitete er bis 2010 bei einem Zeitungsverlag in Brandenburg. Im Oktober 1968 erhalte ich vom Mitglied des Staatsrates Hans Rodenberg einen Anruf, ich möge ihn im Amtsgebäude besuchen. Es ginge um das Singen unter der Jugend. Ich fahre also mit der U-Bahn zum Alex und laufe in Richtung Marx-Engels Platz. Habe eine Bahn verpasst und bin spät dran. Als ich Rodenbergs Büro erreiche, werde ich zu Recht erzogen: »Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige.« Der Gastgeber hat eine sonore Stimme. Ich weiß, dass er Schauspieler war und mit der Intendantin des Theaters der Freundschaft verheiratet ist. Er fragt interessiert nach meinem bisschen Biografie. Dafür erzählt er Episoden aus seiner fünf Jahrzehnte längeren Lebenszeit. Spannende, berührende Geschichten. Am Ende ist er Staatsratsmitglied und sagt, warum er mich eingeladen hat. Genosse Hartmut! Wir freuen uns, wie sehr das Singen mit neuer Frische zur Jugendkultur gehört. Du bist uns ein Exponent dafür. Wir werden eine Staatsratstagung zu den Aufgaben der Kultur abhalten. Und der Genosse Ulbricht möchte dich als Teilnehmer dabei haben. Otto Gotsche wird dir eine Einladung in den Hausbriefkasten stecken lassen. Sie ist schon da, als ich nach Hause komme. Das Kuvert mit dem Staatswappen ragt übermütig aus dem Schlitz, man hätte es klauen können. Auch zur Staatsratstagung starte ich auf den letzten Drücker. Alle Teilnehmer sind schon auf ihren Plätzen, die Gänge menschenleer. Mit dem Zeigerschlag finde ich den Tagungssaal. Hans Rodenberg empfängt mich verärgert. Man sitzt spätestens »fünf vor« auf seinem Platz. Und milder: Da du der jüngste Teilnehmer bist, nimmst du bitte zum Essen am Tisch vom Genossen Ulbricht Platz. Und wo ist das? Du läufst einfach den anderen hinterher. Die Tagung beginnt. Das meiste von dem, was verhandelt wird, werde ich vergessen. Nur das verstörte Gesicht von Wolfgang Heinz nicht. Er ist Intendant des Deutschen Theaters und hat gerade mit Adolf Dresen Regie bei einer Aufsehen erregenden Faust I-Inszenierung geführt. Nun will eine Gruppe um Alfred Kurella wissen, in welches modernistische Deutungsdilemma der große Renaissance-Mensch Faust am sozialistischen Staatstheater geraten sei. Der Mime und Theaterleiter von unbestrittenem Rang antwortet mit unterdrückter Wut. Die Arbeit an einem Stück sei mit der Premiere nicht abgeschlossen. Daraufhin kommt Entspannung in die Runde, in der ich viele berühmte Künstler erkenne, die man sonst nur in der Zeitung, in DEFA Filmen oder im Fernsehen sieht. Zur Pause suche ich das Kabinett mit den zwei Buchstaben in der Richtung, die dem Strom der Tagungsteilnehmer entgegengesetzt ist. Das ist ein Irrtum, und ich komme, man ahnt es, als Letzter in den Speisesaal. Walter Ulbrichts Tischrunde ist bereits ins Gespräch vertieft. Das heißt: alle außer ihm. Kulturminister Klaus Gysi und Anna Seghers, die ihm zu beiden Seiten am nächsten, aber mit jeweils reichlichem Abstand platziert sind, plaudern im Oval mit den anderen. Walter Ulbricht hingegen blickt auf einen leeren Stuhl ihm gegenüber. Der ist symmetrisch, also mit gleich großer Distanz, zu seinen Nachbarstühlen gestellt. Das ist der freie Platz, der mir zugewiesen wird. Die Suppe ist serviert. Walter Ulbricht hat eine Nudel im Bart. Man vermutet im berühmten Gesichtshaar unserer Nummer 1 keine Nudel. Loriots Sketch, der mich später an die Begegnung erinnern wird, ist noch nicht auf dem Zelluloid. Der Anblick ist hilfreich intim und lockert die Anspannung, mit der wohl jeder so platzierte Tisch-Genosse zu kämpfen hätte. Guten Tag, sage ich. Guten Tag, sagt Walter Ulbricht, flüchtig aufschauend. Nach einer gefühlten Ewigkeit beginnt er das Gespräch. »Also du bist der, der immer die Lieder macht?« »Ich schreibe auch Lieder. Aber wir sind ein ganzer Klub von Leuten, die texten, komponieren und singen.« »Klub? Wieso denn Klub? – Sicher doch ein Chor?« »Nicht direkt ein Chor. Eben Leute, die gemeinsam Programme gestalten, Lieder schreiben und singen. Ziemlich locker das Ganze.« »Alles schön und gut. Aber ein Klub ist das nicht. Sagen wir, es ist so eine Art chorische Bewegung.« Es ist auch keine chorische Bewegung, aber das Hauptgericht wird serviert. Als die Kellner abgeräumt haben, setzt Walter Ulbricht das Gespräch fort: »Ich habe ganz andere Probleme, ja!« Das ist selbstverständlich. »Ich habe da eine Kommission, die hat nichts weiter zu tun, als zu gucken, wo es in der Welt Weltniveau gibt. Wenn die sagen wir – eine Woche, zwei oder drei Wochen gar nichts tut, ist das ihr Problem. Aber wehe, ich kriege raus, dass es irgendwo in der Welt Weltniveau gibt, und die hat das nicht rausgekriegt, dann geht’s ihr an den Kragen.« Freilich weiß ich das Gröbste über das NÖS, das Neue Ökonomische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft, und kann mir zusammenreimen, wie sehr erfolgreiches Auftreten auf dem Markt und Kenntnis internationaler Standards und Innovationen zusammenhängen. Aber ich erkenne hinter dem leichtfertig belächelten Tonfall unseres Staatenlenkers noch nicht die hintergründigen Dimensionen seines Denkens. Der Nachtisch muss sich beeilen. Lotte Ulbricht, die sich nicht an unseren Tisch setzen ließ, hat die Tagungsfäden fest in der Hand. »Genosse Staatsratvorsitzender, hast du mal auf die Uhr geguckt?« Walter Ulbricht sagt: »Da haben wir uns ganz schön verplauscht.« Steht auf und führt den Zug der Staatsratsmitglieder und Gäste zurück in den Tagungsraum. Klaus Gysi endlich weiß, wo das dringlich gesuchte Kabinett ist. Dort sagt er: »Na, da hast du ja einen prominenten Tischpartner erwischt.« »Er hat mir von einer Kommission erzählt, die für ihn das Weltniveau sucht.« »Ja, solche Kommissionen hat er gerne«, sagt Gysi. Das klingt ein bisschen despektierlich. Aber ich kann mich irren. Ich begegne Walter Ulbricht noch ein zweites Mal – im Mai 1971 auf dem Parlament der FDJ. Da ich in Leipzig studiere, bin ich ein Delegierter dieses Bezirks. Und als für die Presse das obligate Protokollfoto »Genosse Ulbricht im Kreise von Jugendlichen seiner Geburtsstadt« gemacht werden soll, schickt mich FDJ-Chef Günther Jahn in diese heikle Runde. Heikel deshalb, weil Walter Ulbricht kurz zuvor von seiner Funktion als Erster Sekretär des Zentralkomitees der SED entbunden wurde. Formal geschah das »auf eigenen Wunsch«, um »diese Funktion in jüngere Hände« zu geben. Faktisch aber handelte es sich um eine Entmachtung, auch wenn Walter Ulbricht zum Vorsitzenden der SED gewählt wurde und überdies Staatsratsvorsitzender blieb. Neuer Erster Sekretär ist Erich Honecker. Wie das alles vorbereitet wurde, lerne ich später. Aber im Umfeld des Fototermins spüre ich: Es knistert im politischen Gebälk. Keiner will sich den Mund verbrennen. Günther Jahn sagt: »Hartmut, das Beste wird sein, du erzählst dem Genossen Ulbricht über die Singebewegung. Einfach frei von der Leber weg.« »Und wenn er das gar nicht hören will?« »Nur zu! Über die Singebewegung!« Der Palast der Republik ist noch nicht gebaut. Parlamente der FDJ – wie auch die SED-Parteitage – finden in der Werner-Seelenbinder-Halle, nicht weit vom Friedrichshain, statt. Der Fototermin ist in einem der Rückzugsräume des Tagungspräsidiums anberaumt. Günther Jahn, der am liebsten stumm geblieben wäre, steht natürlich auch in dieser Runde und weiß, dass er zumindest das Eis brechen muss. »Der Genosse König will dir was von der Singebewegung der FDJ erzählen.« Walter Ulbricht schaut rüber, den Körper leicht nach hinten gebeugt, die Hände über dem Bauch verschränkt. Die Augen altersmüde und von Wasserwölkchen getrübt. »Ja, was soll ich erzählen? Wir sind so ein Klub. Der Oktoberklub …« »Klub? Was soll das heißen – ein Klub? Seid ihr vielleicht ein Chor?« »Nein, kein Chor. Ein Klub eben, wir machen gemeinsam Programme, schreiben Texte und Musik und singen.« »Ja, aber ein Klub ist das nicht.« »Aber ein Chor auch nicht.« »Na gut, vielleicht trifft es chorische Bewegung besser?« »So ähnlich«, sage ich, weil Günther Jahn mit den Augen rollt. Ich lerne etwas über Langzeitgedächtnis im Alter und frage mich später noch oft, warum Walter Ulbricht das Wörtchen »Klub« derart suspekt war. War es wegen dieser Petöfi-Klubs oder der polnischen, tschechischen und deutschen Abarten, die von Zeit zu Zeit den Sozialismus therapieren wollten und in deren Nähe wir keinesfalls geraten durften? Eine unnötige Sorge. Am Tag nach dem Fototermin jedenfalls kauft meine Großmutter alle in der DDR-Hauptstadt erhältlichen Tageszeitungen und schneidet die eigentlich identischen Lichtbilder aus. Der Enkel mit Ulbricht. War schon richtig, den Jungen, wenn auch spät, in die Pioniere gehen zu lassen. Nicht allein Peter Hacks’ unverstellter Blick auf die Ära Ulbricht hat mich beschämt. Eigentlich konnte man alles wissen, sein Urteil jederzeit an Dokumenten schärfen, wenn man nur souverän genug war, dem Zeitgeist zu trotzen, sobald der zu radieren begann. Aber ich sah nur, dass der Zeitgeist Stadien und Chemiewerke nicht mehr nach lebenden Staatsmännern benennen wollte, dass er sich anschickte, die sozialen Lebensbedingungen zu verbessern und sich verstärkt der Jugend zuzuwenden. Meine Euphorie verwies eine ausgewogene Bewertung der politischen Eigenarten und Brüche Walter Ulbrichts in die Warteschleife. Darin seine Deutschlandpolitik, seine ökonomischen Versuchsanordnungen, sein ambivalentes Verhältnis zu den Ideen in Prag und manches andere, was heutige Neugier auf frühe sozialistische Geschichte und linke Potenziale wieder erfragt. Mit diesem unbemerkten Mangel kam ich in der Ära Erich Honeckers an. Wegen der wirtschaftlichen Probleme, der Wohnungsknappheit, der Versorgungsengpässe legte ich meine Hoffnungen in die Politik des VIII. Parteitages. Aus der Geschichte seither ist vieles zu lernen. Auch dies: Es gibt keine Hoffnung ohne ehrliches Erinnern. Aus den (bislang unveröffentlichen) Erinnerungen von Hartmut König
Erik Neutsch: »Niemand hat die Absicht, in ihr Schaffen hineinzupfuschen«
Erik Neutsch, Jahrgang 1931, nach dem Abitur Studium an der Leipziger Universität 1950 bis 1953, Abschluss als Diplomjournalist, danach bis 1960 Kultur- und Wirtschaftsredakteur bei der Hallenser Tageszeitung »Freiheit«. Anschließend freier Autor. Seit 1964 Mitglied der Bezirksleitung Halle der SED (bis 1989), ab 1974 Mitglied der Akademie der Künste. Sein Buch »Spur der Steine« (1965 von der DEFA verfilmt) gehört zu den erfolgreichsten der DDR-Literatur. Von dem seit den 70er Jahren publizierten Romanzyklus »Der Friede im Osten« über die Geschichte der DDR erschienen jeweils ein Band 1974, 1978, 1985 und 1987. Der fünfte Band, aus dem Neutsch vorab diesen Beitrag zur Verfügung stellte, ist noch nicht beendet. In der Geschichte geht es um eine Treffen Ulbrichts mit Schriftstellern und Malern im Staatsratsgebäude im Januar 1971. Es geschah nicht zum ersten Mal, dass Achim nun, seit er schrieb, seine Thesen vom sozialistischen Realismus verteidigen musste, obwohl er selbst ihn so nicht nannte, zwar vom Realismus sprach, ihn aber, in der Aufhebung bürgerlicher und allgemein kritischer Kunstrichtungen, von der Höhe des wissenschaftlichen Sozialismus aus gestaltet sehen wollte. Er betrachtete ihn als künstlerische Methode, als ein Mittel, mit ihm die Welt nicht nur abzubilden, das auch, ja, aber vor allem, um in sie einzudringen und ihr Geheimstes aufzudecken, es nach außen zu kehren, sichtbar zu machen. Diese Position hatte er auch jüngst erst vertreten, vor ein paar Wochen im Januar, nachdem ihm zu seiner Überraschung außerhalb des Postweges ein Brief mit der Nachricht zugestellt worden war, in Berlin an einer Aussprache mit Walter Ulbricht über Kunst und Literatur teilzunehmen. Verwundert war er darüber auch deshalb, weil Walter Ulbricht, da das Gespräch laut Text der Präzisierung kulturpolitischer Aufgaben des Parteitages dienen sollte, die Einladung nicht als Erster Sekretär des Zentralkomitees der SED unterzeichnet hatte, sondern als Vorsitzender des Staatsrats der DDR, wenngleich er beide, die höchsten Funktionen im Lande, in Personalunion vereinigte. Am Akademieinstitut blieb ihm nichts anderes übrig, als sich erneut für ein oder zwei Tage freistellen zu lassen, was ihm zwar zugestanden werden musste, da es sich um eine gesellschaftliche Tätigkeit handelte, ihm jedoch wegen der Ausfallstunden im Labor gegenüber seinen Mitarbeitern peinlich war und zu schaffen machte. Wie viel nutzbringende Zeit mit den Piophiliden,[Anmerkung 128] dachte er, würde ihm womöglich verloren gehen, wenn während der Beratung über Kunst und Literatur wieder einmal nichts Gescheites herauskäme. Absagen allerdings konnte er die Einladung nicht, das verbot sich, sie war zu hoch angelegt. Also fuhr er nach Berlin, am Vormittag mit dem D-Zug aus Eisenach, kurz vor zehn Uhr ab Halle, mit Halt nur in Bitterfeld, Wittenberg und am Flughafen Schönefeld, Ankunft gegen dreizehn Uhr in Schöneweide, Weiterfahrt von dort mit der S-Bahn übers Ostkreuz zum Alexanderplatz, Umstieg in die U-Bahn bis zur Station Hausvogteiplatz. Diese Route war ihm vertraut, denn er hatte sie bereits etliche Male genutzt, sobald er es mit der Akademie der Wissenschaften zu tun gehabt hatte, deren Domizil in der Nähe lag, und laut Stadtplan erschien sie ihm auch diesmal am günstigsten. Vom Hausvogteiplatz brauchte es nur noch wenige Minuten zu Fuß, ein Stück Oberwallstraße entlang, vorbei an der Ruine der Werderkirche und dem Haus des Zentralkomitees, über die Spreekanalbrücke hinweg, bis sich seinem Blick weithin zur Museumsinsel und dem Dom der Marx-Engels-Platz öffnete. Eine halbe Drehung nur nach rechts, und schon erhob sich vor ihm das Staatsratsgebäude, stand er vor dem in den rötlichen Porphyr eingearbeiteten Portal des ehemaligen Königlichen Schlosses, das in seiner dreigeschossigen Höhe äußerst monumental wirkte, zumal, wenn man wie Achim ideell, also in Kenntnis all dessen, hinzufügte, dass von seinem Balkon aus, der einst zum Lustgartenflügel des zerbombten Hohenzollernpalastes gehört hatte, am 9. November 1918 Karl Liebknecht seine revolutionäre Rede an die Arbeiter Berlins, die Soldatenräte und roten Matrosen gehalten hatte, eine »neue staatliche Ordnung zu schaffen, eine Ordnung des Friedens, des Glücks und der Freiheit«. Er stieg die breiten Stufen der Treppe hinauf, kam sich ein wenig verunsichert vor, als er vor dem Portal die beiden Wachtposten in blitzblanker Paradeuniform, mit Stahlhelm, weißen Handschuhen und vor der Brust gekreuzter Maschinenpistole, passieren musste, denn er fand ihre Anwesenheit, in dieser strammstarren Haltung ausgestellt wie Schaufensterpuppen, so dass es schien, als zuckten sie nicht einmal mit den Wimpern, irgendwie unzeitgemäß, operettenhaft. Am liebsten hätte er sie mit einem Handschlag begrüßt und gefragt, na, wie geht’s, Kumpel, aber er nickte nur kurz, seine Geste blieb unerwidert, und dann betrat er zum ersten Mal das Gebäude. In dessen Innerem, wo ein sehr hohes, lichtdurchflutetes Vestibül ihn empfing, ein über alle Etagen sich erstreckendes und in allen Farben strahlendes Glasgemälde, war zur Seite hin ein relativ schmuckloser Tisch gerückt, an dem zwei freundliche Frauen in einer schlichten, dem Stil des Hauses angepassten Kleidung, Kostümen mit taubenblauen Jacken und Röcken, ihn baten, seine Einladung vorzuzeigen, und ihm den Weg zum Konferenzraum wiesen, auf der mit rotem Teppich ausgelegten Treppe ein Stockwerk höher, links, die Türen seien geöffnet, in einem Raum nebenan könne man auch einen Imbiss zu sich nehmen. Es sei ja noch Zeit. Man versammelte sich. Zwei Leute, Maler beide, die Achim vom Namen und gelegentlichen Abbildungen ihrer Werke her kannte, waren bereits vor ihm eingetroffen, aßen belegte Brötchen und tranken Kaffee, er stellte sich ihnen vor, heiße Steinhauer, sah ihren Gesichtern an, dass sie nichts mit ihm anzufangen wussten, sprach ein paar Worte, und schon mussten sie anderen, die nun nach und nach eintrafen, die Hände schütteln, das eine Mal einer ganzen Gruppe. Einige umarmten sich, sobald sie auf jemanden stießen, den sie offenbar länger nicht gesehen hatten. So erging es im nun folgenden Trubel dem Bildhauer Fritz Cremer, als ihm plötzlich ein Mann aus Leipzig, Mitte fünfzig mit Haarkranz und Hakennase, gegenüberstand, an den er sich jedoch auf Anhieb nicht zu erinnern schien, denn, dicht an Achims Seite, fragte er ihn mehrmals nach seinem Namen, indem er leicht auch die flache Hand hinters Ohr legte. Werner Fleißig, erwiderte der Mann, jedenfalls klang es so, wie Werner und Fleißig. Etwa vierzig Männer und Frauen mochten geladen worden sein, je zur Hälfte Schriftsteller und Maler, und noch drei oder vier andere Personen aus dem Kulturbereich, wie sich zeigte, nachdem man in den Klubsaal gebeten worden war und auf Polsterstühlen um locker gestellte Vierertische Platz genommen hatte. Manche Gesichter kamen Achim bekannt vor, von Zeitschriften und Fernsehsendungen, Erwin Strittmatter fiel ihm auf, Eduard Claudius, der Spanienkämpfer, und Dieter Noll, dessen »Abenteuer des Werner Holt« er verschlungen hatte, und spätestens jetzt wurde ihm bewusst, dass er sich in einem Kreis befand, der durchaus für die Literatur und die bildende Kunst in der Republik als repräsentativ hätte gelten können. Mit etwas Verspätung erschien Anna Seghers, die er von Jugend an, seit er das »Siebte Kreuz« gelesen, verehrte, und sofort erhob sich Alexander Abusch, dem er eine Sternstunde seines Denkens durch den »Irrweg einer Nation« verdankte, und bot ihr seinen Stuhl an, damit sie dem Präsidium am langgezogenen, mit weißem Tuch bedeckten Tisch möglichst nahe sein konnte. Doch bevor sie sich setzte, blickte sie noch durch den Saal, blinzelte mit den Augen, fand den Dichter Demant nur zwei Plätze weiter hinter sich und begrüßte ihn, mit einer fast demonstrativ wirkenden Freundlichkeit, wie Achim zu bemerken glaubte. Pünktlich um fünfzehn Uhr, der vorgegebenen Zeit, erschien Walter Ulbricht, begleitet von einigen Männern, den Sekretären des Politbüros Paul Verner und Kurt Hager, dem zurzeit amtierenden Minister für Kultur, Klaus Gysi, dem Mitglied des Staatsrates Hans Rodenberg, dem der Ruf eines Urgesteins als roter Schauspieler anhing und der später mehrfach Intendant von angesehenen Theatern war, sogar in Wien und Zürich, und Otto Gotsche, Ulbrichts Sekretär im Staatsrat, selber ein Schriftsteller, Autor von etlichen Romanen über die Arbeiterbewegung, den Achim bereits von Begegnungen her in dem Verlag kannte, der die Bücher von ihnen beiden herausgab. Sich noch mehr Personen mit Namen und Funktion zu merken, die nun, nachdem sie sämtlich von ihren Plätzen aufgestanden waren, als Walter Ulbricht den Raum betreten hatte, aufgefordert wurden, sich wieder zu setzen, vermochte Achim nicht. Er hatte sich ihnen angeschlossen, das schon vom Beginn seines Hierseins an, denn er hatte die Gepflogenheiten eines Staatsempfanges noch nicht gelernt, hatte Beifall mit den anderen geklatscht, ein ernstes Gesicht angenommen und währenddessen das Augenzwinkern mit dem jüngeren Schriftsteller an seinem Tisch geteilt. Jetzt wollte er hellhörig sein, achten auf jedes Wort. Auch geschah es zum ersten Mal, dass er dem ersten Manne im Staat so nahe war, und schon das ließ ihn auf Kommendes gespannt sein. Achim beobachtete ihn, wobei es ihm, da er zur linken Seite hin an einem der vorderen Tische saß, ausgebreitet der Raum vor ihm lag und er somit auch die Tafel des Präsidiums überblicken konnte, sehr leicht gemacht wurde. Walter Ulbricht, mit einem Päckchen weißen Papiers, offenbar Manuskriptseiten seiner Rede, vor sich, griff dann auch nach kurzer Begrüßung und Einleitung durch seinen Sekretär zu einem der Blätter und legte seine Gedanken dar. Es verblüffte, dass er nicht erst großräumig die Lage in der Weltpolitik umriss, zwar die Stellung der DDR in ihr streifte, es aber offenbar jedem überließ, seine Schlüsse zu ziehen. Er kam auf den Punkt, er sprach vom Parteitag, der in einem halben Jahr schon Geschichte sein würde und hoffentlich eine gute, für die Menschen in diesem Land, für ihr Wohlergehen, denn – und Achim, der oft zu bequem war, bei Referaten mitzuschreiben, griff an dieser Stelle zum Kugelstift und machte sich Notizen – denn »der sozialistische deutsche Nationalstaat grenzt sich nicht nur staatlich als selbständiger, souveräner Staat vom NATO-Staat Bundesrepublik ab; es entwickelt sich zugleich in der DDR immer mehr die sozialistische Nationalkultur«. Angesichts dieser Polarisierung der prinzipiell gegensätzlichen Kulturen, die in der DDR und in der BRD herrschen, sei es umso wichtiger, dass sich die Schriftsteller und Künstler unserer Republik mit den ethischen Maximen vertraut machten, die von der sozialistischen Gesellschaft erhoben werden. Diese Formulierungen fand Achim nächsten Tags auch im Neuen Deutschland wieder, der Zeitung des Zentralkomitees der SED, so dass sie, ohne Umschweife derart hart geäußert, dem für die Berichterstattung verantwortlichen Redakteur offenbar ebenfalls, wenn sie nicht gar mit ihm abgesprochen waren, als ein dem Parteitag vorweggenommenes Postulat erschienen sein mussten. Achim kam es entgegen, er hatte sein ganzes Leben lang damit zugebracht, sich von dem, was ihm außerhalb seines Elternhauses stets als gutbürgerliche Moral vorgehalten worden, zu lösen, ja, nicht einmal erst an sich herankommen zu lassen und den Wegen von Vater und Mutter zu folgen. Es gab Zeiten, da war es ihm nicht gelungen, am Ende des Krieges und danach, unterm Einfluss scheinheiliger Volksverhetzer, auch später noch, in den Wintern des Hungers, doch wie froh war er gewesen, sich davon befreit zu haben. Kunst und Literatur, ob klassisch oder bürgerlich-kritisch, von welcher Gestalt auch immer, selbst die Romantik, sobald sie nur, durch marxistisches Denken geläutert, erlebbar war, aufgehoben im Sinne Hegels, hatten daran das größte Verdienst gehabt. Und deshalb war er jetzt Walter Ulbricht dankbar, dass der keinen Tanz vollzog wie auf glühenden Kohlen, sondern die Dinge beim Namen nannte, die Erwartungen, die sowohl vom Staat als auch von der Partei den Schriftstellern und Künstlern aufgetragen werden sollten. Er stand an dem weißgedeckten Tisch, in dessen Mitte, hinter sich breit die in Hellbraun holzgetäfelte Wand, bis zur mittleren Höhe in einer Zickzack Struktur und mit hohen Fensterbuchten, durch deren Scheiben das jetzt trüber gewordene Licht des regenverhangenen Januartages fiel. Er sprach ruhig, unterstützt nur von knappen Bewegungen seiner Hände, wandte sein Gesicht mehrmals eher den Männern im Präsidium zu, den Funktionären, als den Gästen im Saal, den Kunstschaffenden, die er eingeladen hatte, so, als müsse er auch sie überzeugen von dem, was er sagte. Viel später erst hatte Achim erfahren, dass Ulbricht tatsächlich diese Zusammenkunft nicht, wie sonst üblich, mit dem Politbüro abgesprochen hatte, woraus sich dann auch erklären ließ, weshalb er die Schriftsteller und Maler in den Staatsrat und nicht in das Haus des Zentralkomitees gerufen hatte, zumal, wie sich nun zeigte, auch parteilose Künstler und solche von anderen Parteien anwesend waren. Seine Stimme, fand Achim, mit den Füllseln der fragenden Jas jeweils am Ende der Sätze, klang zunächst in der Tonlage, wie man sie von ihm gewohnt war, sehr hell, nahm aber mit der Zeit eine gedämpftere, rauere Färbung an. Die Kunst des Schriftstellers, sagte er, bestehe darin, sich so eng mit dem Volk zu verbinden, dass er die neuen Erscheinungen der gesellschaftlichen Entwicklung erkennt und sich bemüht, sie literarisch zu gestalten, mit all den Konflikten, die dabei auftreten. Das aber erfordere deren geistige Durchdringung, das Wissen um ihre Weiterbewegung in Widersprüchen, so dass unser sozialistischer Aufbau nicht als ein Werk der Technik – das auch, ja? – sondern vor allem als Menschenwerk empfunden wird. Es setzt die Einsicht voraus, den Willen und das Bestreben, sich mit der Kunst in die revolutionären Veränderungen hin zu einer Gesellschaft zu integrieren, in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beseitigt ist und für jeden – für jeden – ein Leben im Frieden möglich sein wird. Ein Maler aus Halle, der vor einem Jahrzehnt noch, was Achim in der Presse verfolgt hatte, den heftigsten Angriffen wegen angeblicher Übernahmen von formalistischen Stilelementen Légers und Picassos in seine oft als Hommagen auf Menschen in historischen Prozessen gedachten Gemälde ausgesetzt gewesen, ergriff, nachdem zur Diskussion aufgefordert worden war, als Erster das Wort. Achim fand es kühn von ihm, glaubte aber, der Mann drängele sich nur vor, zumal er mit einer Eloge auf das letzte Plenum des Zentralkomitees, das 14. der Wahlperiode, anhob, weil er die Kritiken an seiner Malweise und – was nicht ausblieb – an seiner Person vergessen machen wollte. Bald aber hörte er, dass dies nicht der Grund sein konnte, da man ihn erst vor kurzem zum Vizepräsidenten des Verbandes Bildender Künstler berufen hatte, er also aus dem Sammelsurium von Unkenntnis, Missgunst und Beckmesserei ziemlich unbeschadet davongekommen war. Dann jedoch begann er über die Synthese von Architektur und Malerei bei künftigen Neubauten zu sprechen, sowohl in den Städten als auch in der Industrie, verwies auf die großräumigen volksmythischen Arbeiten der Mexikaner Rivera und Siqueiros, und das war, wie man wusste, kein allseits lobwertes Thema. Sein Ton nahm manchmal an Schärfe sogar zu, er stritt darum, die Ideale der Arbeiterklasse nicht nur in der Gestaltung ihres Milieus, ihrer Privatsphäre, sozusagen an den gegenüber dem Biedermeier etwas verbesserten Genrebildern zu zeigen, sondern auch in der Monumentalkunst. Bei allen Fortschritten, die sich inzwischen bei der Vereinigung von Architektur und bildender Kunst ergeben hätten, stehe die Lösung der wichtigsten Aufgabe noch bevor, nämlich ganz große Werke zu schaffen, von denen man sagen könne, in ihnen habe das sozialistische Staatsbewusstsein und die zukunftstragende Kraft der Arbeiterklasse gültigen künstlerischen Ausdruck gefunden. Die Beratung nahm ihren Fortgang, und Achim hatte manchmal Mühe, ihr zu folgen, immer wieder fühlte er sich abgelenkt, da es nicht selten geschah, dass er über den Sinn mancher Sätze in den Vorträgen, wollte er sie voll verstehen, nachzudenken gezwungen war und somit den Anschluss an die Fortführung des Gesagten verpasste. Die Reden, befand er, waren manchmal derart hochgestochen, dass er sie gern und sofort in ein schlichteres Deutsch übersetzt hätte, so zum Beispiel erging es ihm bereits bei dem Maler aus Halle, und er fragte sich noch lange, was der denn mit den »Genrebildern der Biedermänner« gemeint haben könnte. Achim war ohnehin eher ein visueller denn ein akustischer Typ, was man von Leuten sagt, deren Aufmerksamkeit besser über die Augen als über die Ohren gewonnen wird, und so griff er hier und dort auch zum Kugelschreiber, notierte sich dieses und jenes und nahm sich vor, zu Haus in Ruhe darüber nachzulesen: präsumtive Partisanen! Plötzlich schreckte er auf. Diesem Begriff war er schon einmal begegnet, und bei dem Wort »präsumtiv« hatte er gestutzt, war ihm nachgegangen, da er es nicht kannte, hatte im Lexikon nach ihm gesucht, denn er hätte ja auch nicht gewusst, wie es zu schreiben sei. So viel wie »vermutlich«, fand er heraus, sollte es bedeuten, also »wahrscheinlich angenommen«, und im Zusammenhang mit Schriftstellern gebraucht, wie damals so auch heute, erhielt es fast einen bedrohlichen Klang: Schriftsteller sind präsumtive Partisanen. Soeben hatte sich Alfred Kurella, einst Emigrant im sowjetischen Exil und zuletzt langjähriger Leiter der Kulturkommission beim Zentralkomitee, dieses Begriffes bedient, und vor ein paar Wochen war es der für Verlage und Buchproduktion verantwortliche Minister gewesen, als über die Veröffentlichung des druckfertigen Manuskripts von Achims Roman »Schatten des aufgehenden Lichts« gestritten worden war. Zwar waren inzwischen längere Auszüge in Literaturzeitschriften erschienen, so dass man sich, Leser sowohl als auch Kritiker, von Form und lnhalt des Textes ein Bild machen konnte. Die Entscheidung des Ministeriums aber, das Buch für den Druck freizugeben, ließ auf sich warten, indem immer wieder neue Einwände erhoben wurden. Einmal nahm man Anstoß an der Gestaltung des 17. Juni 1953, ein andermal wurde von sogenannten, jedoch streng sich im Hintergrund haltenden Gutachtern bemängelt, dass der Roman eine insgesamt traurige Stimmung verbreite, und schließlich wurden auch Streichungen und Änderungen von ihm verlangt, die er jedoch strikt ablehnte. Daraufhin hatte er, wegen dieses, wie er es sah, sehr zögerlichen Umgangs mit den Mühen von Autoren, auch einen Brief an den Staatsrat geschrieben, Ende November und zu Händen (besser müsste man wohl sagen: zu Augen) des Vorsitzenden, Walter Ulbrichts. Nun rang er mit sich, ob er sich nicht zu Wort melden sollte, um davon zu berichten. Denn das Büro des Vorsitzenden hatte ihm zwar geantwortet, höflich und noch vor Ablauf der Gesetzesfrist, so dass er das Kuvert mit dem Staatswappen im Briefkasten unter der Weihnachtspost fand, aber lediglich mitgeteilt, seine Beschwerde sei zur Bearbeitung an das Ministerium für Kultur weitergeleitet worden. Wenn er sich jetzt aber meldete, das war ihm klar, durfte er es bei diesem, seinem persönlichen Anliegen nicht bewendet sein lassen. Mehr noch, er müsste mit etwas viel Größerem beginnen, mit Höherem im politisch-geistigen Sinne, und so war er gerade beim Überlegen, suchte den klugen Anfang, als ihn die rauchig-tenorige Stimme Ulbrichts aus den Gedanken riss. »Haben Sie keine Angst«, sagte er, »niemand hat die Absicht, ja?, Ihnen in Ihr künstlerisches Schaffen hineinzupfuschen, Ihnen von unserer Seite, des Staates und der Partei, Vorschriften zu machen, wenn es sich um Fragen der literarischen oder bildnerischen Gestaltung handelt. Das, ja?, das überlassen wir den Künstlern selbst.« Er hielt inne, unterbrach sich kurz, und da seine Rede offenbar als Replik auf einen Beitrag gedacht war, den Achim, selbst schon mit der eigenen Wortmeldung beschäftigt, nur flüchtig wahrgenommen hatte, suchte er wohl nach einem Stil seiner Entgegnung, der jede Schärfe vermied. »Warum sage ich das, liebe Freunde und Genossen.« Jetzt schien er sicher zu sein und wandte sich mit voller Brustseite, gekleidet in ein dunkelblaues Sakko, wie auch die anderen am Präsidiumstisch, mit weißem Hemd und rotgestreifter Krawatte, den Versammelten zu. »Was wir allerdings nicht gestatten werden, das ist jede Art der Verunglimpfung unserer Werktätigen, der Pioniere unseres gesellschaftlichen Aufbaus. Das besorgt doch bereits die Westpresse, und das müssen nicht auch Sie noch tun. Die Arbeiterklasse aber und ihre Verbündeten sind die tragenden Kräfte dafür, dass hier, auf dem Boden der DDR, die Banken und Konzerne des Kapitals zum Teufel gejagt wurden, Volkseigentum entstehen konnte, was die ökonomische Grundlage all unseres Schaffens bildet, der Politik des Friedens und des Wohlstands für die arbeitenden Menschen. Wir haben die Brutstätten der Kriegstreiberei und des Völkermords ausgeräuchert, die Stahlkammern des Profits und die Adelsnester auf dem Lande. Das aber, Genossen und Freunde, ja?, das werden uns unsere Feinde niemals verzeihen. Unsere Partei kennt sie.« Er blickte in die Runde des Präsidiums und erntete ein heftiges, zustimmendes Kopfnicken. »Seit über einem Jahrhundert, spätestens seit Marx und Engels kennen wir sie. Unsere Partei des wissenschaftlichen Sozialismus ist im Kampf gegen sie entstanden. Und deshalb bitte ich Sie, vertrauen Sie unseren Erfahrungen. Solange noch Leben im verrottenden Körper des Kapitalismus steckt, solange wird er versuchen, den Siegeszug des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik zu stoppen, seine enteigneten Fabriken und Güter zurückzuerobern, die sozialen und geistigen Errungenschaften in unserem Lande zu löschen, und unsere Ideale wie unsere revolutionäre Ehre, was ja im Westen schon jetzt andauernd geschieht, der Schmach und der Verfolgung aussetzen.« Er unterbrach sich erneut, hüstelte und hielt sich ein Taschentuch vor den Mund. Es war schneeweiß, und als er sich damit übers Kinn und den grauen Bart wischte, fiel Achim die Größe der Hände von Walter Ulbricht auf, so dass er dachte, es könnten tatsächlich die eines Bauarbeiters sein, eines Tischlers, wie man ja von ihm wusste. »Hören Sie uns bitte zu«, sagte er jetzt, nachdem er kurz noch einmal darauf zu sprechen gekommen war, weshalb es sich die Partei nicht gefallen lassen könne, die Gestaltung von Konflikten im Lande derart zu übertreiben, dass ihre Funktionäre als Holzköpfe oder Witzfiguren erschienen. »Natürlich gibt es auch Genossen, die ihren Aufgaben nicht gewachsen sind. Die allerdings sollten Sie ebenfalls ernst nehmen und Ihre Ästhetik dazu selber entwerfen. Uns jedoch geht es hierbei nicht um Literatur, ich betone: nicht um Literatur. Es geht noch immer, auch bei jeder Ihrer Zeilen, um den Existenzkampf zweier diametral entgegengesetzter Gesellschaftssysteme!« Achim hätte nicht gewusst, was es an dieser prinzipiellen Standortzuweisung von Kunst und Literatur zu hadern gegeben hätte, er billigte sie. Unbedingt aber durfte sie nicht pauschal auf das praktische Schaffen bezogen werden, sondern geprüft und beurteilt am Einzelfall eines Werkes und einsichtiger, achtungsvoller, als es zurzeit mit seinem Manuskript geschah. Die Debatte war nach den Worten Walter Ulbrichts neu eröffnet worden, und Achim wollte sich anschließen. Er fragte sich gerade, welche Anrede er wählen sollte (die Teilnehmer vor ihm hatten meist ein respektvolles »Sie« gebraucht, in Verbindung mit Genosse, »Genosse Ulbricht, Sie«, andere hatten ihn auch »Herr Vorsitzender« genannt, wieder andere »Genosse Erster Sekretär« und einige gar, beispielsweise Fritz Selbmann, ehemals Minister für Schwerindustrie, der nach seiner Ablösung nun ebenfalls einige Romane veröffentlicht hatte, sprachen ihn schlicht und einfach mit seinem Vornamen an, »Walter, Du …«). Da die Beratung im Vorfeld des achten Parteitages stattfand, obgleich in den Räumen des Staatsrats, glaubte Achim jedoch, nicht fehlzugehen, wenn er sich des Wortes »Genosse« bediente. Er hob die Hand, wurde aufgerufen, trat hinter seinen Stuhl und brachte seine Kritik an der Hauptverwaltung Verlage des Ministeriums für Kultur vor, indem er auf das Schicksal seines Romans »Schatten des aufgehenden Lichts« verwies, dieses ewige Hin und Her mit zum Teil bösartigen Unterstellungen. »lch bin nicht gewillt«, sagte er, »mich als präsumtiver Partisan verdächtigen zu lassen, wie das auch wieder geschah …« »Das aber war doch als Metapher gemeint, lieber junger Freund«, kam ein Zwischenruf, »ganz allgemein«. »Trotzdem. Ich empfinde es als Beleidigung. Nicht für mich, sondern für mein Schaffen. Da sollte man schon ganz konkret sein und fragen: Partisan gegen wen? Wie andere vor uns gegen Fürsten und sonstige Volksfeinde? Ja. Aber gegen Sozialisten, gegen meine Brüder? Nein!« Er versuchte, seine Erregung zu dämpfen und sich im Ton zu mäßigen. »Wissen Sie, ich muss keine Erzählungen und Romane schreiben. Ich bin Biologe, Genetiker, und habe genug in meinen Labors zu tun. Aber wenn ich mich den Geschichten von Menschen in unserem Land und in unserer Zeit widme, ihren Schicksalen literarisch nachzugehen mich bemühe, dann deshalb, weil ich nicht die Drosophila, die Fruchtfliege, im Glaskasten erforschen will, sondern mich selbst. Wie leben die anderen, und wie lebe ich. Und erst recht müssen meine Texte nicht gedruckt werden. Aber wenn, dann sollen sie mir gehören, sollen allein das Meinige aussagen …« Er gewahrte, wie sich mit einem Mal Walter Ulbricht über den Tisch beugte und an Klaus Gysi wandte, den Kulturminister, der zwei Stühle entfernt von ihm saß, um ihm etwas zuzuraunen. Gysi nickte dann auch mehrmals, wie es aussah, gehorsam und flüsterte hinter vorgehaltener Hand eine Antwort. »lch stimme Ihnen zu, Genosse Ulbricht, wenn Sie uns mahnen, die menschlichen Konflikte in unserer Gesellschaft aufzuspüren und zu gestalten. Doch wenn wir es tun, muss man uns zu Wort kommen lassen, damit die Leser uns hören können. Man muss diesen Hickhack beenden, wie in meinem Fall mit dem Manuskript ›Schatten des aufgehenden Lichts‹, diesen Kreislauf zwischen dem Kulturministerium und dem Staatsrat und wieder zurück, als handelte es sich um ein Rundschreiben von Amt zu Amt, nicht aber um Literatur.« Achim stockte, und hatte er denn genug gesagt, sich verständlich gemacht? Er glaubte es. Nun musste er nur noch einen Abschluss finden. »Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit«, fügte er hinzu, wobei es sich ausnahm, als sei es an alle Anwesenden gerichtet, und setzte sich. Irgendwie, wenngleich er es nicht genauer hätte benennen können, sah er den Gesichtern an, dass sein Auftritt nicht ohne Wirkung geblieben war. Manche blickten erstaunt, einige, obwohl zaghaft, klatschten Beifall, und der junge Dichter an seinem Tisch streckte anerkennend den Daumen der rechten Hand in die Höhe und schickte ein leises Bravo herüber. Sofort danach jedoch, Achim hatte kaum Platz genommen, nahm Walter Ulbricht das Wort. Er straffte sich zwar, blieb aber sitzen und sprach, ohne erst wie bisher mehrere Beiträge im Pack abzuwarten. »Nun aber denken Sie nicht, Genosse Steinhauer, ja, dass Sie mir so schnell davonkommen. Ich habe die Passagen Ihres neuen Romans, soweit sie in der NDL[Anmerkung 129] abgedruckt wurden, gelesen. Und ich habe Ihren Brief erhalten, in dem Sie sich über den Umgang der Hauptverwaltung Verlage mit Ihrem Manuskript beschweren. Sie haben es soeben wiederholt …« Achim spürte, wie es heiß in ihm aufstieg. In solch einem Kreis, mit dem ersten Mann im Staate im Widerwort – das ließ ihn nicht, wie man von derartigen Situationen zu sagen pflegt, kalt. »Ich kenne auch Ihren ›Grimm‹, lieber Genosse Steinhauer, und schon bei ihm habe ich gedacht: Ein solches Buch konnte und musste er wohl schreiben, warum nicht. Vielleicht auch noch ein zweites in dieser Richtung. Bei einem dritten jedoch hätte ich meine Zweifel …« »Aber, Genosse Ulbricht, die ›Schatten des aufgehendes Lichts‹ wären doch erst mein zweites Buch.« Die Versammlung im Saal schien zu erstarren. Man blickte auf ihn, man blickte auf Ulbricht. Es war, als ginge ein Stöhnen um, denn offenbar hatten wohl die meisten von den Schriftstellern und Künstlern seine Entgegnung, die lediglich im Eifer aus ihm herausgeplatzt war, als kühl und anmaßend empfunden, gar als Frechheit. Denn bis zu diesem Nachmittag hatte ja kaum jemand von ihm gewusst, nicht von seiner literarischen Existenz, mochte der eine oder andere vielleicht seine Erzählung »Der Grimm« zur Kenntnis genommen haben, wie sich aber der Autor Achim Steinhauer als Person darstellte, war nur erst wenigen bekannt, Otto Gotsche, Bernhard Seeger über seinen Verlag, Erwin Strittmatter und – Ende. »Ja, ja«, hörte er jetzt Walter Ulbricht sagen, »beruhigen Sie sich, ja? Ich habe bereits mit dem Genossen Gysi vereinbart, nun endlich Nägel mit Köpfen zu machen, das Manuskript Ihres Romans auf Herz und Nieren zu prüfen, und zwar so, dass es nicht beschädigt wird, und ihm die Druckerlaubnis zu erteilen. Einverstanden?« Was sollte er sonst sein! Die Beratung im Staatsrat verfehlte noch lange nicht ihre Wirkung auf Achim Steinhauers Denken und Tun. Er hatte sich bestätigt gefühlt, und so wuchsen in ihm, wie wir glaubten beobachten zu können, neue Kräfte, die sein schöpferisches Handeln beflügelten. Sowohl in der Forschung, beim Durchsuchen der Materie nach ihren Ursprüngen, im Aufspüren der verborgensten DNA-Strukturen, als auch im Entdecken der geheimsten zwischenmenschlichen Beziehungen mit dem Ziel, sie durch Dichtung erkennbar zu machen. Zwanzig Jahre hatte es gebraucht, vom Talgrund am Berge der Universität Leipzig bis auf die Gipfel der Wissenschaft und der Literatur, dass er nun von sich sagen konnte: Was ich gewagt hab mit Sinnen, das hab ich gebracht. In dieser Stimmung, wir erinnern uns, war er über die Autobahn getanzt, schneller, schneller und schneller, und hatte doch wieder Boden unter die Füße bekommen wollen, bei der Mutter, in seinem Elternhaus, in der Ortschaft, aus der er aufgebrochen war, um sich Welt in die Seele zu holen, und stets mit dem Versprechen hinter der Stirn und dem Mut des kleinen, faustgroßen Muskels in der Brust, niemals, nie seine Herkunft zu vergessen.
Hermann Kant: Eine seltsame Begegnung
Hermann Kant, Jahrgang 1926, Elektrikerlehre in Parchim, polnische Kriegsgefangenschaft, Besuch der Antifa-Schule, Rückkehr in die DDR 1949. Abitur an der Arbeiter-und Bauern-Fakultät Greifswald 1952, Germanistitk-Studium an der Humboldt-Universität von 1952 bis 1956. Nach einer Tätigkeit als Chefredakteur einer Studentenzeitschrift freiberuflicher Autor. Zwischen 1974 und 1979 war er Mitglied der SED-Bezirksleitung Berlin, von 1981 bis 1990 Abgeordneter der Volkskammer der DDR, 1986 bis 1989 Mitglied des ZK der SED. Von 1978 bis 1990 Präsident des Schriftstellerverbandes der DDR. Er trat 1992 aus der Akademie der Künste, der er seit 1978 angehörte, und aus dem PEN (seit 1964) aus. Zweifacher Nationalpreisträger der DDR. Anders als Peter Hacks (der vielleicht nur seinen Spaß dabei hatte) konnte ich mit Walter Ulbricht wenig anfangen. Er war einfach da, als ich aus dem Krieg kam. Für das sozialistische Gemüt hatten wir Pieck, für die höhere Rhetorik gab es Grotewohl, und Ulbricht hielt den Apparat in Gang. Für mich war er eine unbehagliche Respektsperson, und als führender Genosse kaum vermeidbar. Zwar hatte einer wie Adenauer einen wie ihn wohl verdient, aber ich sah nicht, warum auch die Verfechter seiner sozialistischen Sache ihn fürchten mussten. Doch darauf läuft es hinaus, wenn ich mein Verhältnis zu ihm benennen soll. Dass es anders gehen konnte zwischen Oben und Unten hatte ich in der Gefangenschaft erfahren. Mein Gott, wie sind unsere polnisch-jüdisch kommunistischen Lehrerinnen und ihr deutscher Partner mit uns umgegangen! Streng, ja, unerbittlich manchmal, aber auf Heilung und nicht auf Zerstörung bedacht. Auf diese Menschen, die Edda Tennenbam und Justyna Sierp und Karl Wloch hießen, folgte ein Vorgesetzter, von dem man wusste, dass er den mächtigsten aller Vorgesetzten hatte. Nein, Wohlsein kam nicht auf, wenn der Erste Sekretär, der Generalsekretär oder Staatsratsvorsitzende gerufen hatte. Selbst dann, wenn ein erfreuliches Ergebnis nicht völlig ausgeschlossen war. In einem Buch, das »Abspann« heißt, habe ich vor mehr als zwanzig Jahren einen Vorgang beschrieben, der es verdient, im gegebenen Zusammenhang noch einmal vorgeführt zu werden: Walter Ulbricht, Staatsratsvorsitzender noch und Generalsekretär der Partei schon nicht mehr, lud zu etwas ein, das einen neuartigen Namen trug und auch sonst nicht dem entsprach, was man an diesem Manne kannte – nach all den wegweisenden Geboten sollte es nun eine Ideenberatung sein. Eine Ideenberatung mit Künstlern. Ein Treffen an der Spitze des Staates, von dem die Spitze der Partei bis eben noch keine Ahnung hatte. Ein unerhörter Vorgang. Entsprechend nervös ging es zu; die Künstlerverbände suchten beim ZK zu erfahren, was sie erwarte; das ZK ging, seltenstes Ereignis, uns um Gutachten an. Wir wussten aber nur: Von uns wurde ein Lagebericht erwartet. Anna Seghers war krank oder nannte es so; ich hatte Vortrag zu halten. Worin die Ideen Ulbrichts, die er dann unter unseren Ohren mit sich selber beriet, bestanden haben, weiß ich nicht mehr. Ich war zu sehr mit dem Vorsatz beschäftigt, meine eigenen Verhältnisse wieder auf die Füße zu stellen. Ich lieferte eine sachliche Schilderung unserer Verbandsarbeit; dabei störte mich nicht, dass es die wenigen Politbüromitglieder, die wie zur Beobachtung anwesend waren, zu stören schien. Es gehe den störrischen Alten, sagten ihre Mienen, nichts mehr an, und gleich darauf wollten mir ihre wütenden Gesichter bedeuten, ich solle von meinem persönlichen Kram die Klappe halten. Aber ich sagte, ich könne nicht gut die Lage im Verband als ordentlich beschreiben, um von der Unordnung im eigenen Schreibbetrieb dann zu schweigen. Ich sei der Autor eines vor Jahren gedruckten, aber nicht veröffentlichten Buches, von dem ich wisse, es könne keinen Schaden stiften. Es werde jedoch behandelt, als stehe das Gegenteil zu vermuten, und mir bereite es wirklich Schaden. Denn ebenso, wie es mir Freunde entfremde, suchten sich mir Fremde in seinem Zeichen zu Freunden zu machen. Am allerwenigsten gefalle mir der Zustand der Sprachlosigkeit, in den die an dem Buch beteiligten Parteien eingetreten seien. Auch die Ideenberatung ging erst einmal in den Zustand der Sprachlosigkeit über. Zusammenkünfte solcher Natur waren gedacht, Erfolge zu benennen und nicht Hindernisse. Schon gar nicht Hindernisse, die der Veranstalter selber errichtet hatte. Er wollte nur zeigen, dass er noch da sei. Und weil die Abgesandten Honeckers an eben diesem Nachweis wenig interessiert waren, gefiel ihnen mein Beitrag zu Ulbrichts Wiederbelebung nicht. Bei so widerstreitenden Ideen schien guter Rat teuer, also flüsterte Otto Gotsche, Sekretär des Staatsrats und Autor dazu, dem Vorsitzenden des Staatsrats etwas ins Ohr, und dieser verkündete eine Pause. Der Vorraum des Versammlungssaales war auch ein Saal, der riesige Teil des riesigen Treppenhauses im Staatsratsgebäude; die Ideenberater verloren sich fast in ihm. An der linken Fensterseite drängten sich Künstlerkollegen im erregten Gespräch, an der rechten Fensterseite standen verknurrte Abgesandte des Politbüros mit ihren Mitarbeitern, in der Tür zwischen Saal und Flur besprach sich Ulbricht mit Gotsche, und von allen weit entfernt in der Ecke am Aufzug hatte ich Aufstellung genommen. Noch einmal das Arrangement der Hager-Runde, mit der die Impressum-Zeit begann: Der Sünder allein, wahrscheinlich stank er; Sympathie erreichte ihn allenfalls per Blick. Ulbricht und Gotsche setzten sich zur Mitte des großen Raumes in Bewegung, verhielten wieder, es wurde still, Ulbricht sagte etwas, Gotsche trat zurück, Ulbricht schlug einen halben Haken und schritt schwerfällig über die Parkettdiagonale in meine Richtung. Mit einem Handzeichen ermunterte er mich, ihm entgegenzukommen, mit einem anderen schien er die Ideenberater von uns fernzuhalten. Er trat ganz nahe an mich heran, besah mein Parteiabzeichen, als habe er ein solches exotisches Ding noch nie gesehen, und sprach zu mir in seinem allbekannten und dennoch unglaublichen Sächsisch: »Jawohl, Herr Kant!« Der Vorsitzende des Staatsrats der Deutschen Demokratischen Republik, von dem ich ein erlösendes oder wenigstens erklärendes Wort in Sachen »Impressum« erwartete, sah mich lange an, als prüfe er, wie weit er sich mir anvertrauen dürfe, und dann fragte er: »Wissen Sie, warum die Freunde mit uns kooperieren?« Womöglich hätte ich unter anderen Umständen Vermutungen äußern können, aber das Thema, warum die Sowjetunion mit der DDR in Kooperationsverbindungen stand, wurde mit keiner Silbe in der Ideenberatung berührt, und ich war wohl auch zu sehr auf meinen Gegenstand fixiert. So sagte ich, nein, das wisse ich nicht. Der Genosse, der nun schon so lange mein führender Genosse auch in Fragen der deutsch-sowjetischen Freundschaft war, rückte mir noch ein Stückchen näher, lächelte listig und sagte sehr sächsisch: »Weil mir was ham, newah? Weil mir was ham!« Es wird mir eingeleuchtet und ich werde genickt haben, und dem Vorsitzenden zeigte mich das wohl als einen Mann, mit dem sich gute Ideen gut beraten ließen, denn im vertraulichen Tone zwischen Vertrauten setzte er leis triumphierend hinzu: »Die, wo nischt ham, mit denen kooperiern se nich!« Weil ich das ohne Schwierigkeiten begriff, machte ich sicher einen lockeren Eindruck und zeigte den fernen Beobachtern so, dass zwischen dem Vorsitzenden und mir gut Wetter herrsche. Dieter Noll war es, der sich, den anderen weit voran, auf den Weg in die freundliche Klimazone machte, und sie alle hörten den Vorsitzenden sagen, was er mir zur Sache Kooperation weiter zu sagen hatte: »Bei der letzten Messe in Leipzig hat man mir die neuesten Entwicklungen vorgeführt, und ich habe gesagt: Alles zudecken! Wissen Sie, warum, Herr Kant? Nun, nichtwahr, es gibt nicht nur feindliche Spione, es gibt auch freundliche, nichtwahr!« Allgemeines Gelächter, allgemeine Fortsetzung der Ideenberatung, ein paar nichtssagende Berichte noch, dann ein Schlusswort des großen Gelehrten, das meines Wissens tatsächlich von all seinen Schlussworten das letzte war. Noch einmal erfuhren wir von führender Rolle, Verantwortung der Kunst, Ingenieuren der menschlichen Seele, Bitterfelder Weg und einer Überlegenheit der Berliner über die New Yorker Müllabfuhr. Von den Geheimnissen der Kooperation zwischen sozialistischen Partnern hörten wir weiter nichts, aber ich bekam meinen Anteil an der Ideenberatung bescheinigt. Der Genosse (nun wieder Genosse) Kant, sagte der Genosse Ulbricht, habe geholfen, ein Hauptkettenglied zu finden, indem er formulierte, er habe mit seinem Buch nicht schaden wollen. Das jedoch, fuhr der Vorsitzende fort, sei nicht die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit sei, dass der sozialistische Künstler mit seiner Kunst nicht nur nicht schaden, sondern vor allem nützen solle. Keine Ahnung, wie die Sache zu Ende ging. Unaufwendig wohl und für den Abend noch folgenlos. Der alte Mann schloss den Staatsrat hinter uns ab, die jungen Männer vom Politbüro warfen sich mit sardonischen Mienen in ihre Tschaikas; ich warf mich entgeistert in die Arme meiner Frau und ließ sie wissen, warum die Freunde mit uns goobberiern; Höpcke schrieb anderntags im Neuen Deutschland einen ganzseitigen Bericht, und die Stelle »Das ist aber nicht die ganze Wahrheit« servierte er wörtlich; der Aufbau Verlag/Rütten & Loening meldete sich gegen Mittag – ob wir uns nicht über den Roman unterhalten wollten. Über Jahrzehnte habe ich vom Vier Augen-Gespräch mit Walter Ulbrich, dem hundert Augenpaare zusahen, erzählt und eine Verwirrung des älteren Herrn immer für möglich gehalten. Aber was – hier eine Idee ganz aus dem Geiste nachgereichten Personenkults –, wenn er wusste, dass er sich nicht festlegen durfte, aber etwas bewegen könnte, wenn er – worüber auch immer – vertraut und freundlich mit mir spräche?
Karl-Heinz Schulmeister: Förderer der Wissenschaften und der Kultur
Karl-Heinz Schulmeister, Jahrgang 1925, Lehrersohn, Abitur, 1946 SED, Kulturbund 1946, Referent in der Landesregierung von Mecklenburg, bis 1952 Landessekretär des Kulturbundes von Mecklenburg und Landtagsabgeordneter. 1955 Bundessekretär des Kulturbundes. Von 1958 bis 1990 Volkskammerabgeordneter, seit 1965 in der Nachfolge Erich Wendts Vorsitzender der Fraktion des Kulturbundes. Fernstudium der Geschichte an der Humboldt Universität, 1974 Promotion, 1982 Professor an der Humboldt Universität, 1981 zum 1. Vizepräsidenten des Kulturbundes gewählt. Seit 1990 Rentner. I. Es war in Halle, wo ich Walter Ulbricht 1957 als mutigen Gesprächspartner der Wissenschaftler erlebte. Halle war der Ort einer der ältesten wissenschaftlichen Akademien, der Leopoldina. Dort wirkten damals einige der führenden bürgerlichen Wissenschaftler, denen es schwerfiel, die neue Staatsmacht zu akzeptieren. Unter der Leitung von Prof. Dr. Mothes bestand ein sogenannter »Spirituskreis«, der sich ablehnend verhielt, was wir damals im Kulturbund nicht wussten. Als Bundessekretär dieser Organisation nahm ich an dieser großen Versammlung teil. Ulbricht ging in die Höhle des Löwen, sprach Klartext, erläuterte die Wissenschaftspolitik des Arbeiter-und Bauern-Staates und warnte vor feindlichen Aktivitäten. Mit welcher Offenheit und Konsequenz, auch Mut, der Arbeiterführer vor der Elite der Intelligenz referierte, das war für mich außerordentlich beeindruckend! Im Bewusstsein der neuen Macht bat er um Vertrauen und Geduld, machte deutlich, dass aus verschiedenen Gründen – auch des Mangels – nicht alle berechtigten Wünsche und Forderungen erfüllt werden könnten. Diese Intelligenzkonferenzen, die der Kulturbund in verschiedenen Ballungsgebieten durchführte, waren erfolgreiche Beispiele für die Einbeziehung großer Teile der humanistischen Kulturschaffenden. Neben Johannes R. Becher war Ulbricht zweifellos der Inspirator dieser Initiativen. Er überraschte viele, weil er als Realpolitiker über die Lage und Stimmung der Intellektuellen bestens informiert war. Auch war man immer wieder erstaunt über seine Allgemeinbildung und seine Fachkenntnisse. So hat er viele überzeugt. und es entstand zwischen führenden wissenschaftlichen Institutionen, den Akademien und Universitäten, und der Regierung ein Vertrauensverhältnis. Auch bestanden zu führenden Wissenschaftlern wie dem Nobelpreisträger Prof. Dr. Gustav Hertz, dem Physiker Prof. Max Volmer, dem Chemiker Prof. Peter Adolf Thiessen, Prof. Manfred von Ardenne, Prof. Baade, Frühauf, Steenbeck, Stubbe u. a. vertrauensvolle und oft persönliche Kontakte. Zwischen Walter Ulbricht und vielen Wissenschaftlern herrschte große Übereinstimmung, was die Entwicklung der Grundlagenforschung und die Förderung bestimmter Forschungsrichtungen anbelangte. Es ging ihnen auch darum, ständig neue Wege zur effektiven Überführung von Forschungsergebnissen in die wirtschaftliche Praxis zu gehen, auch Rückstände auf technischen Gebieten zu überwinden und die neuen großen Herausforderungen der wissenschaftlich-technischen Revolution zu meistern. Walter Ulbricht zeigte auch Bereitschaft für neue Wege und zu Experimenten. Er war ein mutiger Organisator und Förderer der Wissenschaften und Technik. Die Ära Ulbrichts war eine Zeit des Anstiegs des wissenschaftlichen Potenzials. Die Geschichte der Akademie der Wissenschaften und des Forschungsrates der DDR geben darüber zur Genüge Auskunft! Eine der Stärken der Persönlichkeit Walter Ulbrichts lag sicherlich in diesen Bereichen, davon berichten nicht wenige Wissenschaftler in ihren Erinnerungen. II. Die Repräsentanten der Arbeiterbewegung Wilhelm Pieck, Otto Grotewohl und Walter Ulbricht haben die Entwicklung der Kultur und der Künste sehr gefördert. Wie kein anderer Politiker fühlte sich Ulbricht für diese Aufgaben mit aller Konsequenz berufen. Dieser Prozess begann mit den Kulturverordnungen der Deutschen Wirtschaftskommission und führte dazu, dass kulturelle Einrichtungen nach dem Krieg wieder im alten Glanz neu aufgebaut wurden. Für viele Künstler wurden auch Wohnungen und kleine Wohnhäuser geschaffen und das materielle Leben durch Verlage und künstlerische Institutionen gesichert. Viele Rückkehrer aus der Emigration, die namhaftesten antifaschistischen Künstler und Schriftsteller, siedelten sich in Ostdeutschland und der DDR an. Ein Aufstieg ohnegleichen, eine Renaissance der humanistischen Kultur begann im Osten, dagegen verblasste der Westen, wie es viele Historiker eingestehen mussten. Die bekannten DEFA-Filme, das Brecht-Ensemble, das Felsenstein-Theater, die Opernhäuser in Berlin, Leipzig, Dresden, die Akademie der Künste, die vielen Kulturhäuser, auch auf dem Lande, die Volksbibliotheken, die vielen Volkskunstensembles, die Arbeiterfestspiele, die großen Kunstausstellungen in Dresden, das Wirken der Gewerkschaften, des Kulturbundes und der Volksbühne, die reiche Buchproduktion und Verlagsentwicklung und vieles mehr zeugen davon, dass die Kultur hier zu Hause war. Walter Ulbricht wollte aber noch mehr: Eine neue Kunst sollte entstehen, die Kultur sollte vergleichsweise Lebensmittelpunkt bzw. Teil des Lebens werden! Wo Arbeitsstätten mit neuen Betrieben oder Neubaugebiete entstanden, sollte auch die Kultur eine Heimstatt finden. Arbeiter und Bauern sollten endlich Zugang zur Kultur finden. Kultur und Bildung für alle Bürger war die Aufgabe des Staates, so schrieb es auch die Verfassung vor. Diese Entwicklung ging Ulbricht wohl nicht schnell genug, und die Künste waren darauf auch noch nicht genügend vorbereitet. Deshalb ergriff Ulbricht die Initiative zu den Bitterfelder Kultur Konferenzen, die einen Prozess einer demokratischen Reform, eine wirkliche Kulturrevolution einläuteten. Dabei kam es auch zu Überspitzungen und Irrtümern, aber am Ende gab es beachtliche Erfolge, und das kulturelle Leben entwickelte sich unermüdlich! Viele Bürger entdeckten für sich die bildende Kunst, andere das Lesen, die Theater oder die Laienkunst. So entstand Lust auf Kultur und die Künste! Die Festspiele in den Betrieben, die Dorffestspiele, die Tage der Kultur in Stadt und Land brachten viele Talente hervor. Heute scheint mir diese Entwicklung wie ein Traum von einer anderen, besseren Welt, die wir in der DDR zum Teil geschaffen hatten. Heute wird alles immer privatisiert, und Geld bestimmt letzten Endes über die Kultur. So bleiben immer mehr Werte und humanistische Ideale auf der Strecke. Damals vor fünfzig Jahren folgten viele Künstler dem Ruf der Partei. Sie erkundeten das Leben, suchten den neuen Menschen und fanden viele sozialistische Helden, großartige Menschen. Aber dabei entdeckten sie gemäß unseren Lehren – unendlich viele Widersprüche, die das sozialistische Leben in seinen Äußerungen zeigte. So entstand ein großer Reichtum an neuer Kunst, an Bildern und Kompositionen, an Büchern und Filmen, an Fernsehspielen und Theaterinszenierungen usw. Darunter sind nicht wenige, die heute noch die Menschen bewegen. Damals herrschte zwischen Ost und West, zwischen zwei verschiedenen Weltsystemen, ein erbitterter Klassenkampf. So kam es zur 11. Tagung des ZK der SED, wo leider Filme wie »Spur der Steine« oder »Das Kaninchen bin ich« u. a. verboten wurden. Ein Teil der Filmemacher wollte die Widersprüche überwinden helfen, wollte für den Sozialismus das Beste, aber hier nun wurden Fehler begangen, die dem Ansehen der Partei und des Staates schadeten und Folgen nach sich zogen, die dem Sozialismus nicht gemäß waren. Nicht wenige Künstler wurden enttäuscht, gerieten in Schwierigkeiten, und einige gingen fort. Leider brachten Walter Ulbricht und das Politbüro nicht die notwendige Geduld und Toleranz auf. Auch das Ansehen von Ulbricht wurde beschädigt. Trotzdem bleibt es eine Tatsache, dass er ein großer Förderer der Kultur war, denn in seiner Zeit entstand die reiche Kulturlandschaft der DDR, um die uns viele in der Welt beneideten. III. Pflegte Walter Ulbricht freundschaftliche Beziehungen zu Künstlern? Sicherlich! Er hatte viele Kontakte zu antifaschistischen Kulturschaffenden, das ergab sich aus dem gemeinsamen Kampf gegen Faschismus und Krieg. Feststeht auch, dass er zu den Intellektuellen seiner Generation, z. B. zu Johannes R. Becher und Willi Bredel, Friedrich Wolf und Erich Weinert, beste Verbindungen hatte. Es ist nur zu natürlich, dass Freundschaften vor allem durch gemeinsame Erlebnisse und Kämpfe entstanden. Eine wichtige Freundschaft verband Walter Ulbricht mit Johannes R. Becher. Diese dauerte über drei Jahrzehnte und begann 1933 in der Emigration in Moskau. Als der Präsident des Kulturbundes, Max Burghardt, 1961 Walter Ulbricht die Johannes-R.-Becher Medaille überreichte und wir ungezwungen in kleinem Kreis zusammensaßen, plauderte Ulbricht über diese enge Verbundenheit. Er hob hervor, dass es sehr fruchtbare und schöpferische Beziehungen waren, dass sie oft sehr ergiebige Debatten geführt und voneinander außerordentlich wichtige Erkenntnisse gewonnen hätten. Der Dichter hätte vom Politiker und umgekehrt der Politiker viel vom Dichter gelernt. Ulbricht erzählte uns, dass Becher – wie viele andere Künstler auch – ein sehr sensibler und empfindsamer Mensch gewesen sei, der oft bei ihm Rat gesucht hätte. Andererseits habe sich der Schriftsteller und Kulturpolitiker außerordentlich intensiv mit der deutschen geistesgeschichtlichen Entwicklung beschäftigt, um daraus Lehren für den Neuaufbau eines anderen, humanistischen Deutschlands zu ziehen. Viele Schriften des Autors – seine Deutschland-Dichtung, seine »Deutsche Lehre« – aus den 30er und 40er Jahren würden u. a. dies bezeugen. Johannes R. Becher habe ihm – seinem Freund Walter – die bedeutende Rolle der deutschen Klassik vor Augen geführt. Auch müssten Fragen der Bildung und der Kultur im zukünftigen Deutschland eine besondere strategische Rolle spielen. Bei der Ausarbeitung entsprechender Programme für eine demokratische Erneuerung des deutschen Vaterlandes hätte es nur Übereinstimmung und Gemeinsamkeiten gegeben. Nach der Befreiung vom Faschismus im Mai 1945 sei Johannes R. Becher der mutige Voranschreiter gewesen, der viele Wissenschaftler und Künstler des Bürgertums beeinflusst hat. Sein Wirken sei für uns, für die Arbeiterbewegung ein großes Glück gewesen. In den 50er Jahren erwarb sich Becher ebenfalls große Verdienste. Auch der Aufbau des Ministeriums für Kultur der DDR – mit vorwiegend besten Fachleuten aus allen künstlerischen Bereichen – ist vorwiegend das Werk Johannes R. Bechers gewesen. Ulbricht legte Wert auf die Feststellung, dass er dem Dichter jede erdenkliche Hilfe und Unterstützung erwiesen hat. Es ist auch bekannt, dass Ulbricht dem 1934 in Paris tätigen Willi Bredel Unterstützung gewährte, als dieser dort einen Verlag gründen wollte, um der antifaschistischen Literatur eine Heimstadt zu geben. Walter Ulbricht hat dort in Paris im Interesse der Volksfrontpolitik auch die Zusammenarbeit mit Heinrich Mann und anderen Antifaschisten der literarischen Elite Europas angestrebt. Leider sind viele Fakten darüber nicht genügend erforscht worden, wie Ulbricht früher als Förderer der Kultur in Erscheinung getreten ist. Solche Fakten sind aber wichtig, um die Fälschungen und Einseitigkeiten der Darstellung Ulbrichts in der vor allem westdeutschen Historiografie zu ntlarven. IV. Es gibt persönliche Erinnerungen an Walter Ulbricht, die ich bis heute nicht vergessen habe, die mich seinerzeit beschäftigt und ermutigt haben. Das waren die Beratungen, die Ulbricht mit uns – den Vorständen der Ausschüsse der Volkskammer der DDR – in Berlin im Staatsrat und in Dölln durchführte, und wo er uns aufforderte, entscheidende Schritte zur Entwicklung der sozialistischen Demokratie zu tun. Wir sollten die Minister mehr kontrollieren und befragen und Vorschläge für die Planung der staatlichen Organe machen. In der Tat gab es im Ausschuss für Kultur mit den Ministern offene Debatten, kritische Bewertungen, durch unsere Meinungsbildung wurde schließlich auch die Sacharbeit des Ministeriums beeinflusst und verbessert. Gleich ob es sich um die Ausbildung des künstlerischen Nachwuchses, die Denkmalpflege oder die städtebauliche Gestaltung handelte. Unter den Abgeordneten der Fraktionen gab es genügend ausgewiesene Fachleute. Für uns war es gut zu wissen, dass Ulbricht diesen Prozess der Demokratisierung förderte. Ähnliche Hoffnungen erweckten bei vielen Kulturschaffenden die Sitzungen des Staatsrates zu Grundfragen der Entwicklung der Kultur der DDR. Ulbricht leitete diese Beratungen, die den Charakter eines lebhaften Dialogs hatten, persönlich. Er nahm sich Zeit, hörte die Analysen der Fachbereiche und stellte Fragen. In den Gesprächen mit den Leitern kultureller Einrichtungen und den Repräsentanten der Künstlerverbände wurden brennende Probleme erörtert und nach Antworten gesucht. Im Gegensatz zum rüden Ton auf der 11. Tagung des ZK der SED herrschte eine kameradschaftliche, ja freundschaftliche Atmosphäre. Diese Art der Einbeziehung vieler Künstler und die Suche nach gemeinsamen Lösungen, diese Mitbestimmung trug wesentlich zur Vertrauensbildung bei. Dazu nur folgendes Beispiel: Am 30. November 1967 beschäftigte sich der Staatsrat mit Kulturfragen. Der Minister für Kultur, Klaus Gysi, gab einen Bericht über die Tätigkeit des Ministeriums und machte programmatische Vorschläge für die einzelnen Künste. Er hob z. B. hervor, dass die DDR ein Land hoher Musikkultur und des kompositorischen Schaffens sei und sich in der ganzen Welt nicht zu verstecken brauche. In der Debatte, die Ulbricht leitete, sprachen die Komponisten Ernst Hermann Meyer und Jean Kurt Forest. Sie dankten Klaus Gysi für die kritischen Bemerkungen und sprachen die Hoffnung aus, dass der Minister öfter Konzerte mit neuen Werken besuchen werde. Meyer erinnerte, dass gegenwärtig etwa achtzig Musikschulen und sechs spezielle Kindermusikschulen bestünden, und sprach die Hoffnung aus, dass sich in den nächsten Jahren die Zahlen verdoppeln könnten. Forest kritisierte, dass Werke der DDR Komponisten wenig gefördert würden, dass die Sendezeit im Rundfunk rückläufig wäre, und das Gleiche sei auch in den Konzertsälen der Fall. Er bat um entsprechende Hilfe. Ulbricht reagierte sofort und schlug vor, »dass wir das nicht dem Ministerium allein überlassen, sondern dass sich der Volkskammerausschuss für Kultur mit der Rede des Genossen Forest beschäftigt und die Tatsachen nachprüft. Er sollte sich auch für die Arbeit der Musikabteilung im Fernsehfunk und Rundfunk interessieren und Schlussfolgerungen ziehen. Außerdem muss er sich selbstverständlich damit beschäftigen: Wie sieht die Ausbildung an den Musikinstituten aus? Entspricht diese Ausbildung den Beschlüssen, oder was ist los? Der Volkskammerausschuss soll sich das gründlich ansehen und dann seine Empfehlungen an den Minister geben.« Unser Ausschuss bildete sofort einige Arbeitsgruppen, die diese Problematik an Meisterhochschulen, Theatern und Fernseheinrichtungen untersuchten. Als Vorsitzender des Ausschusses für Kultur sprach ich über unsere Prüfungsergebnisse. Dies geschah wirklich, schon nach zehn Monaten. Am 18. Oktober 1968 fand die 13. Staatsratssitzung über Entwicklungsprobleme des geistig kulturellen Lebens statt. Diesmal waren noch mehr Kulturschaffende eingeladen. Wieder hielt der Minister Klaus Gysi die Grundsatzrede. Es kamen mehr Kulturschaffende zu Wort, um ihre Probleme und Fragen darzulegen. Ausführlich wurde das Musikschaffen erörtert und die Ergebnisse unterbreitet, die unser Ausschuss für Kultur von seinen Untersuchungen an Musik- und Hochschulen, Konzerthäusern und Theatern, in Gesprächen mit Dirigenten, Konzertmeistern und Komponisten vorgelegt hatte. Es war erneut eine fruchtbare Arbeitssitzung, die viele schöpferische Kräfte zusammenführte, die das Verständnis für neuartige und wachsende Aufgaben vertiefte und viele Künstler zu neuen Taten motivierte. Walter Ulbricht hatte damals von einer Zwischenbilanz gesprochen, er wollte sicherlich solche Beratungen weiterführen, und dies wäre meiner Meinung nach der Sache dienlich gewesen. Es kam aber nicht mehr dazu, weil Walter Ulbricht allmählich ausgeschaltet wurde. Diese Beratungen zeigten die Arbeitsweise von Walter Ulbricht, sie demonstrierte, wie operativ, gründlich und schnell die Lage analysiert und verbessert wurde. Es wurde nicht diktatorisch angeordnet, sondern mit den Beteiligten die beste Lösung gesucht und gefunden. So möchte ich bei dieser Gelegenheit feststellen, dass Ulbricht in schwierigen revolutionären Zeiten – des Kalten Krieges – ein bedeutender Staatsmann war. Wo gab es jemals in Deutschland einen Staatsmann, der sich Zeit für die Kulturentwicklung nahm, direkte Verbindungen zu den Kunstschaffenden und den werktätigen Menschen suchte und in dieser Weise über Jahrzehnte als Förderer der Kultur und der Künste wirkte.
Günter Benser: Für Ulbricht war die Geschichte eine bewegende Kraft
Günter Benser, Jahrgang 1931, geboren und aufgewachsen im sächsischen Heidenau und Lehre als Industriekaufmann. Nach Besuch der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät Studium der Geschichte an der Karl-Marx Universität. Danach tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Marxismus-Leninismus (IML) beim ZK der SED, Mitglied des Rates für Geschichtswissenschaft und des Nationalkomitees der Historiker der DDR. Bei der Umbildung des IML zum Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung (IfGA) im Jahre 1989 wurde er zu dessen Direktor gewählt. Die Einrichtung wurde 1992 aufgelöst. Günter Benser ist Nationalpreisträger der DDR. Wir schrieben den 2. Februar 1968. An jenem Tage war ich zu Walter Ulbricht bestellt, um einen Auftrag entgegenzunehmen. Normalerweise wurden uns Instituts-Mitarbeitern Aufgaben, die für Mitglieder der Parteiführung zu erledigen waren, von deren persönlichen Referenten übermittelt. Diesmal aber trat der oberste Chef persönlich in Erscheinung. Es musste ihm also sehr wichtig sein. Ich kannte Walter Ulbricht nicht nur aus den Medien, sondern hatte ihn wiederholt auf Kundgebungen und Konferenzen, auf Tagungen und Beratungen selbst erlebt. Vor allem war er mir als Vorsitzender des Autorenkollektivs der achtbändigen Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung – wovon noch die Rede sein wird – unmittelbar begegnet. Diesmal aber ging es um ein Gespräch unter vier Augen. Ich begab mich zum »Großen Haus«, dem Sitz des Zentralkomitees, und brauchte nicht lange zu warten. Was mir als Erstes auffiel – er sprach mich nicht mit dem in der Partei üblichen genossenschaftlichen »Du«, sondern mit »Sie« an. Da er als Staatsratsvorsitzender mit unterschiedlichen Personen im Gespräch war, wollte er sich wahrscheinlich nicht immer der Mühe des Differenzierens unterziehen, oder er hatte seine Gründe, Distanz zu wahren. Ulbricht kam gleich zur Sache. Er sah sich durch die vorliegenden Bände der Memoiren Konrad Adenauers[74] herausgefordert und trug sich mit dem Gedanken, diesen seine eigene Sicht auf die deutsche Nachkriegsgeschichte entgegenzustellen. Da ich noch über die Notizen verfüge, die ich während dieses Gesprächs angefertigt habe, lassen sich seine Vorgaben annähernd exakt rekonstruieren.[75] Im Unterschied zu seinem Nachfolger Erich Honecker, der sich seine Autobiografie »Aus meinem Leben«[76] von Historikern und Journalisten weitgehend vorformulieren ließ, betonte Ulbricht, dass ihn nicht die Ansichten von uns Historikern interessierten, sondern dass er eine Zusammenstellung authentischer Quellen benötige. Er nannte selbst eine ganze Reihe entsprechender Komplexe. So notierte ich mir zum Beispiel (hier in allgemeinverständliche Begriffe übertragen und chronologisch geordnet) Konferenz von Jalta und die Position Stalins zur deutschen Einheit, Vereinbarung über den Alliierten Kontrollrat und dessen Sitz in Berlin, Berlin-Status, Potsdamer Konferenz, Rede des britischen Expremiers Churchill in Fulton und Rede des Staatssekretärs der USA Byrnes in Stuttgart, Moskauer Außenministerkonferenz, Stufen der deutschen Teilung, Währungsspaltung, Remilitarisierung der BRD, Enthüllung der Geheimpläne, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Es fiel nicht nur der Name Adenauer, sondern auch der Kurt Schumachers und Ernst Lemmers, dessen Lebenserinnerungen Ulbricht offenbar ebenfalls gelesen hatte. Da ich die vorliegenden Bände der Adenauer Memoiren kannte und für unsere Geschichtszeitschrift besprochen hatte, bereitete es mir keine Mühe, Ulbrichts Anliegen zu erfassen. Eine dreiköpfige Gruppe von Wissenschaftlern sollte diese Arbeit unter meiner Leitung übernehmen und sich dafür von anderen Aufgaben freistellen lassen. Letzteres war eine Illusion, aber mit solchen Details wurde ein Parteichef und Staatsoberhaupt nicht belästigt. Es galt also, den Kreis der Mitarbeitenden zu vergrößern. Hauptbeteiligte waren Rolf Badstübner und Heinz Heitzer vom Zentralinstitut für Geschichte an der Akademie der Wissenschaften der DDR sowie Wilhelm Ersil von der Akademie für Staat und Recht in Potsdam-Babelsberg. Wie eng der Bezug zu Adenauers Memoiren war, bezeugt die Tatsache, dass wir Exemplare dieser Bände ausgehändigt erhielten, deren Struktur und Schwerpunkte analysierten und diese durch jene wichtigen Prozesse und Ereignisse ergänzten, die den Bundeskanzler nicht interessiert hatten oder die er bewusst ausgeklammert hatte. Aus all dem leiteten wir jene Komplexe ab, zu denen wir für Walter Ulbricht Dokumente zusammentragen wollten. Zwar standen uns überwiegend nur publizierte Materialien zur Verfügung, dennoch entstand eine aussagekräftige Sammlung authentischer Zeugnisse der entscheidenden politischen Kräfte der Alliierten und der Deutschen in West und Ost – Verträge, Positionspapiere, Erklärungen, Aufrufe, Presseberichte und -kommentare wie auch Auszüge aus Autobiografien und Erinnerungen. Hatten wir zunächst mit einer Dokumentation von zirka 2.000 Seiten gerechnet, so lagen im Oktober 1969 etwa 7.000 Seiten, 42 Komplexen zugeordnet, vor,[77] an deren Zustandekommen weitere wissenschaftliche und wissenschaftlich technische Kräfte sowie Übersetzer mitgewirkt hatten. Schließlich musste damals fast alles noch mit Maschine abgeschrieben und kollationiert werden. Ich kann mich nicht entsinnen, dass wir von Walter Ulbricht selbst ein Echo auf unsere umfangreiche Arbeit erhalten hätten. Dafür meldeten sich seine dienstbaren Geister und sammelten die uns überlassenen Bände der Adenauer Memoiren wieder ein. Offenbar kam Ulbricht angesichts anderer Verpflichtungen zunächst nicht dazu, sich eingehend mit seinem geplanten »Anti Adenauer« zu beschäftigen. Und nach seiner – in der Vorgehensweise miesen und feigen – Ablösung wandte sich Ulbricht zwar historischen Fragen zu. Aber er vertiefte sich derart in die Frühzeit seines politischen Wirkens, vor allem in die Jahre vor, während und nach der Novemberrevolution, dass ihm keine Zeit mehr verblieb, das zu tun, was von größerem Wert gewesen wäre: seine Sicht auf die Auseinandersetzungen der Nachkriegszeit und der Jahre des Kalten Krieges darzulegen und seine eigene Rolle zu bewerten. Überraschend kam Ulbrichts Memoirenprojekt eigentlich nicht. Denn Geschichte nahm in seinem strategischen Denken und in der Begründung seiner politischen Ziele seit langem einen zentralen Platz ein. So bringt uns das hier geschilderte eigene Erleben zu der Frage, wie es generell um Walter Ulbrichts Verhältnis zu Geschichte und zu Geschichtsschreibung bestellt war. Er selbst hat ja gelegentlich Historiker als seinen »dritten Beruf« bezeichnet. Das ist von seinen Gegnern mit Spott registriert worden, der aber unangebracht war. Im Gegensatz zu den uns heute regierenden Pragmatikern, für die Deutschland – trotz patriotischer Aufrüstung und zunehmender politischer wie militärischer Expansion – in erster Linie ein Wirtschaftsstandort ist und bleibt, sah Ulbricht in Geschichte eine bewegende Kraft. Er war überzeugt, dass sich politische Kräfteverhältnisse verändern ließen, wenn es gelänge, den Menschen die in die Gegenwart hineinragenden historischen Entscheidungen wie auch Fehlentscheidungen samt deren Ursachen und Zusammenhängen entsprechend zu erklären. Deshalb haben die meisten seiner wegweisenden Reden und Schriften eine historische Dimension, wenn sie nicht von vorherein historischen Themen gewidmet sind. Nicht ohne Grund hatte Ulbricht die vielbändige (nach seiner Ablösung vermutlich auf Weisung Honeckers abgebrochene) Ausgabe seiner gesammelten Reden und Schriften unter dem Titel »Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung« veröffentlichen lassen. Das war gewiss etwas anmaßend, aber viel Historisches und auch historisch Bedeutsames enthalten diese Bücher durchaus. Vor allem seit den Jahren seines Exils in der UdSSR hat sich Walter Ulbricht explizit historischen Themen gewidmet. Und das betrifft nicht nur die von Politikern unterschiedlicher Couleur üblichen Gedenkartikel und -reden zu historischen Jahrestagen, zu Geburts oder Sterbedaten bedeutender Persönlichkeiten. Solche Rückblicke und Würdigungen liegen von Ulbricht auch in beträchtlicher Zahl vor. Sie reichen von der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 bis zur Gründung der SED und der DDR, von Friedrich Schiller bis Wilhelm Pieck. Nein, gemeint sind hier ernstzunehmende Auseinandersetzungen mit tiefgreifenden und weitreichenden historischen Prozessen und Entscheidungssituationen. Nicht zufällig steht am Anfang eine Problematik, die ihn Zeit seines Lebens beschäftigt hat die deutsche Novemberrevolution und deren Bezüge zur Oktoberrevolution in Russland.[78] Hier handelte es sich nicht nur um das gesamte zurückliegende Jahrhundert prägende Geschehnisse, sondern zugleich um das bleibende Grunderlebnis seiner Generation. Waren seine ersten Betrachtungen stark an dem unter Stalins Regie 1938 erschienenen Kurzen Lehrgang der Geschichte der KPdSU[79] orientiert, so hat sich später sein Horizont erheblich erweitert. Aus Ulbrichts Feder stammen historisch-politische Analysen des Hitlerfaschismus, die nach dessen Zerschlagung unter dem Titel »Die Legende vom deutschen Sozialismus«[80] erschienen sind und eine nachhaltige Rolle bei der Überwindung des Führerglaubens und der faschistischen Ideologie in den Köpfen vieler Zeitgenossen insbesondere meiner Generation spielten. Ulbricht war auch der Erste, der 1955, also mit dem Abstand eines Jahrzehnts, ein materialreiches und mit Dokumenten angereichertes Buch über den Entwicklungsweg von der Kriegswende im Zweiten Weltkrieg bis zur Gründung der SED vorlegte. Es stützte sich auf Zuarbeiten von Hans Schaul und Hans Vieillard und auf Hinweise anderer Mitstreiter. Das Gedenken an Karl Marx bot ihm Gelegenheit, die eigenen strategischen Erwägungen und Zielsetzungen mit Berufungen auf den Begründer des wissenschaftlichen Sozialismus zu untermauern. So verkündete er im Karl Marx-Jahr 1953 sein Verständnis von der Rolle der sozialistischen Staatsmacht, demzufolge in der DDR die Funktionen der Diktatur des Proletariats ausgeübt wurden. In seinem Nachlass finden sich hierzu achtzehn maschinenschriftliche, eng beschriebene Seiten mit Auszügen aus Werken von Marx, Engels und Lenin zu dieser Thematik, die er mit zahlreichen Anstreichungen versehen hat.[81] Fünfzehn Jahre später begründete er auf einer internationalen wissenschaftlichen Session mit Berufung auf Karl Marx seine keineswegs unumstrittene Auffassung vom Sozialismus als einer relativ selbständigen Gesellschaftsformation, womit sich die DDR von dem in der UdSSR und in anderen Ländern proklamierten unmittelbaren Übergang zum Kommunismus abgrenzte. Schwerpunkthema wurden verständlicherweise für Ulbricht die deutsche Nachkriegsgeschichte und die Auseinandersetzungen zwischen den beiden Wegen zur Lösung der deutschen Frage. Es entsprach Ulbrichts tiefster Überzeugung, dass die deutsche Geschichte vom Kampf zweier Klassenlinien durchzogen ist und die deutsche Nation im Zeitalter des Imperialismus in einen verhängnisvollen Kreislauf gestürzt wurde, charakterisiert durch »Krise – zeitweiliger konjunktureller Aufschwung – Krise Krieg«, der schließlich in den verheerenden Zweiten Weltkrieg einmündete.[82] Ein Kreislauf, der durch die vereinte (kommunistisch geführte) Arbeiterbewegung und deren Verbündete durchbrochen werden müsse. Insofern hatte für ihn die offene deutsche Frage einen tiefen sozialen Gehalt und die soziale Frage eine weitreichende nationale Dimension. Diese Sicht auf den Werdegang der gespaltenen, aber wieder zu vereinigenden deutschen Nation hatte er ausführlich 1959 im Umfeld des zehnten Jahrestages der DDR in seiner Schrift »Des deutschen Volkes Weg und Ziel« vorgetragen. Sie wurde im 1962 veröffentlichten sogenannten »Nationalen Dokument«[83] weiterentwickelt. Unter der Kurzformel »nationale Grundkonzeption« fand sie weite Verbreitung. Ihre Kerngedanken wurden zur verbindlichen Orientierung für die Historiker der DDR – nicht zuletzt bei ihren Arbeiten an einem Grundriss der deutschen Geschichte und an der 1989 erzwungenermaßen abgebrochenen zwölfbändigen »Deutschen Geschichte«. Ein differenzierter Umgang mit Erbe und Tradition war in der DDR allerdings erst nach der Ära Ulbricht möglich. Die zuvor waltende Enge, die wesentlich auf sowjetische Einflüsse zurückging, für die aber auch Ulbricht Verantwortung trug, führte selbst zur Ausgrenzung der künstlerischen Moderne, die doch der kommunistischen Bewegung nahegestanden hatte. Und der rücksichtslose Umgang mit dem deutschen Architekturerbe – das Schleifen der sanierungsfähigen Stadtschlösser in Berlin und Potsdam wie auch der Leipziger Universitätskirche – wird ihm auf Dauer angelastet werden. Angesichts der herausragenden Rolle, welche die Novemberrevolution im Geschichtsdenken Ulbrichts einnahm, ist es kein Zufall, dass deren 40. Jahrestag zum Auslöser jener Aktivitäten wurde, die schließlich in die Veröffentlichung einer achtbändigen Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung einmündeten, die zweifellos den Höhepunkt der SED Geschichtsschreibung darstellte. Mit der Erarbeitung einer Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung war das damalige Marx-Engels-Lenin-Institut schon seit der ersten Hälfte der 50er Jahre befasst, allerdings ohne damit zügig voranzukommen. Zu lange hielten sich die Beteiligten bei – teils sophistischen – Debatten um die Periodisierung auf. Eine echte Auseinandersetzung mit konträren Positionen entspann sich um den Charakter der Novemberrevolution, mit der auch ertragreiche empirische Forschungen angeregt wurden. Die Sache endete mit dem ultimativen Schiedsspruch Ulbrichts, für den die Novemberrevolution »eine bürgerlich demokratische Revolution« war, »die in gewissem Umfang mit proletarischen Mitteln und Methoden durchgeführt wurde. Ihre Hauptaufgabe – der Sturz des deutschen Imperialismus – blieb ungelöst.«[84] Hier offenbarte sich die Zwiespältigkeit des »dritten Berufes« des Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED in ihrer vollen Schärfe. Denn es wurde nicht nur von oben ein Standpunkt durchgesetzt, für den ja manches sprach. Nun hatten sich die Verfechter der Gegenposition, die vor allem die proletarischen und sozialistischen Züge dieser Erhebung betonten, wenngleich deren Vorkämpfer unterlagen, wegen revisionistischer Abweichungen zu verantworten. Die Crux blieb, dass ein an herausragender Stelle historisch wirkender Mensch zugleich als Darsteller und Interpret historischen Geschehens auftrat, und dies mit der hohen Autorität und dem Durchsetzungsvermögens des Führers einer marxistisch-leninistischen Partei. Die Tatsache, dass der Umgang mit Geschichte immer und überall interessengeleitet erfolgt, musste hier mit besonderer Wucht durchschlagen. Bleibt dennoch die Frage: Was ist die autoritative Festschreibung des Charakters der damals massiv ins öffentliche Bewusstsein gerufenen Novemberrevolution gegen das Verdrängen dieser Revolution aus dem kollektiven Gedächtnis der Deutschen, mit dem wir es heute zu tun haben? Denn im Unterschied zu unseren französischen Nachbarn negiert die Obrigkeit der BRD den revolutionären Ursprung der deutschen Republik, was wir alljährlich am 9. November vorgeführt bekommen. Und es käme ihr nicht in den Sinn, sich über den Charakter dieser Revolution zu ereifern. Wo gab oder gibt es das sonst noch, dass ein Parteitag, der ein neues Programm verabschiedet, zugleich den Entwurf eines Grundrisses der Geschichte der eigenen Bewegung zur Beratung vorgelegt bekommt, wie das auf dem VI. Parteitag der SED im Januar 1963 geschah?[85] Vor dem Zentralkomitee der SED – Historiker waren als Gäste mit Rederecht hinzugeladen – erklärte Ulbricht im Juni 1962, dass diese konzentrierte Skizzierung der wichtigsten Ereignisse der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung und deren Bewertung durch die SED vor der Arbeiterklasse und der gesamten Bevölkerung zur Diskussion gestellt werden sollte.[86] Und in seinem Schlusswort betonte er, dass die Diskussion in der DDR begonnen, aber rasch nach Westdeutschland getragen werden müsse.[86] Dieses auffällige und aufwendige Befassen der SED und Ulbrichts persönlich mit Geschichte gewann noch an Bedeutung, da sich zu jener Zeit die SPD im Gedenken an den 1863 gegründeten Lassalleschen Allgemeinen Deutschen Arbeiterverein auf ihr 100 jähriges Parteijubiläum vorbereitete. Am Rande sei vermerkt, dass unsere und die sozialdemokratische Geschichtserzählung bei allen Gegensätzen auch ihre Gemeinsamkeiten hatten – sie waren beide auf den Entwicklungsweg politischer Organisationen und deren Verhältnis zur Macht fokussiert. Hingegen blieben in beiden die elementare Bewegung der Arbeitenden, ihre Lebensverhältnisse und ihre Selbstentfaltung unterbelichtet. Strömungen wie die anarchistische oder syndikalistische und die christdemokratische Arbeiterbewegung blieben weitgehend ausgeblendet. Nach Verabschiedung des Grundrisses der Geschichte der Arbeiterbewegung begann sofort die Erarbeitung einer zunächst auf drei Bände angelegten Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, mit der das vorliegende Gerüst zu einem anschaulichen Gebäude erweitert werden sollte. Diese Aufgabe wurde auf breiter Front in Angriff genommen. Unterstützt von zahlreichen Experten und Helfern verfassten zwanzig Historiker die Entwürfe dieses Geschichtswerkes, wobei sie auch jene Bereiche zu überbrücken hatten, für die der Forschungsvorlauf dürftig war oder ganz fehlte. Die so entstandenen Manuskripte wurden einem von Walter Ulbricht geleiteten Autorenkollektiv, das eigentlich eine Redaktionskommission war, vorgelegt und eingehend diskutiert. Als Teilnehmer dieser Beratungen kann ich bestätigen, dass Ulbricht Zeile für Zeile gelesen, dass er ein reiches Tatsachenwissen parat hatte und daran interessiert war, dass wichtige Wertungen kollektiv erörtert wurden. Das waren allerdings Diskussionen, bei denen es wesentlich um das Wie der Darstellung oder um deren Anreicherung ging, während für die Interpretationen mit dem zum Beschluss erhobenen Grundriss bereits feste Pflöcke eingeschlagen waren. Und es kamen auch keine Zweifel auf, wer bei abweichenden Meinungen das letzte Wort haben würde. Pünktlich zum 20. Jahrestag der SED Gründung lag eine achtbändige Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung vor, die ohne Ulbrichts direkte Einflussnahme nie und gleich gar nicht in diesem Tempo zustande gekommen wäre. Sie stellt eine Leistung aller beteiligten Gesellschaftswissenschaftler, der Lektoren des Dietz Verlages und der polygrafischen Industrie der DDR dar, die auch die Beobachter in der Bundesrepublik und spätere Analytiker der DDR-Historiografie nicht unbeeindruckt ließ. Dass dieser Kraftakt auf Kosten anderen Buchprojekte und Autoren erfolgte, die auch in die Öffentlichkeit drängten, sei nicht verschwiegen. In den ursprünglich geplanten drei Bänden ließen sich die Ausarbeitungen nicht unterbringen. Vier oder fünf Bände ergaben keine überzeugende Gliederung. Also fiel die Entscheidung für eine Auffächerung in acht Bände. Das hatte den Vorzug, dass nun in jedem Band Raum für einen umfangreichen Anhang entstand, in dem zeitgenössische Dokumente Aufnahme fanden, und zwar auch Dokumente der »Gegenseite«, der Behörden des deutschen Staates, Zeugnisse der Sieger- und Besatzungsmächte, von Gremien der Wirtschaft und von Organen der deutscher Parteien, vor allem der reformistischen Sozialdemokratie. Der »Grundriss der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung« und erst recht der »Achtbänder« oder »Das Geschichtswerk«, wie mitunter etwas hochtrabend formuliert wurde, provozierten die Kritik des Westens, vor allem vorgetragen von sozialdemokratischen Historikern. »Ulbricht fälscht Geschichte«[87] lautete der Titel einer auch in der Sprache des Kalten Krieges verfassten Gegenschrift. Die Kritiker waren im Recht, wenn sie anprangerten, dass in der Geschichtsschreibung der SED nicht wenige unrühmliche Seiten der kommunistischen Bewegung und insonderheit die Verstrickungen in die Stalinschen Verbrechen ausgeblendet blieben, dass eine geschönte, auf die kommunistische Bewegung fokussierte Traditionslinie kreiert worden war, die vom Bund der Kommunisten über die revolutionäre deutsche Sozialdemokratie und die deutschen Linken zu KPD und SED führte, wobei die DDR uneingeschränkt als die Verwirklichung der Ziele und Ideale der Arbeiterbewegung und als Keimzelle des künftigen einheitlichen sozialistischen Deutschlands erschien. Gleichwohl drangen diese Kritiker in der Regel nicht zum Kern von Ulbrichts Geschichtsverständnis vor. Dessen generelle Sicht auf die bis heute nicht zu Ende ausgefochtenen Auseinandersetzungen zwischen zwei großen sozialpolitischen Lagern innerhalb der deutschen Nation, auf das Ringen um die Verwirklichung der Vision von einer Zukunftsgesellschaft ist nicht widerlegt worden. Es trifft auch nicht zu, was rückblickend der Analytiker der SED Geschichtsschreibung Siegfried Lokatis behauptete, das der »Achtbänder« als »›Heilige Schrift‹ der SED«[88] fungiert habe. Ja, es waren mit dieser Darstellung von allen DDR-Historikern respektierte Orientierungen und Wertungen gegeben. Gleichwohl wurde dieses Werk auch von Walter Ulbricht keineswegs als Endstation der Geschichtsschreibung der SED betrachtet. Entsprechend hieß es im Vorwort: »Das mehrbändige Geschichtswerk fasst die bisherigen Ergebnisse der geschichtswissenschaftlichen Arbeiten zusammen und schafft einen neuen Ausgangspunkt für weitere Forschungen.«[89] Schon frühzeitig war von der Notwendigkeit einer 2. verbesserten Auflage die Rede, was mir bei anderen »Heiligen Schriften« bislang nie begegnet ist. Von den Autoren wurden Listen dringlich zu bearbeitender Gegenstände zusammengestellt als Anregungen für Dissertationen oder Diplomarbeiten. Ich erinnere mich, dass sich Ulbricht persönlich zu von mir vorgeschlagenen Themen geäußert hat. Ohnehin hatte er bereits 1962 die Historiker kritisiert, dass sie von sich aus viel zu wenig neue Fragen aufwerfen.[90] Im Übrigen verließ man sich im Westen damals keineswegs auf die Kraft der Gegenargumente. Als wir im Mai 1965 in Frankfurt am Main auf einer vom ehemaligen Bundestagsabgeordneten der KPD Walter Fisch initiierten Veranstaltung der August-Bebel-Gesellschaft Grundgedanken unseres Geschichtsverständnisses vorstellten, registrierte ich 250 Teilnehmer, zwei Mannschaftswagen der Polizei, zehn Polizisten in Zivil und zwei Beamte des Verfassungsschutzes.[91] Letztere erhöhten immer dann ihre Aufmerksamkeit, wenn davon die Rede war, wie das künftige einheitliche Deutschland aussehen sollte und was es mit dem Berlin-Status auf sich habe. Als die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung in acht Bänden vorlag, gingen bundesdeutsche Behörden mit scharfen Restriktionen gegen deren Verbreitung vor. Wie Neues Deutschland am 23. September 1966 unter Berufung auf das Hamburger Abendblatt meldete, waren auf dem Postwege versandte Exemplare der Bände 5 bis 8 – sie behandeln die Jahre 1933 bis 1963 – in Hannover von Zollbeamten beschlagnahmt und der Hamburger Staatsanwaltschaft vorgelegt worden, die ihrerseits ein Gutachten des Amtes für Verfassungsschutz anforderte. Vergleichbares hat es natürlich seitens der DDR analog auch und wohl noch häufiger gegeben, aber wenn es um essenzielle Interessen ging, war der Westen eben auch nicht zimperlich. Jedenfalls spricht das alles dafür, dass man der unter Ulbricht gestarteten Geschichtsoffensive der SED in der Bundesrepublik durchaus Bedeutung beigemessen hat. Rückschauend war es eine illusionäre Erwartung, aus der Beschäftigung mit Geschichte könne eine Aktionseinheit der Arbeiterorganisationen in Ost und West erwachsen, die ein geeintes Deutschland auf sozialistischer Grundlage erkämpft. Insofern stand die unter der Ägide Walter Ulbrichts betriebene Historiografie in einem prinzipiellen Zielkonflikt zwischen ihrer analytischen und ihrer propagandistischen Funktion. Gleichwohl war die »nationale Grundkonzeption« nicht die schlechteste aller denkbaren Leitideen für eine Gesamtdarstellung der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, zumal die nationale und die soziale Frage in diesem Verständnis aufs engste mit der Friedensfrage verknüpft war. Mit den Anstrengungen um die Erarbeitung und Verbreitung des »Achtbänders« erlangten die Arbeiterbewegung, ihre Geschichte wie auch vieles von ihren Idealen und Werten nicht nur in der Historiografie, sondern überhaupt im gesellschaftlichen Bewusstsein in Deutschland-Ost und abgeschwächt auch in Deutschland-West einen herausragenden Platz. Ohne die von der DDR ausgehende Herausforderung (und den Schub der 68er Bewegung) hätte sich die Geschichte der Arbeiterbewegung in der Bundesrepublik nicht als Disziplin an Universitäten und Hochschulen etablieren können, wäre sie nicht von Stiftungen und anderen Geldgebern derartig gefördert worden. In der nun erweiterten BRD fristet sie hingegen wieder ein kümmerliches Dasein. Heute ist es möglich, über geistige Grundlagen und Werte einer europäischen Gemeinschaft zu sinnieren, ohne jene Spur, die von der europäischen Arbeiterbewegung gezogen wurde, auch nur zu erwähnen. Viele Fragen stehen heute anders als zu Ulbrichts Lebzeiten, aber manche Gedanken, die er in das Geschichtsverständnis eingespeist hat, werden früher oder später noch einmal verhandelt werden müssen. Denn mehr Anregungen für das Eindringen in geschichtliche Zusammenhänge und deren Folgen als der Delegitimierungsauftrag, dem gegenwärtig die meisten DDR-Forscher mehr oder weniger eifrig Folge leisten, bieten sie noch immer.
Siegfried Prokop: Augstein: Die DDR kann froh sein, so einen Parteiführer zu haben
Siegfried Prokop, Jahrgang 1940, nach dem Abitur in Neubrandenburg Studium der Geschichte und der Germanistik in Berlin und Leningrad, 1967 Promotion, Hochschullehrer an der Humboldt Universität zu Berlin seit 1979, von 1983 bis 1996 lehrte er dort als Professor für Zeitgeschichte. Gastprofessuren in Paris (1987), Moskau (1988) und Montreal (1991). Von 1994 bis 1996 war er als Nachfolger von Wolfgang Harich Vorsitzender der Alternativen Enquete Kommission Deutsche Zeitgeschichte. Der Rückblick auf das Wirken Walter Ulbrichts muss historisch-kritisch sein. Er darf aber auch nicht daran vorbeigehen, dass nach 1971 seine historische Leistung verkleinert worden ist. In der Zeit, da Ulbricht politische Verantwortung in der DDR trug, rückte das Land in die Rolle eines Juniorpartners der Sowjetunion auf, das Wirtschaftswachstum lag bei fünf Prozent und darüber, und die Sozialleistungen waren ökonomisch fundiert, Auslandsschulden gab es in nennenswerter Größenordnung nicht. 1970 war das Jahr mit der höchsten Akkumulation in der DDR-Geschichte überhaupt. So kam unter Ulbricht die DDR an die Schwelle der unmittelbaren weltweiten völkerrechtlichen Anerkennung durch eigene Wirtschaftskraft heran. Respektvoll sprach man im Westen vom »zweiten deutschen Wirtschaftswunder« und vom »Roten Preußen«. Walter Ulbricht war ein erfolgreicher Politiker, wobei im Vergleich zu seinen Gegenspielern im Westen zu berücksichtigen ist, dass er aus einer viel ungünstigeren Situation heraus agierte und nach einer Katastrophe eine gesellschaftliche Alternative zu verwirklichen versuchte. Ulbricht begann seine Karriere als Mann der bedingungslosen Treue gegenüber der UdSSR unter J. W. Stalin, und er wurde als Reformer gestürzt, der zur stagnativen Politik Leonid I. Breshnews in Distanz stand. Trotz aller Inkonsequenzen im Reformkonzept erscheint dieser Wandel aus heutiger Sicht das Bemerkenswerteste im Wirken von Walter Ulbricht. Methodologisch interessant ist der Ansatz von Gerhard Zwerenz, der in seiner Ulbricht-Studie von 1966 Maßstäbe setzte. Der Inhalt der Studie war den DDR-Bürgern überwiegend durch die von Sebastian Haffner geschriebene Rezension in der konkret bekannt geworden. Haffner hatte, gestützt auf Zwerenz, auch in anderen Publikationen eine von den antikommunistischen Verzerrungen freie Bewertung der Rolle Ulbrichts vorgenommen. Zwerenz schrieb: »Ob man es schätzt oder nicht, Walter Ulbricht stellt in seiner Person und als Exponent seiner Partei die Kontinuität der deutschen revolutionären Tradition dar; und indem er sich einen Staat schuf, vereitelte er alle westdeutschen Bestrebungen, die revolutionäre Tradition der Linken in Deutschland zu eliminieren.«[92] Nimmt man das Wirken Ulbrichts in den 50er Jahren in den Fokus,[93] so fällt im Vergleich zu Konrad Adenauer Ulbrichts Weitblick auf. Schon 1950 drängte er mit Erfolg auf die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, während die westdeutsche Deutschlandpolitik dabei verharrte, in unrealistischer Weise ein Deutschland in den Grenzen von 1937 zu verlangen. Die Bundesrepublik setzte die traditionelle bürgerliche Maßlosigkeit fort, die Zwerenz in jener Studie beschrieb: »Dieses Bürgertum, das nie auf der Höhe seiner Zeit und Situation war und immer nur Vergangenes wiederherstellen wollte, verlor bei jedem Restaurationsversuch nur neue Gebiete und antwortete mit erneuerter Aggressivität, wobei es den Völkischen gelang, das Volk mitzureißen. Dergestalt verlor man zwei Kriege, erhielt aus der Ablehnung des Vertrages von Versailles das Über-Versailles von Potsdam und führt nun den Krieg, den man jeweils über den Rhein, die Weichsel, die Wolga getragen hatte, an der Elbe, dem Fluss in der Mitte Deutschlands: auf sich selbst zurückgeworfen und noch immer mit denselben ungelösten Problemen.«[94] Ulbricht zog in besonderer Weise den Hass der bürgerlichen Klassenkräfte auf sich. Der Schriftsteller Otto Gotsche, zugleich Ulbrichts Sekretär im Staatsrat, sah sich zu einem Reim veranlasst, der künstlerisch unbedeutend ist, aber doch etwas von der Atmosphäre dieser Zeit vermittelt: Der Feind hat Hass und Hohn gespien, Und weil sie ihn hassen, lieben wir ihn. Unser Ruf den Feinden entgegenhalle: Walter Ulbricht – das sind wir alle! Die Attacken gegen Ulbricht reichen bis in die Gegenwart, auf einige dieser Angriffe und Verfälschungen seiner Rolle soll hier hingewiesen werden. Der russische Historiker Boris Chavkin warf in einer Publikation Walter Ulbricht vor, dass er im Juni 1953 nichts unversucht gelassen habe, um in den Ruf »eines größeren Stalinisten als Stalin selbst«[95] zu kommen. Schon im Juli 1952 hätte Ulbricht als Generalsekretär der SED den »Kurs auf beschleunigten Aufbau des Sozialismus«[95] verkündet, behauptet Chavkin in Übereinstimmung mit der Verfügung des Ministerrates der UdSSR vom 2. Juni 1953 »Über die Maßnahmen zur Gesundung der politischen Lage in der Deutschen Demokratischen Republik«.[96] Diese Formulierung ist mit Bezug auf die 2. Parteikonferenz der SED nicht korrekt, und es ist zu fragen, warum fast die gesamte neuere 17. Juni-Literatur diese inkorrekte Formulierung kolportiert. Ich zitiere aus dem Protokoll der 2. Parteikonferenz, was Ulbricht dort wirklich gesagt hatte: »In Übereinstimmung mit den Vorschlägen aus der Arbeiterklasse, aus der werktätigen Bauernschaft und aus anderen Kreisen der Werktätigen hat das Zentralkomitee der SED beschlossen, der 2. Parteikonferenz vorzuschlagen, dass in der Deutschen Demokratischen Republik der Sozialismus planmäßig aufgebaut wird.«[97] Die Rede war also vom »planmäßigen« und nicht vom »beschleunigten« Aufbau des Sozialismus! Historiker sollten sich immer an die Quellen halten. Von einem »beschleunigten« Aufbau des Sozialismus sprach Ulbricht erst auf der 10. Plenartagung des ZK der SED (20.-22. November 1952).[98] Hintergrund war die Fehlbewertung der internationalen Lage durch den kranken Josef W. Stalin, der im Oktober 1952 davon ausging, dass ein Krieg in Europa unmittelbar bevorstehe.[Anmerkung 130] Kurzfristig musste die DDR auf Veranlassung durch die Sowjetische Kontrollkommission (SKK) ihre Rüstungsanstrengungen um weitere 1,5 Milliarden DM aufstocken. Diese Zuspitzung trug wesentlich zu der Krise des Jahres 1953 bei. Vom 2. bis 4. Juni 1953 weilten Otto Grotewohl, Fred Oelßner und Walter Ulbricht in Moskau, wo das Parteipräsidium der KPdSU eine jähe Kurskorrektur offerierte. Solche »neuen Kurse« wurden auch anderen sozialistischen Ländern empfohlen. Ausarbeitungen für einen »Neuen Kurs« in der DDR wurden vorbereitet von einer Kommission unter Leitung des Politbüro-Mitgliedes Fred Oelßner, der auch Gustav Just[99] angehörte. Aber nicht der »Neue Kurs« dürfte es gewesen sein, der es bei den Beratungen zwischen Berija und Ulbricht zu einem Zusammenstoß kommen ließ, sondern die von Berija und anderen Mitgliedern des Parteipräsidiums verfolgte Absicht, die DDR zur Disposition zu stellen. Nicht der »beschleunigte« Aufbau des Sozialismu sollte beendet werden, sondern der Aufbau des Sozialismus überhaupt. Dass sich Ulbricht dagegen wehrte, war sein Recht, besagte aber nicht, dass er deshalb stalinistischer als Stalin gewesen sei. Auch Konrad Adenauer verwahrte sich scharf gegen die Churchill-Initiative zur Lösung der deutschen Frage vom 11. Mai 1953 im Rahmen eines gesamteuropäischen Sicherheitssystems[100] 1 Dass Ulbricht im Zusammenhang mit der Krise vom 17. Juni auch Fehler beging, zeigt u. a. die überdimensionierte Vorbereitung seines 60. Geburtstages, wovon das meiste im Zuge des »Neuen Kurses« gestrichen wurde. Ulbrichts Reaktion auf die Geheimrede Nikita S. Chruschtschows nach dem XX. Parteitag der KPdSU ist vor allem in dem Bericht von Karl Schirdewan überliefert worden. In seinem Buch »Aufstand gegen Ulbricht« – ein Titel, der Schirdewan nicht gefiel – heißt es dazu: »Du kannst ja ruhig sagen, dass Stalin kein Klassiker ist.«[101] Das ist eingängig und kurz und wurde nachfolgend allzu oft als Reaktion Ulbrichts auf den XX. Parteitag der KPdSU kolportiert. Auf keinen Fall ist es richtig, in dieser Sentenz den Beweis dafür sehen zu wollen, dass Ulbricht 1956 ein ungebrochener Stalinist gewesen sei, wie das so oft in der zeithistorischen Literatur geschieht. Schirdewan vergaß, in seinem Taschenbuch lobend zu erwähnen, welche Reformfortschritte er selbst auf der 29. Tagung des ZK 1956 hervorgehoben hatte: »Es wurde ein Prämiensystem für den staatlichen und genossenschaftlichen Handel eingeführt, der entsprechend der individuellen Leistung eine Umsatzbeteiligung der Verkaufskräfte sichert. Das kostet uns aber allein in diesem Jahr zusätzlich noch 50.487.000 DM. Große Zustimmung unter der Bevölkerung findet die Einführung des Teilzahlungsgeschäftes im staatlichen und genossenschaftlichen Handel. Dieser Beschluss führte erstmals dazu, dass das Verhältnis zwischen dem Verkauf von Nahrungsmitteln und Industriewaren sich zugunsten des Verkaufs von Industriewaren zu ändern beginnt.«[102] Solche Neuerungen hatten in der Sowjetunion bis zu deren Ende keine Chance. Obgleich die Reformphase im Gefolge der ungarischen Tragödie auch in der DDR beendet wurde, hätte hier der Vollständigkeit halber noch hinzugefügt werden können, dass 1956 durch undogmatische Politik der Durchbruch auf dem Felde der Jugendweihe gelang, während die orthodoxe Ablehnung der Jugendweihe durch Kirchenvertreter eine Niederlage erlebte. Für die Alltagskultur von Bedeutung war, dass die dogmatische Enge gegenüber dem FKK-Baden überwunden wurde. Auf Initiative des Kulturbundes trat an die Stelle der alten »Polizeiverordnung vom 10. Juli 1942« die »Anordnung zur Regelung des Freibadewesens vom 18. Mai 1956«.[103] Damit begann der Siegeszug des FKK Badens in der DDR. Natürlich wären Reformen ganz anderer Qualität 1956 wünschenswert gewesen. Fritz Behrens, Wolfgang Harich und Kurt Vieweg hatten dazu Vorschläge vorgelegt. Da aber der XX. Parteitag die ganze Fehlentwicklung in der Stalin-Ära einer einzigen Person anlastete und die sowjetische Gesellschaft für sakrosankt erklärte, kam aus Moskau nicht der von den Reformern erhoffte Impuls. Gerhard Zwerenz hat schon 1966 die Vermutung geäußert, dass Ulbricht wahrscheinlich die Abkehr vom Stalinismus anders gewünscht hatte, als sie mit dem XX. Parteitag vollzogen wurde.[104] Zu denken gegeben haben wird 1956 allen Marxisten, die das Interview von Palmiro Togliatti mit der Zeitschrift Nuovi Argumenti lesen konnten, was auch für Ulbricht zutraf. Togliatti hatte erklärt: »Einst war alles, was gut ist, den übermenschlichen, positiven Eigenschaften eines einzigen Mannes zu verdanken – jetzt wird alles, was schlecht ist, den gleichermaßen außergewöhnlichen Mängeln desselben Mannes zugeschrieben. Im einen wie im andern Fall fehlt uns der Prüfstein zur Beurteilung. Die wahren Probleme treten dabei nicht zutage – so zum Beispiel, wie es kam, dass die Sowjetgesellschaft sich so weit vom selbst vorgezeichneten demokratischen Weg und von der Legalität entfernen konnte.«[105] Togliattis Landsmann Domenico Losurdo verglich Jahrzehnte später die unterschiedliche Auseinandersetzung mit dem Erbe von Stalin und von Mao Tsetung: »Es geht darum, den objektiv widersprüchlichen Charakter des Bewusstseinsprozesses zu betonen, und nicht den ›Verrat‹ oder die ›Degeneration‹ dieser oder jener Persönlichkeit. Indem Chruschtschow alles auf den ›Personenkult‹ reduzierte und Stalin dämonisierte, übernahm er dessen schlechteres Erbteil. Da er es ablehnte, in der Auseinandersetzung mit Mao ebenso zu verfahren, erbte Deng Xiaoping dessen bessere Seiten. Das Verfahren, für das sich die neue chinesische Führung entschied, hat jedenfalls die Delegitimierung der revolutionären Macht vermieden.«[106] Ob Ulbricht bereits so tief in den Konflikt des Jahres 1956 einzudringen vermochte, sei dahingestellt. Dass er in eine solche Richtung dachte, scheint aber wahrscheinlich. Auf der 29. Tagung des ZK der SED verwandte Ulbricht den Begriff »Unglück«, womit er andeutete, für wie problematisch er die Vorgehensweise Chruschtschows hielt: »Ihr wisst, dass wir vorsichtig sein müssen. Es ist ein wichtiges Dokument, das an einige Parteien geschickt wurde, in falsche, also gegnerische Hände gekommen. Das hat einen großen internationalen Schaden angerichtet. Ihr werdet verstehen, dass wir jetzt in solchen Dingen etwas vorsichtiger sind. Wahrscheinlich werden wir jetzt so verfahren müssen, dass wir eine Reihe von Genossen zusammenrufen, sie mündlich informieren. Auf diese Weise werden dann die ZK-Mitglieder in den Bezirken informiert. Ich möchte also nicht, dass schriftliche Dokumente in diesen Fällen herausgegeben werden. Es ist ein Unglück passiert, und das genügt.«[107] Auf der Parteiaktivtagung der Berliner Humboldt-Universität am 13. Juni 1956 erklärte Ulbricht: »Genosse Havemann hat in der Diskussion einige sehr interessante Hinweise gegeben. Er sagte, es sei bei der ›Fehlerkritik‹ so herausgekommen, als ob die Partei gegen das ›gute Alte‹ Fehler begangen habe. Er bemerkte richtig, dass die Gegner vom Recht reden, aber in Wirklichkeit in Westdeutschland ständig das Recht beugen. In der Tat, selbst wenn man alle Fehler nimmt, die unter Stalins Führung in der Sowjetunion begangen wurden, oder Fehler, die in den Volksdemokratien begangen worden sind wie z. B. der Rajk-Prozess und der Kostoff-Prozess, so sind doch die Sowjetdemokratie und die Volksherrschaft in den volksdemokratischen Ländern tausendmal demokratischer als das verruchte System der Diktatur des Monopolkapitals in Westdeutschland, wo nur das Recht des Monopolkapitals besteht.«[108] Dass Ulbricht die hier kursiv gedruckte Textpassage durchstrich und somit für eine größere Öffentlichkeit nicht freigab, zeigt an, dass er sich seiner Bewertung nicht sicher war. Die Passage zeigt aber auch, dass er darum rang, eine offensive Auslegung vorzunehmen; auch dies musste misslingen, weil Moskau einen Rahmen vorgegeben hatte, der objektiv auf Delegitimierung des revolutionären Prozesses ausgelegt war. Ulbricht hat besonders auf der 29. Tagung Reformideen vorgetragen, die vor allem auf die Stärkung der Rechte der Arbeiter in den Betrieben gerichtet waren.[109] Sein Konzept der Arbeiterkomitees bedeutete letztlich die Wiederherstellung der Betriebsräte, weshalb er vor allem auf Widerstand von Seiten der Führung des FDGB stieß, die solch eine Konkurrenz nicht wünschte. Die Vertreter der Arbeiterkomitees sollten geheim gewählt werden und ein Drittel mehr Kandidaten, als gewählt werden konnten, sollten sich zur Wahl stellen. An die Bereitschaft Ulbrichts, sich an die Spitze der Reformkräfte zu stellen, hätten Walter Janka, Gustav Just und Wolfgang Harich anknüpfen sollen. Aber das Gespräch, das Ulbricht Harich gewährte, wurde dafür nicht genutzt. Es scheiterte. Über die Ursachen des Scheiterns ließ Harich nichts verlauten. Was zwischen Ulbricht und Harich am 7. November 1956 besprochen worden ist, wurde durch die Schilderungen Harichs in der Öffentlichkeit bekannt. In seinem Buch »Keine Schwierigkeiten mit der Wahrheit« verwandte er 21 Zeilen dafür. Er schrieb, dass das Gespräch nur 20 Minuten gedauert habe. Anders als bei dem Gespräch mit Botschafter Puschkin habe er kein Wort zu seiner Reform Konzeption gesagt. Warum eigentlich nicht? Was aber sagte Harich? »Als ich mich ganz allgemein über unsichere Zeiten ausließ und zu verstehen gab, dass ich einen politischen Meinungsaustausch zwischen Führung und Intelligentsja, etwa im Rahmen der Akademie der Wissenschaften, für geboten hielt, schnitt Ulbricht mir das Wort ab mit dem Ausruf, schlecht sei an dieser Zeit, dass es Verräter gäbe, Lukács, Tibor Déry, Julius Hay und andere in Ungarn, erklärte er, alle seien sie Verräter. ›Und eines sage ich Ihnen: Wenn sich hier so etwas bilden sollte wie ein Petöfi-Club, das würde bei uns im Keim erstickt werden.‹ Auch die damit vernehmlich ausgesprochene Warnung habe ich in den Wind geschlagen.«[110] Warum Ulbricht so heftig reagierte, teilte Harich dem Leser nicht mit. Ulbrichts Darstellung des Gesprächs wurde, da sie nie publiziert worden ist, nicht so bekannt wie die von Harich. Auf der Zentralen Arbeitskonferenz des ZK der SED schilderte Walter Ulbricht im Dezember 1956 sein Gespräch mit Harich: »Mir ist Folgendes passiert: Ich habe Herrn Harich zu einer Besprechung bestellt. Da er Professor der Philosophie und Chefredakteur der Zeitschrift für Philosophie ist, wollte ich mich mit ihm darüber unterhalten, warum der Meinungsstreit in der Philosophie nicht vorwärts geht, warum man die neuen Probleme des Sozialismus nicht diskutiert, die Fragen der sozialistischen Moral usw. Nach fünf Minuten sagte mir Herr Harich: Wissen Sie, darum geht es gar nicht. Über den wissenschaftlichen Meinungsstreit gibt es keine Beschwerden. Der geht doch in der Öffentlichkeit so ganz gut vor sich. Das interessierte ihn also gar nicht. Er sagte weiter: Es gibt viel wichtigere Fragen, zum Beispiel die Konsequenzen aus der internationalen Lage. Es ist Zeit, dass die volle Selbständigkeit aller Volksdemokratien und aller Völker gesichert wird. – Ich fragte: Was sollen wir denn noch an Selbständigkeit bekommen? Mir ist das nicht ganz klar. Niemand beeinflusst unsere Politik. Es gibt bei uns keine Beauftragten, die die Regierung zu irgendwelchen Maßnahmen veranlassen. Was wollen Sie eigentlich? Das ist mir unverständlich. – Er antwortete: Nun, das heißt die volle Selbständigkeit zum Beispiel auch der Staaten, die in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken zusammengefasst sind. – Ich fragte zurück: Sie meinen also die Selbständigkeit der Ukraine und Sowjetrusslands? Ja, das auch. – Ich sagte: Jetzt verstehe ich das erst. Das hat in der Tat mit Philosophie nichts zu tun. Das ist nicht nur Konterrevolution. Das ist eine Konzeption für den Krieg. – Das war die ganz sachliche Unterhaltung, die wir hatten.«[111] Dass sich Ulbricht als Realpolitiker 1956 auf solch ein Konzept nicht einlassen konnte, scheint plausibel zu sein. Harich sah 1956 Konflikte in der Sowjetunion wirken, die erst Anfang der 90er Jahre mit der Auflösung der Sowjetunion voll zum Tragen kamen. 1956 konnte das nicht Punkt 1 der Reformagenda in der DDR sein. Und Harich hat das wohl auch schnell begriffen, denn er berichtete im »Kreis der Gleichgesinnten« nicht darüber, womit er das Gespräch zum Scheitern gebracht hatte.[112] Seine Mitstreiter konnten vor allem deshalb auch keine richtigen Schlussfolgerungen für das weitere Vorgehen ableiten. Erst bei den Gesprächen zwischen Rudolf Augstein und Wolfgang Harich am 28. November 1956 erfuhr Harich eine frontale Zurückweisung. Der Spiegel-Chef Augstein warf Harich vor, dass er einer Psychose gegen Ulbricht verfallen sei. Er halte dies für eine Dummheit. Ulbricht sei ein sehr energischer und geschickter Mann und den meisten Führern im Ostblock überlegen. Es komme nicht auf einen Führungswechsel in der SED an, sondern auf die Linie der Moskauer Politik. Wenn diese Linie richtig sei und das werde sie nach den polnischen und ungarischen Erfahrungen sicher werden, dann werde Ulbricht diese Linie in der DDR energischer und gründlicher durchführen als seine Kollegen in den osteuropäischen Ländern. Harich widersprach heftig. Aber Augstein blieb bei seiner Auffassung. Ulbricht würde Harichs Auffassungen besser vertreten als Harich, wenn sich diese erst einmal in Moskau durchgesetzt hätten. Harich solle doch froh sein, dass die DDR diesen »wendigen alten Fuchs«[113] zum Parteiführer hat. Zur Rolle Ulbrichts im Jahre 1956 wäre noch viel zu sagen, vor allem auch dazu, warum er nach der ungarischen Tragödie in dieser scharfen, repressiven Art gegen die intellektuelle Opposition in der DDR[114] (u. a. mit Schauprozessen und hohen Zuchthausstrafen) vorgehen ließ, allerdings würde das den Rahmen dieses Beitrags sprengen. Als Konsequenz der ungarischen Ereignisse sah Ulbricht die Machtsicherung als Gebot Nr. 1 an. Politische Gegner schaltete er aus, aber im Unterschied zu Stalin ließ Ulbricht diese am Leben. Auch richtete er Repressionen nicht gegen die ganze Intelligenz. Mit der Gründung des Forschungsrates der DDR im Jahre 1957 wurde signalisiert, dass Wissenschaftler und Techniker Förderung und Unterstützung erfahren würden. 1993 erbat eine Tageszeitung von mir einen Artikel aus Anlass des 100. Geburtstages von Walter Ulbricht. Eine ganze Zeitungsseite durfte dieser lang sein. Als besondere Zugabe lockte die Wahrscheinlichkeit, dass über den Entwurf des Artikels mit Lotte Ulbricht, die ansonsten zu Gesprächen mit Journalisten und Historikern nicht bereit war, diskutiert werden könne. Es war nicht zu viel zugesagt worden. Ich erhielt den Termin in Berlin-Pankow, Majakowski-Ring. Lotte empfing mich ziemlich unfreundlich: »Wer bist denn du überhaupt? Du kennst doch Walter überhaupt nicht.« Sie ließ keinen Zweifel daran, dass ich aus ihrer Sicht über Walter zu kritisch geschrieben hatte. Ich fragte sie, warum mit Wolfgang Harich in der bekannten repressiven Weise umgegangen worden war. Darauf sagte sie: »Harich hatte sich das Programm vom Feind diktieren lassen.« Ich konnte sie nicht davon überzeugen, dass sich Harich nie von irgendwem etwas diktieren ließ, auch sei sein Programm nicht feindlich gewesen. Im Gegenteil, darüber hätte diskutiert werden müssen … Der Artikel, der dann veröffentlicht wurde, war keineswegs unkritisch.[115] Den Entwurf hatte ich vor der Veröffentlichung auch mit Wolfgang Harich besprochen. Jedoch war mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, dass Harich es war, der bei seinem Gespräch mit Ulbricht eine Chance vergeben hatte. Ulbrichts Sieg über die Opposition im Jahre 1956 war verbunden mit einer Unterdrückung jeglichen Ansatzes zu einem demokratischen Sozialismus, der als untaugliches Konzept der SPD galt und für die DDR abgelehnt wurde. Ulbrichts Kurs war ausgerichtet auf einen »realen Sozialismus« (andere Lesarten: »Staatssozialismus«, »autoritärer Sozialismus«), der sich partiell am chinesischen Modell (bis 1960) und überwiegend am sowjetischen Modell orientierte, was einem Rückfall hinter die politische Demokratie der bürgerlichen Gesellschaft gleichkam. Das Volkseigentum verharrte auf der Stufe des Staatseigentums, was bedeutete, dass es zu keiner realen Vergesellschaftung der Produktionsmittel kam und die Entfremdung weiter wirkte. Die 1958 proklamierte sozialistische Demokratie (»Arbeite mit, plane mit, regiere mit!«) bot Entfaltungschancen, allerdings nur in einem begrenzten Rahmen. Eine sich verselbständigende Bürokratie bediente sich der Zentralisierung und des bürokratischen Zentralismus. Der »reale Sozialismus« verfügte gegenüber seinen Bürgern nur über eine begrenzte Bindekraft. In den Westen gingen auch viele Bürger der DDR, die sich an sozialistischen Idealen orientierten. Der Bildhauer René Graetz erklärte zu dem Phänomen, dass eine große Zahl links eingestellter Kunststudenten der DDR in den Westen gingen: »Zwei Drittel der Schüler im Westen kommen vom Osten. Das ist eine Katastrophe. Das ist ein Ergebnis unserer Politik. Unsere Schüler wissen überhaupt nichts über moderne Kunst. Sie haben hierüber nur gelernt: Das ist Unterstützung des Imperialismus, das ist reaktionär usw. Die Zeit von 1900 bis heute ist für diese ganze Generation ein vollkommen unbekanntes Blatt. Lenin sagte einmal: Man muss von allen lernen.«[116] Meinungsäußerungen, die den Anstoß zu Veränderungen hätten geben können, wurden als »Unklarheiten« abgetan. Wie sollte es aber bei dem weiter herrschenden Dogmatismus des SED Apparates zu einer spontanen Identifikation jedes einzelnen Individuums mit dem gesellschaftlichen Ganzen kommen? Gerade auch hausgemachte Fehler der von Walter Ulbricht geführten SED trugen Ende der 50er/Anfang der 60er Jahre zur Zuspitzung der Lage in der DDR bei:
• Das irreale Überholmanöver des V. Parteitages der SED gegenüber der Bundesrepublik, dass 1961 zum Überholen im Pro-Kopf-Konsum und 1965 zum Überholen in der Arbeitsproduktivität führen sollte (Siebenjahrplan 1959).
• Die überstürzte Einführung der zehnjährigen polytechnischen Oberschulbildung, die durch den verspäteten Berufsstart von etwa 80 Prozent zweier Alters-Jahrgänge den akuten Arbeitskräftemangel weiter zuspitzte.
• Die Kampagne des »sozialistischen Frühlings« 1960, die zu dem hohen Preis des Rückgangs der landwirtschaftlichen Bruttoproduktion den Zusammenschluss in Agrargenossenschaften im Vergleich zum Siebenjahrplan (1965) vorfristig abschloss.
• Die in zweistelliger Milliardenhöhe getätigte Fehlinvestition in die Flugzeugindustrie, die ein kleines Land wie die DDR nicht so ohne weiteres verkraften konnte. Wären die Mittel für die Flugzeugindustrie in die Rationalisierung der Industrieproduktion gesteckt worden, hätte ein bedeutender Produktivitätszuwachs erreicht werden können. (Zu einer Fehlinvestition wurde es jedoch erst durch die Rücknahme der ursprünglich gemachten Zusage der Sowjetunion, den in der DDR entwickelten Düsenjet 152 bei der Aeroflot einzuführen. Ohne diesen Großmarkt aber war eine Flugzeugproduktion ökonomisch nicht sinnvoll, weshalb sie gar nicht erst begonnen wurde.)
Die Krise des Jahres 1961 bewirkte bei Ulbricht ein Umdenken und machte ihn als Staatsmann im folgenden Dezennium in höherem Grade weiser als zuvor, worüber hier nicht mehr zu schreiben ist. Abschließend soll hinterfragt werden, was der antikommunistische Zeitgeist im Juni 1961 Ulbricht fälschlich als »Jahrhundertlüge« anlastet. Auf einer internationalen Pressekonferenz am 15. Juni 1961 hatte Walter Ulbricht auf eine Anfrage von Annemarie Doherr von der Frankfurter Rundschau zutreffend erklärt, dass niemand die Absicht habe, eine Mauer zu errichten. Auf die Frage des Spiegel, ob die Kontrolle über die Luftsicherheit auch die Kontrolle der Passagiere einschließe, erklärte Ulbricht: »Ob die Menschen zu Lande, zu Wasser oder in der Luft in die DDR kommen, sie unterliegen unserer Kontrolle … Wir machen es genauso, wie man es in London macht. Damit ist die Sache in Ordnung.«[117] Was Ulbricht hier gesagt hat, war nichts als die Wahrheit. Im Juni 1961 verfolgte weder die Sowjetunion noch die DDR das Ziel, in Berlin eine Mauer zu errichten. Zu jener Zeit wurde Kurs darauf genommen, den Flughafen Berlin Schönefeld als Zentralflughafen für die Ost- und Westberliner auszubauen. Für den um Berlin entstandenen Konflikt wurde eine »Luftlösung« angestrebt. Das wäre eine Lösung im Interesse der Bürger in Ost und West gewesen. Unter Berufung auf alliierte Rechte blockierten aber die Westmächte eine »Luftlösung«, weshalb Nikita Chruschtschow sich Ende Juli 1961 für eine Abriegelung zu Lande entschied,[118] der die Warschauer Vertragsstaaten sowie Volkskammer und Regierung der DDR in den folgenden Tagen zustimmten. Diese »Mauer« Lösung erfolgte also keineswegs ohne Zutun des Westens.[119]
Diether Dehm: Ein Dämonbild kippt
Diether Dehm, Jahrgang 1950, nach dem Abitur in Frankfurt am Main Studium der Sonder- und Heilpädagogik, seit den späten 60er Jahren Liedermacher und Autor für Musik- und Kabarettkünstler. 1981 rief er mit Lindenberg, Wader und anderen »Künstler für den Frieden« ins Leben, 1983 gründete er das Schallplattenlabel »Musikant«. Mit 15 Eintritt bei den Falken, 1965 SPD, 1994 Bundesvorsitzender der SPD Unternehmer und Einzug in den Bundestag. 1998 verließ er mit 24 weiteren Sozialdemokraten aus Frankfurt am Main die SPD und trat am Tag des Bundestagswahl der PDS bei. Seit 2005 Bundestagsabgeordneter für die PDS/Linke. Während der Jahre, die ich in Frankfurt am Main die Schule besuchte, war das Walter-Ulbricht-Bild das eingetrichterte eines Dämons: »der Spitzbart«, »die sächsische Fistelstimme«, »der Vasall Moskaus«, »der blutige Statthalter Stalins« und »Spalter Deutschlands«. Aber bereits als Werber für die Jusos und ihre Forderung nach Anerkennung der Oder-Neiße-Linie und später für Willy Brandts Ostpolitik, dann als Streiter gegen das CDU Misstrauensvotum am 27. April 1972 benötigte ich dringend neue Argumente. Gegen das, was Springer hetzte. Ausgerechnet Willy Brandt sollte einem Mörderstaat und Unrechtsregime die Verhandlungshand ausstrecken? Als was Adenauer, Kiesinger, Barzel und NPD die DDR hinstellten. Um wenigstens die diplomatischen Beziehungen zur DDR Regierung ein ganz klein wenig zu verteidigen, war ich also gezwungen, mir detailliertere Gegeninformation zu besorgen. Zunächst musste ich die extreme Notlage studieren, in der die Zangengeburt DDR (vormals SBZ) zwangsläufig aus dem Weltkrieg gekommen war. Das extreme Ungleichgewicht kam mir vor Augen zwischen dem Wirtschaftsgebiet Ost und West. Und auch die Entnazifizierung, in der die antifaschistische DDR junge, neue, unerfahrene Unternehmer einstellen und größtenteils wirtschaftliche und politische Kader völlig auswechseln wollte (worauf die BRD verzichtete, indem sie ihre Wirtschaft auch von alten Massenmördern aufbauen ließ) – das alles musste »strafmildernd« für die DDR ins sozialdemokratische Umfeld und an die Wählerschaft und Infostände gebracht werden. Der Schwur von Buchenwald war damals ein zivilisatorischer Imperativ, aber durchaus kein Wirtschaftsförderungsprogramm. Aber nicht nur mir und meiner Familie als Antifaschisten machte das Eindruck. Mit dem Kriegsende war die sowjetische Besatzungszone von der im Westen angesiedelten Schwerindustrie getrennt, hatte anderthalb zerschossene Hochöfen – im Vergleich zur BRD, die ein Vielfaches an Hochöfen besaß, die von der anglo-amerikanischen Luftwaffe zuvor auch wohlweislich geschont worden waren. Industrielle Reste in Ostdeutschland waren zur Reparation von den Sowjets bis auf die Eisenbahnschwellen demontiert worden. Während die USA- und andere Westkapitalien via Marshallplan usw. finanziell freie Spitzen in ein gigantisches Wiederaufbauprogramm Westdeutschlands gesteckt hatten. Je mehr mir dann als Schüler die Notlage als Ausgang der DDR klarer wurde, desto genauer besah ich kluge wirtschaftliche Maßnahmen, ja, eigenwillige Improvisationen des Walter Ulbricht. Erst wirklich erschloss er sich mir, als mir, allerdings später, Lenin und dann Bucharin (der sogenannte Rechtsabweichler der Bolschewiki) sympathisch wurden und deren Neue Ökonomische Politik, die ja auch privaten klein- und mittelständischen Besitz strategisch aufwertete. Dann, als linker Unternehmer (und als Bundesvorsitzender der SPD Unternehmer), begriff ich in der eigenen Arbeit, wie nötig und kompliziert gleichermaßen die Einbeziehung kleiner und mittlerer Betriebe in eine postkapitalistische Ökonomie, die wir auch antimonopolistische Demokratie nannten, ist. (Weil eben der Staat für die Führung kleiner Handels- und Handwerksbetriebe nichts Wirkungsvolleres in seinem Instrumentenköfferchen hat als das Drosseln von Talent und Privatinitiative.) Später las ich Haffners Äußerung über Ulbricht, die besagte, dass nach Bismarck Ulbricht einer der bedeutendsten deutschen Politiker war. Ulbrichts Name ist also für mich heute auch verbunden mit dem Versuch der Reform der DDR-Wirtschaft in Gestalt des Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung. Mit Weitblick hat er sich dafür besonders während der Jahre 1962/63 eingesetzt. Wenn in der Wirtschaft des Landes – wie im Ministerratsbeschluss vom 11. Juli 1963 festgelegt – ökonomische Hebel wie Selbstkosten, flexiblere Preise, Gewinn als Entscheidungsfaktor, Kredite, Löhne, Prämien zur Geltung kommen sollten (eine Art sozialistisches »check & balance«), dann sehe ich darin heute einen realistischen, erfolgversprechenden Ansatz für die Überwindung des Arbeitsproduktivitätsrückstands der DDR gegenüber der BRD und damit auch für die Erhöhung des politischen Gewichts der DDR in den deutsch deutschen Beziehungen. Die damals einsetzende Steigerung der jährlichen Akkumulationsrate von 17,6 Prozent (1963) auf über 20 ab 1965 bezeugte die Wirkung eines solchen Wirtschaftens. Demgegenüber wurde später, als das große antifaschistische Gründerfeuer der DDR allmählich zur Sparflamme wurde, der überwiegende Teil der bis dahin noch existierenden nicht volkseigenen Unternehmen verstaatlicht. Betroffen waren Privatunternehmen, Betriebe mit staatlicher Beteiligung und Produktionsgenossenschaften des Handwerks (PGH). Zum Vorteil für die DDR-Wirtschaft war das jedenfalls nicht. Zum Abbau von Schlangen, Unzufriedenheit und entsprechendem Spitzelbedarf trug das auch nicht bei. Nachhaltigen Eindruck machten auf mich auch Walter Ulbrichts Aktivitäten in Sachen »Konföderation« in Richtung »Deutschland, einig Vaterland«. Ich nenne diesen Begriff hier als Sammelkennzeichen für Vorschläge zunächst zur Entkrampfung des Verhältnisses zwischen beiden deutschen Staaten. Dazu gehörten etwa die Übersendung eines Entwurfs für »Grundsätze zur Wiedervereinigung Deutschlands als friedliebender demokratischer Staat«, 1964 die Anregung, BRD-Presseorgane wie Die Zeit und Süddeutsche Zeitung in der DDR und DDR-Blätter wie Neues Deutschland in der BRD zum Verkauf anzubieten, sowie 1966 der Vorschlag eines Redneraustausches. Der Konföderationsgedanke wurde in einer zweiten Variante wieder aufgegriffen: ein Verständigungsfrieden und Versöhnung seien anzustreben. Die Willy-Willi-Gespräche zwischen Brandt und Stoph in Erfurt und Kassel 1970 hatten ihren Ursprung ebenfalls in einer Anregung Walter Ulbrichts. Auf dem VII. Parteitag der SED 1967 hat er sie unterbreitet. Ähnliches gilt für die Aufnahme der deutschen Staaten in die UNO und den Vertrag über die Nichtanwendung von Gewalt zwischen beiden deutschen Staaten und die Anerkennung der Grenzen in Europa. Vieles, was Ulbricht schon 1968 konstruktiv gedacht und vorgebracht hat, wurde später Wirklichkeit. So im Grundlagenvertrag 1972. Irgendwann drehte sich somit mein Monsterbild; der hässliche Frosch, als der mir Ulbricht durch meine Schule, meine SPD, meine Medienlektüre ausgemalt war, stieg zwar nicht in einen Prinzen, aber zu einem Menschen. Der Dämon kippte. Und zwar zu einem eigenwilligen Staatsmann, dessen Fragestellungen mich extrem interessierten. Dass er am 16./17. Juni 1953 das Angebot Brechts ausschlug, tumbe SED Indoktrination durch Straßen- und Radio-Kunst des Berliner Ensembles zu ersetzen, um so einen bedeutenderen Dialog mit den Unzufriedenen anzuzetteln, hat mir Ulbrichts Kulturkonzept zwar sicherlich nicht näher gebracht (das DDR-Radio dudelte ganztägig Operettenmusik, während die Panzer rollten, die Brecht begrüßte). Ulbrichts anfängliche Litaneien gegen Beatles und »westlich dekadentes Auseinander-Tanzen« auch nicht. Aber immerhin: Brecht hatte sich (freiwillig und gegen andere Angebote) für Ost-Berlin entschieden. Und das bedeutendste Theater Europas konnte am Schiffbauerdamm arbeiten (sogar mit einem von Hanns Eisler geförderten Regieassistenten Wolf Biermann) und in politischer Enklave sogar allerlei Politbüro-Plattitüden überstehen – auch Ulbricht sei Dank. Später stand der Mauerbau zwischen ihm und meinen Genossen. Eigentlich war es dann ausgerechnet Franz Josef Strauß, der mit seinen Memoiren ein Dämonbild des Kalten Krieges zum Kippen brachte. Dieser Einpeitscher des Kalten Kriegs bemerkt in seinen Memoiren, dass der Bau der Mauer »die Weltlage entspannt«, d. h. von der Gefahr befreit habe, »die stalinistischen Bürokratien im Osten könnten die Kontrolle über die Arbeiterklasse verlieren und militärische Intervention der Westmächte damit notwendig werden«. Nachdem Strauß dort die wachsende Kriegsgefahr und sogar (ich rieb mir die Augen zweimal) die von der NATO entwickelten Pläne eines Atombombenabwurfs über der DDR erläutert hat, schreibt er: »Mit dem Bau der Mauer war die Krise, wenn auch in einer für die Deutschen unerfreulichen Weise, nicht nur aufgehoben, sondern eigentlich auch abgeschlossen.«[120] Und mit Strauß’ Memoiren stellten sich dann viele kaum offen aussprechbare Fragen. Auch nach der Atomkriegsgefahr über uns Kindern, damals, als wir gerade einmal die 4. oder 5. Schulklasse besuchten. Ich habe zu diesem merkwürdigen Mann Walter Ulbricht also mein Verhältnis gründlich umjustieren müssen, kann ergo aus dieser Posthum Begegnung anderen Wessis nur raten: Stöbert mehr! Über Ulbricht und diese Zeit. Mit den Fragemethoden des »lesenden Arbeiters«. Damit die ganze Geschichte nicht mehr den Schreibsöldnern des Kapitals gehört.
Kurt Gossweiler: Unter Ulbricht widerstand die SED dem Revisionismus maximal
Kurt Gossweiler, Jahrgang 1917, geboren und aufgewachsen in Stuttgart, Studium der Volkswirtschaftslehre, antifaschistischer Widerstand, 1943 übergelaufen zur Roten Armee, Besuch der Antifa-Schule in Taliza und 1947 Rückkehr nach Berlin. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Humboldt-Universität, 1963 Promotion, 1972 Habilitation. Bis zu einer Emeritierung 1983 tätig am Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der DDR. Seine Arbeitsschwerpunkte waren neben der NS-Forschung die Arbeiterbewegung, die Geschichte der Sowjetunion und der Revisionismus. Das Führungskollektiv der SED mit Walter Ulbricht als erstem Mann führte einen ebenso entschlossenen wie flexiblen Kampf zur Verteidigung einer marxistisch-leninistischen politischen Linie der SED. Dafür geriet Walter Ulbricht sehr bald nicht nur in das Feuer des Klassenfeindes in Bonn, sondern sah sich immer häufiger gezwungen, Fallen auszuweichen und unschädlich zu machen, deren Herkunft nicht im Westen, sondern im Osten lag. Bis zum Sturz Chruschtschows im Oktober 1964 musste Ulbricht eine Gratwanderung vollbringen, die höchste politische Meisterschaft erforderte; er musste den massiven Bemühungen Chruschtschows, die SED ebenso wie die polnische und die ungarische Partei auf revisionistischen Kurs zu bringen, ständig entgegentreten und sie abwehren, zugleich aber alle Versuche durchkreuzen, zwischen SED und KPdSU Keile zu treiben oder Zweifel an der zuverlässigen Freundschaft der DDR zur Sowjetunion aufkommen zu lassen. Später einmal wird man auf der Grundlage auch sowjetischer Dokumente hoffentlich die Möglichkeit haben, nachzuzeichnen, wie oft die Chruschtschow-Riege in der KPdSU Anlauf nahm, Walter Ulbricht ebenso zu stürzen, wie das mit Rákosi in Ungarn gelungen war. Aber auch ohne diese Dokumente lässt sich nachweisen, dass ein solcher Versuch erstmals nach Stalins Tod im Mai/Juni 1953 unternommen wurde,[121] und ein neuerlicher Versuch im Gefolge des XX. Parteitages der KPdSU scheiterte. Der letzte Versuch lässt sich im Jahre 1964 feststellen. Chruschtschow setzte in jenem Jahr zum entscheidenden Schlag gegen seinen gefährlichsten Gegner, gegen Mao Tsetung und die KP Chinas, an. Er bereitete für den Herbst 1964 eine Konferenz kommunistischer Parteien vor, auf der er die Zustimmung zur »Exkommunikation« der KP Chinas aus der Familie der kommunistischen Parteien erreichen wollte. Zu dieser Besprechung war Palmiro Togliatti mit einer Erklärung in die Sowjetunion gereist, die als sein Testament in die Geschichte der Arbeiterbewegung eingegangen ist, weil er auf der Fahrt zum Konferenzort plötzlich verstarb. In dieser Erklärung sprach sich Togliatti ausdrücklich und mit Nachdruck gegen die Idee aus, die Kommunistische Partei Chinas zu »exkommunizieren«, obwohl er viele kritische Einwände gegen die KP Chinas vorbrachte. Im gleichen Jahr 1964 reiste der Schwiegersohn Chruschtschows, Adshubei, Chefredakteur des Regierungsorgans Iswestja, in die Bundesrepublik Deutschland, wo er auch mit Franz Josef Strauß ein anscheinend sehr intimes Gespräch hatte, denn die Westpresse wusste darüber zu melden, dass er Strauß auch darüber informiert haben soll, dass Walter Ulbricht ein »todkranker Mann« sei. Das war natürlich nicht medizinisch, sondern politisch gemeint, als Hinweis darauf, dass Walter Ulbrichts politischer Sturz bevorstehe. Das Jahr 1964 sollte also zum Jahr des Triumphes Chruschtschows über seine hartnäckigsten und gefährlichsten Gegner werden. Stattdessen wurde es das Jahr des endlichen Sturzes Chruschtschows. Um Walter Ulbricht von der Spitze der SED zu drängen, nutzten Chruschtschow und seine Verbindungsleute in der DDR die Meinungsverschiedenheiten und persönlichen Animositäten, die es im Kreise der Parteiführung gab, um eine Politbüro- und ZK-Mehrheit gegen Ulbricht zustande zu bringen. Das war der Hintergrund für die »Affären«, die mit dem Ausschluss Rudolf Herrnstadts und Wilhelm Zaissers 1953 und Karl Schirdewans und Ernst Wollwebers 1958 aus der Führungsspitze und aus der Partei (Herrnstadt/Zaisser) endeten. Meine persönliche Ansicht ist, dass die meisten der Genossen, die damals gegen Walter Ulbricht auftraten, dies nicht aus revisionistischer Gesinnung taten – es handelte sich dabei größtenteils um Genossen, die sich als Kommunisten und antifaschistische Widerstandskämpfer erwiesen hatten –, sie handelten vielmehr in Unkenntnis dessen, dass sie Schachfiguren in einem ihren Interessen ganz fremden Spiel darstellten. Andererseits war es Walter Ulbricht natürlich nicht möglich, diese Hintergründe, über die er selbst sich als einer der erfahrensten Spitzenfunktionäre der Kommunistischen Internationale ganz gewiss im Klaren war, im Zentralkomitee oder auch nur im Politbüro darzulegen. Die Möglichkeiten, den revisionistischen Grundentscheidungen der KPdSU-Führung entgegenzutreten, waren aufgrund all dessen außerordentlich begrenzt. Dennoch gehörte die SED zu den Parteien, die pro-revisionistische Beschlüsse und Entscheidungen aus Moskau mit spürbar fehlendem Engagement übernahmen, alle antirevisionistischen Stellungnahmen dagegen breit popularisierten und mit diesen eine intensive Mitgliederschulung betrieben. Das war so 1955 bei der »Versöhnung« mit Tito; sie musste nolens volens nachvollzogen werden, jedoch nicht, ohne dafür den Preis des Bruches der Hallstein-Doktrin durch die Anerkennung der DDR zu verlangen,[122] dem Tito nachzugeben sich schließlich am 15. Oktober 1957 gezwungen sah. Das hinderte die SED-Führung aber nicht daran, zwei scharfe Kritiken sowjetischer Verfasser am Revisionismus der Tito-Partei umgehend auch in der DDR zu verbreiten.[123] Ähnlich das Verhalten zum XX. Parteitag, insbesondere zu Chruschtschows Geheimrede. Sie wurde in der DDR in keinem Presseorgan und auch auf keinem anderen Wege veröffentlicht. Lediglich in Parteiversammlungen wurde ihr Hauptinhalt in Kurzfassung mitgeteilt. Als ein großer Teil der Parteimitgliedschaft auf den XX. Parteitag genau so reagierte, wie das von Chruschtschow und seinen Leuten beabsichtigt worden war – nämlich mit der Forderung nach der Entfaltung einer breiten Diskussion über die Fehler der Vergangenheit – widerstand dem die Parteiführung und orientierte darauf, »die Fehler im Vorwärtsschreiten« zu korrigieren und zu überwinden. Viele waren damit unzufrieden und meinten, die Parteiführung drücke sich nur davor, Rechenschaft über ihre eigenen Fehler abzulegen; ihnen schien die »Abrechnung mit der Vergangenheit«, wie sie im Polen Gomulkas betrieben wurde, genau das Richtige und Notwendige zu sein. Erst als die negativen Folgen eines solchen Vorgehens in Polen und dann in der ungarischen Konterrevolution vom Herbst 1956 offensichtlich wurden, fand das Verhalten der Parteiführung allmählich wieder die Zustimmung einer festen Mehrheit in der Partei. Aber ein erheblicher Teil, vor allem unter den Intellektuellen, blieb unzufrieden mit der – wie sie meinten – »Abwürgung« der Kritik. In der Partei wie auch in der Bevölkerung hatte der XX. Parteitag Stimmungen geweckt, die bislang als kleinbürgerlicher Liberalismus durchaus richtig gekennzeichnet worden waren, die nun aber vom XX. Parteitag gewissermaßen die »höheren Weihen« als das bessere, undogmatische, freiheitliche und zukunftsweisende Denken und Empfinden erhalten hatten. Trotz dieses wachsenden Druckes auf die Parteiführung hielt diese konsequent an ihrer Linie fest, sich von den konkreten Aufgaben des sozialistischen Aufbaus durch endlose »Fehlerdiskussionen« nicht ablenken zu lassen. Zusammenfassend lässt sich sagen: Die revisionistischen Grundentscheidungen der sowjetischen Führung der Chruschtschow-Periode glaubte die SED-Führung mitvollziehen zu müssen. Insofern wurde auch die SED Mitgliedschaft und die Bevölkerung infiziert von der revisionistischen Verfälschung des Marxismus-Leninismus und der Geschichte der sozialistischen Staaten. Doppelt verhängnisvoll wirkte und wirkt sich aus, dass dieses Abgehen vom Marxismus-Leninismus mit Erfolg als das genaue Gegenteil dessen, nämlich als Wiederherstellung und Weiterentwicklung des Marxismus Leninismus, ausgegeben wurde. Das hat zum einen, als es noch Zeit dafür war, Widerstand gegen das Verlassen des wirklich marxistisch-leninistischen Weges zu leisten, diesen Widerstand verhindert; und es verhindert zum anderen heute die Erkenntnis über die wirklichen Ursachen des Zusammenbruchs der sozialistischen Staaten, weil dieser Zusammenbruch ja vermeintlich das Ergebnis des Beharrens auf dem marxistisch-leninistischen Weg war. Dennoch wäre es falsch, die SED als eine revisionistische Partei zu bezeichnen. Unter der Führung Walter Ulbrichts hat diese Partei ein Maximum des damals möglichen Widerstandes gegen den Revisionismus der Chruschtschow-Clique geleistet und erheblich dazu beigetragen, dass Chruschtschow im Oktober 1964 gestürzt wurde. Sie hat darüber hinaus wichtige Beiträge an theoretischen Erkenntnissen über den sozialistischen Aufbau auf verschiedenen Gebieten geleistet, die künftig bei einem neuerlichen Anfang von großem Nutzen sein werden. Ein Beispiel: Die Revisionisten benutzten die Stärke der Arbeiterbewegung und des Sozialismus als Argument für die Abschwächung des Klassenkampfes. Zu eben diesem Ziel wurden von der Chruschtschow Mannschaft in der Sowjetunion die Erfolge des sozialistischen Aufbaus gewaltig übertrieben und die Schwierigkeiten bagatellisiert, wie sich am Beispiel der abenteuerlichen Verheißung zeigt, in zehn Jahren den höchsten Lebensstandard der Welt in der Sowjetunion und in zwanzig Jahren den Kommunismus erreicht zu haben. Gegen diese Linie der Kommunismus Verheißung in kürzester Zeit war bereits Molotow aufgetreten. Zu den Anklagen gegen ihn gehörte der Vorwurf, Molotow habe sich gegen die These gewandt, die Sowjetunion befinde sich schon auf dem Wege zum Kommunismus; er habe demgegenüber erklärt, in der Sowjetunion seien gerade erst die Grundlagen des Sozialismus errichtet;[Anmerkung 131] außerdem habe er sich gegen die Feststellung gewandt, dass der Sieg des Sozialismus in der Sowjetunion nicht mehr rückgängig zu machen sei. Das bedeutet, dass Leninisten in der KPdSU wie Molotow sich von der alten Vorstellung befreit hatten, dass mit der Errichtung der Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft sofort der Übergang zum Kommunismus eingeleitet werde, während die Revisionisten an dem wirklichkeitsfremden Geschwätz vom Aufbau des Kommunismus aus demagogischen Gründen festhielten auch noch nach Chruschtschows Sturz. Dagegen wandte sich Walter Ulbricht in einem Vortrag über die Bedeutung des Werkes von Karl Marx für die Schaffung des Systems des Sozialismus auf der internationalen wissenschaftlichen Tagung zum 100. Geburtstag des »Kapitals« im September 1967 in Berlin.[124] In diesem Vortrag fasste Walter Ulbricht die internationalen und die eigenen Erfahrungen beim Aufbau des Sozialismus zusammen und gelangte zu der bisher nirgendwo ausgesprochenen Schlussfolgerung, »dass der Sozialismus nicht eine kurzfristige Übergangsphase in der Entwicklung der Gesellschaft ist, sondern eine relativ selbständige sozialökonomische Formation in der historischen Etappe des Übergangs vom Kapitalismus zum Kommunismus im Weltmaßstab«.[125] Diese Feststellung war ein deutlicher Einspruch gegen das dauernde Gerede in der Sowjetunion von der Nähe der »lichten Höhen des Kommunismus«, und wurde dort auch durchaus so verstanden. Unter der Führung Walter Ulbrichts wurde auch systematisch nach Wegen gesucht, die sozialistische Planwirtschaft auf ein festes wissenschaftliches Fundament zu stellen. Er verlangte und setzte durch, dass die Fachleute der DDR sich mit dem jeweiligen wissenschaftlich-technischen Höchststand in der Welt vertraut machten und Vorschläge erarbeiteten, wie in den sozialistischen Ländern der Rückstand zu diesem höchsten Niveau aufgeholt werden könne.[126] Weil das aber nur in einer kollektiven Anstrengung aller sozialistischen Länder gelingen konnte, gehörte die DDR-Delegation im RGW zu denen, die am meisten und hartnäckigsten darauf drängten, dass der RGW zu einem wirklich effektiven Leitungsorgan einer internationalen planmäßigen Zusammenarbeit aller Mitgliedsländer entwickelt wird.[127] Voraussetzung für einen Erfolg solcher Bemühungen wäre aber gewesen, dass an der Spitze aller kommunistischen Parteien der Mitgliedsländer Marxisten Leninisten, also echte Internationalisten, gestanden hätten. Das aber war leider nicht der Fall. Mit Revisionisten ist kein Sozialismus aufzubauen, mit »Nationalkommunisten« keine internationalistische Zusammenarbeit, mit Saboteuren der Einheit keine Einheit der sozialistischen Staatengemeinschaft. Wie wirkte sich der Wechsel von Ulbricht zu Honecker in der DDR aus? Es ist selbstverständlich, dass Erich Honecker als dem aufrechten Kommunisten und Antifaschisten, dem von der Rachejustiz des siegreichen westdeutschen Imperialismus Verfolgten, unsere ganze Sympathie und Solidarität gehört. Mit Freude haben wir erlebt, dass er sich mit seiner Rede vor Gericht der Tradition eines Karl Liebknecht und Georgi Dimitroff würdig erwies und zum Ankläger derer wurde, die ihn zum Verbrecher und Repräsentanten eines verbrecherischen Regimes stempeln wollten. Nie dachte Honecker daran, die DDR dem Imperialismus auszuliefern. In allem, was er tat, ging es ihm darum, die Existenz der DDR zu sichern. In diesem entscheidenden Punkt stand er Walter Ulbricht zumindest subjektiv nicht nach. Das darf uns jedoch nicht dazu verleiten, auf eine nüchterne, selbstkritische Betrachtung der Entwicklung der SED und der DDR unter Honeckers Führung zu verzichten. Die Ablösung Ulbrichts und der Wechsel zu Honecker war natürlich nicht ohne Einwirkung der Moskauer Führung vor sich gegangen. Dennoch wäre es falsch, in diesem Wechsel etwa den Wechsel von einem Marxisten Leninisten zu einem Revisionisten zu sehen. Es war vielmehr der Wechsel von einem der im Klassenkampf erfahrensten und begabtesten Führer der deutschen und der internationalen kommunistischen Bewegung zu einem von bestem Willen erfüllten, aber infolge schwacher Führungsqualitäten leicht auf Abwege zu führenden Parteifunktionär. Überblickt man die fast zwanzig Jahre, in denen Honecker an der Spitze der SED und des Staates stand, so muss man feststellen, dass er eine Politik repräsentierte, die auf allen Gebieten äußerst widerspruchsvoll war und sich auf einer insgesamt absteigenden Linie bewegte. Letzteres trifft aber auf alle sozialistischen Staaten Europas zu, ist also nicht in erster Linie etwaigen Fehlern der von ihm geleiteten Partei und Staatsführung anzulasten. Bleibt die Frage: War die Niederlage des Sozialismus unvermeidlich? Nein, sie war nicht unvermeidlich, wenn die Marxisten-Leninisten den Vorstoß des Revisionismus im Keime erstickt hätten, also schon bei der Rehabilitierung Titos oder auf dem XX. Parteitag der KPdSU. Allerspätestens hätte bei der Absetzung Chruschtschows 1964 dessen wahre Rolle offengelegt werden müssen. Ja, die Niederlage war unausweichlich, weil den Revisionisten erlaubt wurde, die Parteiführung zu erobern und in ihr zu verbleiben. Denn der Kampf gegen den Imperialismus kann nur erfolgreich geführt werden, wenn dieser im eigenen Lager keine Verbündeten findet. Es wird lange dauern, bis diese Wahrheit wieder Allgemeingut aller Kommunisten geworden sein wird. Es ist unsere Aufgabe, diesen Prozess zu beschleunigen, damit die kommunistische Bewegung wieder eine geschichtsmächtige Kraft wird, noch bevor der Imperialismus die Menschheit in den Untergang getrieben hat.
Norbert Podewin: Ulbricht wünschte keinen Prozess gegen den Bundespräsidenten
Norbert Podewin, Jahrgang 1935, Mechanikerlehre im VEB Narva, später dort und danach im VEB Elektroprojekt Betriebszeitungsredakteur, Fernstudium an der Humboldt Universität, 1965 Abschluss als Diplomhistoriker. Seit 1962 tätig beim Nationalrat der Nationalen Front und Mitautor des 1965 erstmals erschienenen »Braunbuchs der Nazi und Kriegsverbrecher in der BRD und in Westberlin«. Persönlicher Referent beim stellvertretenden Staatsratsvorsitzenden Friedrich Ebert von 1971 bis zum Tode Ulbrichts 1973 und der Wahl Willi Stophs zum Staatsratsvorsitzenden. 1974 Sekretär für internationale Beziehungen im Nationalrat der Nationalen Front, von 1980 bis 1989 Mitglied des Präsidiums. Seit 1990 als Publizist aktiv. Ende des Jahres 1961 erreichte mich eine Einladung des Nationalrates der Nationalen Front des demokratischen Deutschland. Ich solle zu einem Gespräch kommen. Meine Verbindung mit der Nationalen Front beschränkte sich bis dahin darauf, dass ich bei Wahlen deren Kandidaten wählte. Im Gebäude des Nationalrats, bis zum Untergang des »Dritten Reiches« Amtssitz des NS-Propagandaministers Joseph Goebbels, empfing mich Gerhard Dengler. Er stellte sich als Verantwortlicher des im Aufbau befindlichen Westbereichs im Nationalrat vor. Den zweiten Teilnehmer stellte er knapp so vor: »Den Genossen Albert Norden kennst du ja wohl.« Ich kannte seinen Namen aus den Medien und wusste von ihm, dass er ein unerbittlichen Nazi-Jäger und für den »Ausschuss für deutsche Einheit« zuständig war. Das Gremium war 1954 auf Beschluss des Ministerrates gebildet worden und sollte als staatliche Institution alle mit der Vorbereitung der Wiedervereinigung und dem Abschluss eines Friedensvertrages zusammenhängenden Fragen behandeln. Dieser Ausschuss sei aufgelöst, sagte Dengler, aber sein Archiv und mehrere Mitarbeiter stünden nunmehr dem Westbereich des Nationalrates zur Verfügung. Dort solle ich künftig mitwirken. Das Angebot war in mehrfacher Hinsicht verlockend und bedurfte keiner Bedenkzeit. Doch ich wollte wissen, wie man ausgerechnet auf mich gekommen sei? Albert Norden reagierte darauf. »Im RIAS gibt es die Sendung ›Aus der Zone für die Zone‹, und die zitieren immer den Impuls als kritisches Organ. Da dachten wir, dass an dem Redakteur etwas dran sein muss!« Die für Agitation zuständige Verantwortliche in der SED-Kreisleitung Lichtenberg hatte mich dafür wiederholt abgemahnt. Hier sah man das offenkundig anders. Am neuen Arbeitsplatz Nationalrat stand seit Jahresbeginn 1962 für sämtliche Mitarbeiter ein Großeinsatz an: Vorbereitung des Nationalkongresses am 16./17. Juni in Berlin. Walter Ulbricht hatte diesen Termin bewusst gewählt – in der BRD und der Weststadt Berlin war der 17. Juni Staatsfeiertag. Die DDR wollte, anders als dort, keine Tränen vergießen, sondern demonstrativ über die Perspektiven der deutsch deutschen Beziehungen reden. Im Nationalrat listeten wir nochmals Fakten über diese Problematik auf. Das war die Fortsetzung der sowjetischen und der DDR-Angebote in den letzten zehn Jahren:
• 10. März 1952: Vorschlag der UdSSR mit einem Friedensvertrag-Entwurf für ein souveränes, neutrales einheitliches Deutschland;
• 3. Februar 1954: Angebot der DDR an die BRD, in beiden deutschen Staaten eine Volksabstimmung über den Generalvertrag zu einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) oder einen Friedensvertrag abzuhalten;
• 4. September 1958: DDR Appell an die vier Siegermächte, Friedensvertragsverhandlungen unter Einbeziehung von BRD und DDR zu führen;
• 10. November 1958: sowjetische Deutschland Vorschläge über einen Friedensvertrag und die Regelung der Westberlin Problematik;
• 4. August 1961: Vorschlag des Magistrats von Groß-Berlin an den Senat von Berlin/West zur Regelung der Grenzgänger Frage;
• 23. August 1961: Eröffnung von Passierscheinstellen auf den S-Bahnhöfen Zoologischer Garten/Charlottenburg (Hoheitsgebiet der DDR Reichsbahn), die wenig später von der Polizei Berlin/West widerrechtlich geschlossen wurden. Im Vorfeld des Nationalkongresses beriet die 15. Tagung des ZK der SED vom 21. bis 23. März 1962 das Dokument »Die geschichtliche Aufgabe der DDR und die Zukunft Deutschlands«, das anschließend dem Nationalrat übergeben wurde. Dieser übernahm den Text als Entwurf und publizierte ihn republikweit. Alle Ausschüsse waren aufgefordert, auf örtlicher Ebene mit den Bürgern darüber zu diskutieren und Änderungsvorschläge aufzunehmen. Zugleich wandte sich der Nationalrat an alle Bürger der Bundesrepublik und Westberlins, sich an der Debatte zu beteiligen. Wir Mitarbeiter waren verantwortlich für den Ablauf der Tagung – sie fand im Festsaal des Hauses der Ministerien am 25. März statt. Dort erlebte ich erstmals Walter Ulbricht persönlich. Seine Rede war emotional geprägt. Er wandte sich darin »an alle Bürger der Deutschen Demokratischen Republik! An die ganze deutsche Nation!« und skizzierte prägnant den Lauf der deutschen Geschichte seit Beginn der organisierten Arbeiterbewegung. Den Schwerpunkt aber legte Ulbricht auf die Chancen nach der Zerschlagung des Faschismus, die nicht genutzt worden waren. Gleichwohl hielt er an der Einheit Deutschlands fest, die für ihn aber nur sozialistisch sein konnte. Ulbricht verwies auf den Text des Nationaldokuments. »Unser Ziel ist es, den Frieden zu erhalten, die Geschicke der Nation zum Guten zu wenden und das ganze Deutschland zu neuer Blüte zu führen.« Mich überraschte, dass Walter Ulbricht sich dabei auf Goethe berief und aus dem »Faust« zitierte: »Solch ein Gewimmel möcht’ ich sehn, auf freiem Grund mit freiem Volke stehn! Zum Augenblicke dürft ich sagen: Verweile doch, du bist so schön! … Im Vorgefühl von solchem hohen Glück, genieß ich jetzt den höchsten Augenblick.« »Der Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik und die Vereinigung des ganzen deutschen Volkes in einem einheitlichen, friedliebenden, demokratischen und sozialistischen Staat wird diesen dritten Teil des ›Faust‹ abschließen. Und dieses Schlusskapitel, liebe Genossen und Freunde und liebe Gäste aus Westdeutschland, werden die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik und die Bürger der westdeutschen Bundesrepublik – brüderlich vereint gemeinsam gestalten.« Der Tagung schloss sich eine dreimonatige Volksaussprache an, es gab auch zustimmende Wortmeldungen aus der Bundesrepublik. Am 16. Juni 1962 trat der Nationalkongress der Nationalen Front in der Dynamo-Sporthalle zusammen. Neben 2.332 gewählten Delegierten waren etwa 350 Gäste aus der Bundesrepublik und Westberlin erschienen. Eingangs rezitierte Wolfgang Langhoff, Intendant des Deutschen Theaters und einst Häftling im KZ Börgermoor, Johannes R. Bechers »Die geschichtliche Heimat des Deutschen«. Es waren Worte, die tief berührten. Nationalrats-Präsident Erich Correns berichtete über die Diskussion des Dokuments, dem Millionen zugestimmt hatten. Dann sprachen der Wissenschaftler Manfred von Ardenne, der Thüringer Landesbischof Moritz Mitzenheim, der Schriftsteller Willy Bredel, der Gewerkschaftsfunktionär Kurt Feustel aus der BRD und Vertreter aus DDR-Betrieben. Sie alle bekundeten auf die eine oder andere Weise: Das Nationale Dokument zeigt die Perspektive eines deutsch-deutschen Miteinanders. Walter Ulbricht und Ministerpräsident Otto Grotewohl im Präsidium zeigten sich zufrieden Ich war Mitarbeiter der Redaktionsgruppe. In einer Tagungspause beriet diese, wie die noch immer eingehenden Änderungsvorschläge behandelt werden sollten. Ich argumentierte temperamentvoll gegen einen Vorschlag, als sich hinter meinem Rücken die Tür öffnete. Walter Ulbricht setzte sich zu uns. »Lasst euch nicht stören.« Die Runde aber blieb trotz der Aufforderung stumm, auch ich setzte meine Rede nicht fort. Ulbricht meinte: »Der junge Genosse hatte doch ein Problem, ja. Also, was war es?« Ich legte meinen Vorschlag erneut dar. Niemand reagierte. Bis auf Ulbricht. »Klingt doch vernünftig, was der junge Genosse vorschlägt.« Das sahen nun plötzlich alle anderen auch so. In der Folgezeit – ich greife vor sollte ich wiederholt mit Ulbricht zusammentreffen. Als Mitarbeiter Albert Nordens saß ich in der Arbeitsgruppe, die in Sachen Kriegs- und Naziverbrecher recherchierte. In Erinnerung an diese Begegnung begrüßte mich Ulbricht stets mit der Formel: »Ah, der junge Genosse.« Die Delegierten des Nationalkongresses verabschiedeten am Nachmittag des 17. Juni 1962 einstimmig das Nationale Dokument, das auf eine deutsch-deutsche Konföderation zielte. »Besonders wichtig wäre es« so die Kernaussage – »im Rahmen einer solchen Konföderation den Frieden für das deutsche Volk in der ganzen Übergangsperiode zu sichern. Die beiden deutschen Staaten – in einer Konföderation miteinander verbunden brauchten keine Rüstung. Die Konföderation könnte die vollständige Abrüstung in Deutschland, das Verbot von Atom- und Kernwaffen auf deutschem Boden, die Neutralität der deutschen Staaten vereinbaren. Es könnte sofort begonnen werden, ein Minimum an guten, anständigen und soliden Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten herbeizuführen.« Bekannlich erwies sich diese Überlegung als nicht realisierbar. Die nationalen wie die internationalen Klassenverhältnisse standen dem entgegen. Bei der Aufarbeitung der Nazivergangenheit rückte in jener Zeit immer mehr Bundespräsident Heinrich Lübke in den Fokus. Er amtierte seit 1959. Wir hatten ermittelt, dass er von 1939 bis Kriegsende als Vermessungsingenieur und Bauleiter beim Architektur- und Ingenieurbüro Walter Schlempp tätig gewesen war. Dieses unterstand Albert Speer, Hitlers Intimus und Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Lübkes Unterschrift fand sich unter Bauzeichnungen für Baracken, in denen KZ-Sklaven untergebracht waren, und von 1943 bis 1945 trug er als Bauleiter der Heeresversuchsanstalt Peenemünde Verantwortung für den Einsatz von KZ Häftlingen. So stand es auch in dem 1965 erstmals erschienenen Braunbuch. Albert Norden verwies bei der Vorstellung der Dokumentation auf entsprechende Belege und bot der BRD Akteneinsicht an, damit die natürlich frisierte offizielle Biografie des Bundespräsidenten der Realität angepasst werden könnte. Albert Norden nannte auf der Pressekonferenz im Sommer 1965 Lübke einen »KZ-Baumeister« und fragte rhetorisch, wie sich diese Vergangenheit mit dem Anspruch der BRD vereinbaren ließe, ein demokratischer Rechtsstaat zu sein. Im Westen wurde, wie nicht anders zu erwarten, abgewiegelt. Ende 1965 kam aus dem Bezirk Halle eine Meldung. Ein Mann hatte auf dem Dachboden seines Hauses im Nachlass seiner Eltern etliche Dokumente gefunden, aus denen hervorging, dass ein Oberingenieur Heinrich Lübke 1944 verantwortlich war für den Bau unterinterirdischer Produktionsstätten im Rahmen des »Jägerprogramms«. In stillgelegten Salzschächten sollten Flugzeugrümpfe bombensicher produziert werden. In einem Protokoll vom 5. September 1944 waren sowohl die Anwesenheit des Dipl.-Ingenieurs Lübke als auch sein Auftrag fixiert worden: »Festgelegt wurde, dass das Lager unterteilt wird für a) 1.000 KZ Männer, b) 1.000 KZ-Frauen, c) 500 Ausländer. Eine Holzbaracke war bereits erstellt, drei weitere werden im Laufe der Woche stehen.« Norden bot Bonn neuerlich Akteneinsicht an. Von dort kam umgehend eine Absage. Im September 1967 ersuchte jedoch die Bayerische Staatskanzlei per Fernschreiben beim Präsidium der Berliner Volkspolizei um die Lübke Dokumente. Im Büro Albert Norden war man sich unschlüssig: War das Interesse echt, oder handelte es sich um eine Provokation? Ich erhielt den Auftrag, nach München zu fahren und Kopien der von der Rechtsanwaltskanzlei Friedrich Karl Kaul notariell beglaubigten Lübke Dokumente zu übergeben. Horst Brasch, Vizepräsident des Nationalrats, überließ mir seinen Dienstwagen, einen Tatra 603. Am Grenzübergang forderten mich die Beamten des Bundesgrenzschutzes auf, das Aktenpaket zu öffnen. Ich verweigerte dies mit dem Hinweis auf den Empfänger: »Bayerische Staatskanzlei München«. Ich musste einige Zeit warten. Offenkundig wurde hin und her telefoniert, ehe man mir erklärte, ich könne mit dem ungeöffneten Paket weiterfahren. In München erregte mein schwarzer Tatra einiges Erstaunen, einen solchen Wagen und mit einem solchen Kennzeichen hatte man dort noch nicht gesehen. Im Sekretariat der Staatskanzlei wurde ich freundlich empfangen, ein Beamter dankte für die Zustellung der erbetenen Sendung. Allerdings hatte er Mühe, mir eine Eingangsbestätigung auszufertigen, denn er weigerte sich hartnäckig, darin die Herkunft »Deutsche Demokratische Republik« unterzubringen, worauf ich ebenso beharrlich bestand. Schließlich einigten wir uns auf die Formel, dass es sich um Dokumente aus dem Bestand des Nationalrates der Nationalen Front des demokratischen Deutschland handelte, und setzen die Berliner Anschrift der DDR-Institution hinzu. Die Gründe des bayerischen Ersuchens blieben im Dunkeln, doch wir vermuteten, dass dahinter der CSU Vorsitzende Franz Josef Strauß steckte, seit dem Vorjahr Bundesfinanzminister der Großen Koalition in Bonn. Aus seiner Abneigung gegenüber Heinrich Lübke hatte er kein Hehl gemacht. Vielleicht wollte er sich Munition verschaffen, um ihn »abzuschießen«. Für mich war das Resultat der Dienstreise mager, für Norden nicht. Er wähnte nunmehr den Weg frei für einen Prozess vor dem Obersten Gericht der DDR. 1960 hatte man dort gegen den Bundesvertriebenenminister Theodor Oberländer und 1963 gegen Staatssekretär Hans Globke verhandelt und beide in Abwesenheit zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt, jetzt sollte der Bundespräsident auf die Anklagebank gesetzt werden. Für einen solchen »Schauprozess« Albert Norden benutzte diesen Begriff offensiv: die Welt sollte zuschauen brauchten wir allerhöchste Zustimmung. Im Oktober 1967 bat uns Walter Ulbricht zu sich. Er begrüßte uns freundlich. »Ah, der junge Genosse.« Albert Norden sprach sich für einen Prozess aus, dann trug ich etwa zwanzig Minuten vor und redet leidenschaftlich über den Wert der aufgefundenen Unterlagen. Ulbricht dankte, überlegte kurz und sprach dann den für uns überraschenden Satz: »Also, Genossen, das lassen wir mal besser!« Und er begründete auch seine Zurückhaltung. Dabei hatte er weniger die Person Lübke im Auge, sondern mehr die mitregierende SPD. Sie müsste sich zwangsläufig und vielleicht gegen ihre Überzeugung schützend vor ihr Staatsoberhaupt stellen, wenn aus der DDR auf dieses juristisch gefeuert würde. Das gebiete die Staatsräson. Auf diese Weise aber würden wir auch Vizekanzler Willy Brandt und die Partei beschädigen, was er nicht gutheißen könne. Deshalb schien es ihm politisch vernünftiger, kein Verfahren wie bei Globke und Oberländer zu führen. »Macht eine neue Auflage des Braunbuches und gut.« Lübke gab im Oktober 1968 entnervt auf und kündigte an, aus »gesundheitlichen Gründen« für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung zu stehen. Die von den BRD-Medien geführte »KZ-Baumeister-Kampagne«, wie es intern hieß, hatte ihn zu diesem Schritt veranlasst. Ulbrichts Entscheidung erwies sich als richtig. Auch ohne Prozess hatten wir unser Ziel erreicht.
Loni Günther: Brief an Ollenhauer und Ulbrichts Kampf für die deutsche Einheit
Loni Günther, Jahrgang 1928, 1946 SED, Leiterin der Abteilung Frauen in der Landesleitung Thüringen der SED, von 1950 bis 1952 Abgeordnete des Thüringer Landtages. Von 1953 bis 1966 Mitarbeiterin bzw. Stellvertretende Leiterin der Abteilung Agitation des ZK der SED, danach bis 1989 Sekretär der Bezirksleitung der SED Suhl. Als 19-jährige Genossin erlebte ich ihn erstmals am 9. November 1947 im »Henneberger Haus« in Suhl. Dort hatte schon Karl Liebknecht im September 1911 gesprochen. Die örtliche Presse vermerkte, dass in Ulbrichts Ausführungen wirtschaftspolitische Fragen im Mittelpunkt gestanden hätten. Uns junge Leute hingegen interessierte mehr, was er über uns, die junge Generation, und unsere Perspektiven sagte. Ulbrichts Rede inspirierte mich derart, das ich schwankte, ob ich nun Neulehrer werden sollte, um Kinder an die neue Zeit heranzuführen, oder ob ich mich zum Volksrichter ausbilden ließe, um mit der alten Zeit abzurechnen und Nazi- und Kriegsverbrecher einer gerechten Strafe zuzuführen. Aber erstens kam es anders, und zweitens als man denkt, wie man sagt. Ich machte darin keine Ausnahme. Mitte der 60er Jahre, es war Hochsommer und an einem Samstag, an welchem damals bis Mittag noch gearbeitet werden musste, erreichte mich ein Anruf meines Chefs. Ob ich mal rasch zu ihm kommen könne? Ich eilte also spornstreichs über die langen Flure zu Otto Funke, dem 1. Sekretär der Bezirksleitung Suhl, und marterte mein Hirn, was ich möglicherweise versäumt oder falsch gemacht hatte, denn das ist gewiss die Erfahrung aller, die jemals im Parteiapparat oder in einer Parteizeitung gearbeitet haben: Wenn der Erste nach einem rief, gab es meist dicke Luft. Wir hatten im Freien Wort, dem Organ der Bezirksleitung, zu einer öffentlichen Diskussion aufgerufen. Die Leser sollten ihre Meinung zu kommunalpolitischen Problemen mitteilen, schreiben, wo sie der Schuh drückte. Die Aktion hieß bezeichnenderweise »Pitt Stöber«. Hatte Funke in den publizierten Leserbriefen etwas aufgestöbert, was ihm in die Nase stach? War ihm etwas zu Ohren gekommen, was nicht im Sinne der Partei war? Weit gefehlt. Meine Sorgen liefen völlig fehl. »Wir möchten, dass du heute Nachmittag Genossen Walter Ulbricht und seine Frau Lotte bei einem Besuch des Naturtheaters Steinbach-Langenbach begleitest. Deinen Mann Alwin musst du natürlich auch mitnehmen.« Wir hätten sicher viel Gesprächsstoff, sagte Funke, über die FDGB-Arbeit und über den Bau des Suhler Gewerkschaftshauses, das Ulbricht ganz offensichtlich am Herzen läge … Für mich schien diese Aufgabe eine Nummer zu groß. Was konnte ich dem ersten Mann unserer Partei und Staatsratsvorsitzenden erzählen? »Otto, das geht nicht. Wer holt meine Tochter aus dem Kindergarten, wer kümmert sich um sie, bis wir zurück sind?« »Mach dir keine Sorgen, das macht Friedel, meine Frau.« Auf dem Weg von Suhl nach Oberhof, wo ich in der Pension »Haus am Waldesrand« unweit des Kanzlersgrundes die beiden abholen sollte, erinnerte ich mich der verschiedenen Begegnungen mit Ulbricht. Da war insbesondere jene kurze Arbeitsbesprechung Mitte Februar 1954, als ich gemeinsam mit Willi Bamberger, stellvertretender Chefredakteur der Einheit, zu ihm einbestellt wurde. Er informierte uns über ein Schreiben, gerichtet an den Parteivorstand der SPD und die Mitglieder dieser Partei. Darin wurden die sozialdemokratischen Genossen aufgefordert, gemeinsam mit der KPD und dem DGB die aktuellen Vorschläge zur Lösung der deutschen Frage zu unterstützen und einen Vertrag über kollektive Sicherheit in Europa zu beraten. Das Schreiben des Zentralkomitees war, wie uns Ulbricht erläuterte, eine unmittelbare Reaktion auf die Konferenz der Außenminister der vier Mächte, die seit dem 25. Januar in Berlin lief und bisher nichts gebracht hatte (sie sollte am 18. Februar ergebnislos enden). Dabei ging es im weitesten Sinne um die Aktionseinheit der Kräfte für die Wiedervereinigung. Im Vorfeld der Tagung war vom Ministerrat der DDR der »Ausschuss für deutsche Einheit« gebildet worden. Und andererseits war es ein Versuch, die Remilitarisierung der Bundesrepublik aufzuhalten. In wenigen Tagen wollte der Bundestag ein Wehrverfassungsgesetz beschließen, das den Weg freimachen sollte für die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Ich greife vor: Dieses Gesetz und die damit verbundene Änderung des Grundgesetzes passierten am 26. Februar den Bundestag und am 19. März den Bundesrat. Die Westmächte in Gestalt der Alliierten Hochkommission hatten zwar die Einschränkung gemacht, dass dieses Gesetz erst in Kraft treten dürfe, wenn die Europäische Verteidigungsgemeinschaft (EVG) gegründet sei, aber das war nur Schattenboxen. Diese westeuropäische Armee mit deutscher Beteiligung sollte im Sommer 1954 in der französischen Nationalversammlung scheitern, weil man dort noch sehr gut die deutsche Besatzung in Erinnerung hatte, die erst zehn Jahre zuvor geendet hatte. Daraufhin nahm man die Bundesrepublik in den Nordatlantikpakt auf, womit erkennbar wurde, was der vermeintliche Vorbehalt der Westmächte im Früjahr 1954 wert gewesen war: nämlich nichts. Ulbricht erläuterte uns die taktischen und strategischen Zusammenhänge der Politik des Westens und seine eigenen Überlegungen, wie darauf zu reagieren sei, das mir, gerade erst 25 Jahre alt, die Ohren glühten. Für mich war erkennbar: Ulbrichts Perspektive war die eines deutschen Politikers, der das ganze Deutschland im Blick hatte. Er fühlte sich für alle Deutschen verantwortlich und wollte die Zementierung der Spaltung verhindern, die zwangsläufig stattfinden würde, wenn die Bundesrepublik in ein westliches Militärbündnis eingebunden werden würde. Das wollte er mit allen friedliebenden, demokratischen Kräften in Deutschland verhindern. Darum hoffte er auf Unterstützung auch der SPD. Die wurde seit dem Tod des Antikommunisten Schumacher seit etwa anderthalb Jahren von Erich Ollenhauer geführt, der vor wenigen Monaten bei den Bundestagswahlen als Kanzlerkandidat seiner Partei mit 28,8 Prozent gescheitert war. Aber: Er war in den Wahlkampf mit dem klaren oppositionellen Gestus gezogen, der sich gegen die Adenauer-Linie richtete: Nein zur Westintegration, Ja zur Wiedervereinigung. Daran wollte Ulbricht nun anknüpfen. Das Schreiben, dessen Inhalt eindeutig Ulbrichts Handschrift trug, sollten wir in die SPD-Zentrale bringen, die gemeinhin »Bonner Baracke« hieß. Die Bundesparteizentrale war ein barackenähnliches Gebäude an der Friedrich-Ebert-Allee, das die SPD zu Beginn der 50er Jahre angemietet hatte, um bewusst das Provisorische zu unterstreichen. Nach der Wiedervereinigung, von der die Partei ausging, wollte der Vorstand die Zentrale sofort in die alte und neue Hauptstadt verlegen, nach Berlin. Und warum hatte Ulbricht uns beide für die Mission ausgewählt? Ich konnte mir das nur so erklären, weil in der Baracke auch die Redaktion des Vorwärts arbeitete, Bamberger und Günther besuchten gleichsam Kollegen. Doch bis zur Redaktion kamen wir erst gar nicht. Ein Zerberus am Eingang der SPD-Zentrale, der hinter einem Schreibtisch wie ein Palastwächter thronte, ließ uns nicht ein und verweigerte auch die Annahme unseres Briefes. Daraufhin legten wir den Briefumschlag auf den Tisch und gingen. Der Mann griff wütend den Umschlag und warf ihn uns hinterher. Am 19. Februar 1954 veröffentlichte das Neue Deutschland den Wortlaut dieses Schreibens, dessen Annahme zwei Tage zuvor in der SPD-Zentrale verweigert worden war. Am 7. April, keine sieben Wochen nach Ulbrichts Angebot, lehnte auf Antrag der Adenauer-Regierung der Deutsche Bundestag die Anerkennung der Deutschen Demokratischen Republik– deren Bezeichnung man grundsätzlich nicht benutzte, sondern abwertend nur von »Ostzone« oder »Pankow« sprach ab und beschloss den Alleinvertretungsanspruch für alle Deutschen. Ein Staatssekretär namens Hallstein sollte bald diese Position in eine Doktrin kleiden, die auch Sanktionen gegen Drittstaaten enthielt, welche gegen diese westdeutsche Anmaßung handelten und Beziehungen zur DDR aufnahmen. Erst die SPD geführte Regierung unter Willy Brandt sollte 1969 diesen Anachronismus beenden. In seiner ersten Regierungserklärung sprach der Bundeskanzler von zwei Staaten in Deutschland, womit er die sogenannte Zweistaatentheorie aufgriff, mit der Ulbricht und Chruschtschow 1954 auf den Bonner Alleinvertretungsanspruch reagiert hatten. Der sowjetische Generalsekretär erklärte damals, bei seinem Besuch in Berlin am 26. Juli 1955: Auf dem Territorium des vor zehn Jahren untergegangenen Deutschen Reiches sind zwei souveräne deutsche Staaten entstanden. Eine Wiedervereinigung sei darum allein Sache der Deutschen und setze zunächst eine Annäherung von DDR und BRD voraus, wobei die sozialistischen Errungenschaften der DDR gewahrt bleiben müssten … Wir hatten auf der Fahrt zur Naturbühne von Steinbach-Langenbach Gesprächsstoff. Walter Ulbricht konnte sich an diese Mission vor zehn Jahren durchaus erinnern, er reflektierte lebhaft unsere damalige Begegnung und die danach einsetzende Entwicklung, die nicht im Interesse der meisten Deutschen in West und Ost lag. Die Bühne in der Schlucht am Heubachweg war in den 50er Jahren in freiwilligen Arbeitseinsätzen der Thüringer entstanden, auch die dort stationierten Sowjetsoldaten hatten dabei mit Hand angelegt, weshalb sie auch »Naturbühne Deutsch-Sowjetische Freundschaft« hieß. Im Rahmen des Nationalen Aufbauwerkes (NAW) war Thüringens größtes Theater im Grünen entstanden. Walter und Lotte Ulbricht wurden am Eingang von den örtlichen Honoratioren herzlich begrüßt und zu den – zugegeben: etwas unbequemen – Bänken geleitet. Wir sahen, mit schmerzenden Gesäßen, Millöckers »Bettelstudent«, eine Operette in drei Akten. Nach der Vorstellung gab es noch zwanglose Gespräche mit den Schauspielern vom Meininger Theater, das 35 Spielzeiten lang, bis 1991, diese Bühne bespielen sollte.
Günter Tschirschwitz: Der erste Staatsbesuch in Prag
Günter Tschirschwitz, Jahrgang 1930, Sohn schlesischer Landarbeiter, trat im März 1949 in die Deutsche Volkspolizei ein. Nach Bildung des Ministeriums für Staatssicherheit kam er zum Personenschutz. Dort war er bis in die 80er Jahre tätig. Er begleitete wiederholt Walter Ulbricht auch auf Reisen ins Ausland. In seinen letzten Dienstjahren leitete er die Arbeitsgruppe »Betreuung« des MfS. Er schied als Oberstleutnant am 28. Februar 1990 aus den bewaffneten Organen aus. Wann und warum kamst du zum Personenschutz? Ich hatte mich im Frühjahr 1951 für einen Besuch an der VP-Offiziersschule beworben. Im Sommer wurde ich nach Berlin kommandiert, als dort die III. Weltfestspiele der Jugend und Studenten stattfanden. Dort meldete ich mich, wie befohlen, in der Hauptverwaltung für Ausbildung (HVA) in Adlershof, die mich gleich weiter nach Lichtenberg in die Normannenstraße schickten. Da erwarteten mich der Kaderleiter und sein Stellvertreter, Chefinspekteur Erich Wichert, und Inspekteur Richard Bein. Sie meinten, mit meinen 1,83 Meter sei ich für den Personenschutz geeignet. Ohne zu wissen, was das bedeutete, stimmte ich zu und wurde umgehend zum Hauptwachtmeister befördert. Am Nachmittag begleitete mich ein Mitarbeiter in die Freiwalder Straße in Hohenschönhausen und stellte mich Chefinspekteur Franz Gold vor, das war der Leiter der Abteilung PS. In den ersten Monaten arbeitete ich im Sekretariat des Leiters, wurde aber alsbald auch zu Sicherungs-Einsätzen abgestellt. Mein erster größerer Einsatz erfolgte im Oktober 1951. Die Fahrt nach Prag war deine erste Auslandsreise. Erzähl mal. Es handelte sich um den ersten DDR Staatsbesuch in der Tschechoslowakei. Präsident Klement Gottwald hatte unseren Präsidenten Wilhelm Pieck eingeladen, in dessen Begleitung befand sich auch Walter Ulbricht. Wir reisten mit dem Regierungszug. Dabei gab es zwei Vorkommnisse leichterer Art. Als wir die Sächsische Schweiz passierten, fing das Fahrgestell des Salonwagens mörderisch an zu quietschen. Offenkundig waren die Lager nicht ausreichend gefettet worden. Das hatte dann ein Nachspiel. Aber offen gestanden: Der Einzige, der sich wirklich darüber erregte, war mein Chef Franz Gold. Und die zweite Panne: Walter Ulbricht suchte die Toilette auf, bekam aber die Tür nicht geöffnet. »Genosse Generalsekretär«, sagte ich beflissen, »kann ich helfen?« Er winkte ab. »Lass mal, ich bin Tischler. Ich weiß, wie man mit verquollenem Holz umgeht!« Ulbricht schlug mit seinen großen Händen an zwei, drei Stellen gegen die sperrende Tür, ein kräftiger Ruck – und schon öffnete sie sich. Und Prag. Was geschah dort? Insgesamt waren wir zwölf Personenschützer, sechs gehörten zum Sicherungskommando – da war ich mit dabei – und die anderen zum Objektkommando. Das sicherte das schlossähnliche Gebäude, in welchem die Delegation untergebracht war. War diese unterwegs, fuhr ein Wagen von uns als Vorauskommando vorweg, den Schluss des Konvois bildete unser Nachkommando. Es gab etliche Termine auf dem Hradschin, Begegnungen mit Werktätigen, Kranzniederlegungen, Empfänge und andere protokollarische Verpflichtungen. Was war für dich das Aufregendste dabei? Ganz ehrlich? Selbstverständlich. Die Verpflegung. Sechs Jahre nach dem Krieg gab es noch nicht viel zu essen, die Lebensmittel waren rationiert und wurden nur auf Karte abgegeben. Die tschechoslowakischen Gastgeber versorgten uns, wir fühlten uns – wie man so sagt – wie Gott in Frankreich. Bei der Abreise erhielt jeder Personenschützer von den Pragern ein paar Schuhe und einen Mantel geschenkt. Wir waren ihnen unendlich dankbar. Wann bist du Ulbricht wieder begegnet? Keine fünf Wochen später. Am 8. Dezember 1951 wurde mit einem Staatsakt im Admiralspalast die Deutsche Bauakademie eröffnet. Ich war in der Loge mit Präsident Pieck, Walter Ulbricht und Berlins Oberbürgermeister Friedrich Ebert sowie dem Akademie Präsidenten Kurt Liebknecht. Der Architekt war der Enkel von Wilhelm Liebknecht und Neffe Karl Liebknechts. Er sollte zehn Jahre der Einrichtung vorstehen, die bis 1973 in der Hannoverschen Straße saß. Dann zog dort die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland ein. Heute ist es der zweite Dienstsitz des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, der erste befindet sich unverändert in Bonn.
Heinz Eichler: Äußerst korrekt und mit einem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn
Heinz Eichler, Jahrgang 1927, kommunistisches Elternhaus, Vater Kämpfer gegen den Faschismus, kaufmännische Lehre bis zur Einberufung zum Reichsarbeitsdienst, kurzzeitig US-Kriegsgefangenschaft, 1945 KPD, 1946 SED, 1946/47 Besuch der Arbeiter-und-Bauern-Fakultät, von 1947 bis 1950 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Leipzig, Diplomwirtschaftler, von 1950 bis 1956 Mitarbeiter im Sekretariat Ulbricht, danach, bis 1960, Studium an der Parteihochschule in Moskau, anschließend persönlicher Referent des Vorsitzenden des Staatsrates, von 1971 bis 1990 Sekretär des Staatsrates und Mitglied des Präsidiums der Volkskammer. Du kanntest Walter Ulbricht bereits, als er Erster Stellvertreter von Ministerpräsident Otto Grotewohl war. Bis zu seinem Tod warst du sein persönlicher Referent bzw. Sekretär des Staatsrates. Wie war er als Chef? Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich klarstellen, dass es sich ausschließlich um meine persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen handelt, die ich hier wiedergebe. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die andere Auffassungen vertreten und andere persönliche Erlebnisse mit dem Namen Walter Ulbricht verbinden. Aber zur Frage, wie er als Chef war: äußerst korrekt. Er hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Mir imponierte, dass er es verstand, Details immer in einen entsprechenden gesellschaftlichen Zusammenhang zu stellen. Seine Aufgabenstellungen waren konkret. Persönlich bin ich ihm erstmals im Februar 1951 begegnet. Otto Gotsche, damals Leiter seines Sekretariats, stellte mich ihm vor. Ich habe Eingaben aus der Industrie und Landwirtschaft bearbeitet. Vorschläge und Kritiken aus der Bevölkerung nahm er sehr ernst. Hattest du auch Begegnungen außerhalb der Arbeit mit ihm? 1960 weilte ich mit meiner Frau auf eigene Kosten zu einer Kur auf der Krim. Eines Tages rief mich sein Dolmetscher Werner Eberlein an und holte mich ab. Walter Ulbricht, der sich ebenfalls auf der Krim befand,wollte mich sehen. Er interessierte sich für die Lebenslage der Sowjetbürger. Zum Schluss unserer Unterredung verabschiedete er mich mit den Worten: »Alles Gute, beste Gesundheit und Erfolg in deinem Studium und auf ein Wiedersehen in Berlin.« Damit war für mich klar, wo ich nach meinem Studium arbeiten würde. Man sagt, Ulbricht ging mit dem vertraulichen »Du« sehr sparsam um. Wie war das in eurem Verhältnis? Mich sprach er, wie das in der SED üblich war, mit »Du« an. Ich sagte »Genosse Walter« zu ihm. Wie war das persönliche Verhältnis zwischen Regierungschef Grotewohl und seinem Ersten Stellvertreter? Bedenkt man, dass beide aus unterschiedlichen Strömungen der Arbeiterbewegung kamen, sie wegen ihres Beitrages zur Vereinigung von KPD und SPD zur SED unter permanenter Kritik aus dem Westen standen und selbst einem maßlosen Arbeitsdruck unterlagen, dann kann man nur bewundern, mit welch gegenseitigem Respekt sie sich begegneten. Grotewohl war mehr der Schöngeist, Ulbricht der Praktiker. Beide ergänzten sich hervorragend. Ihnen waren die Interessen der Werktätigen wichtigstes Anliegen. Wie kam es zur Gründung des Staatsrats? Nach dem Tod von Präsident Wilhelm Pieck 1960 wurde der Staatsrat durch Verfassungsänderung in der Volkskammer beschlossen. Faktisch war er das kollektive Staatsoberhaupt der Republik. In ihm waren die Repräsentanten aller Parteien und Massenorganisationen vertreten. Insofern war er eine große staatliche Koalition aller antifaschistisch demokratischen Kräfte der DDR. Interessant ist für mich noch heute die politische Begründung. Das Gesetz zur Bildung des Staatsrates begann so: »Getragen von der großen Verantwortung für die Erhaltung des Friedens, für die sozialistische Zukunft der Deutschen Demokratischen Republik, zur weiteren Festigung und Entwicklung der sozialistischen Gesellschaftsordnung und zur Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender, demokratischer und einheitlicher Staat wird die Bildung des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik beschlossen.« Präsident Wilhelm Pieck ist in der Erinnerung vieler wegen seiner gütigen, väterlichen Art haften geblieben. Ulbricht hatte es als Staatsratsvorsitzender schwer, sich diese Anerkennung zu erarbeiten. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung? Rundfunk und später auch Fernsehen waren ja grenzüberschreitend. Die westlichen Medien taten alles, um Ulbricht zu diskreditieren. Als Vorwand nutzten sie Äußerlichkeiten, etwa seine krankheitsbedingte hohe Stimme und seinen starken sächsischen Dialekt. Tatsächlich griffen sie aber seine Politik an. Sie wussten, dass er strategisch dachte und handelte, was gut für die DDR und den Sozialismus war. Von der Bevölkerung wurde Ulbricht nach meiner Wahrnehmung zunehmend als Landesvater anerkannt. Du hast ihn bei Auslandsreisen begleitet. Wie verhandelte er? Walter Ulbricht konnte sehr diplomatisch sein, aber auch sehr direkt, wenn es um die Interessen der DDR ging. Er war stets gut vorbereitet und informierte sich vorher über die konkreten Probleme zwischen der DDR und dem jeweiligen Besuchsland. Das galt ins besondere für die RGW-Länder. Du hast ihn auf zwei Reisen begleitet, die damals Aufsehen erregten: 1965 nach Ägypten, 1964 nach Jugoslawien. Wie kam er mit Präsident Nasser klar? Es hat mich beeindruckt, wie gut sich der Kommunist Ulbricht und der Nationaldemokrat Nasser miteinander verstanden. Sie bezeichneten sich gegenseitig als Freunde. Das war damals auch insofern ein Novum, weil die Bundesrepublik noch die Hallstein Doktrin pflegte und alles unternahm, um die völkerrechtliche Anerkennung der DDR zu verhindern. Ägyptens Präsident Nasser lehnte sich also, wie man heute sagen würde, weit aus dem Fenster. Ohne Titos solidarische Unterstützung hätte die Reise nach Ägypten nicht stattfinden können, da die Westmächte keine Überfluggenehmigung über NATO Staaten erteilten. Daher blieb nur der Seeweg. Tito war bereit, die »Völkerfreundschaft« zur Reise nach Ägypten von Dubrovnik aus auslaufen zu lassen. Wie hast du die Begegnungen zwischen Ulbricht und Tito in Erinnerung? Jugoslawien gehörte zu den ersten zehn Staaten, die die DDR nach ihrer Gründung am 7. Oktober 1949 völkerrechtlich anerkannten. Josip Broz Tito und Walter Ulbricht kannten sich aus der Emigration in Moskau. Sie wohnten dort gemeinsam mit Wilhelm Pieck und dessen Töchtern im Hotel Lux. Eleonore Staimer, eine Tochter Wilhelm Piecks, sollte später die DDR als Botschafterin in Jugoslawien vertreten. Sie wusste um die Vorliebe des jugoslawischen Präsidenten für deutsche Schäferhunde und schlug deshalb Ulbricht vor, Tito beim Staatsbesuch 1964 zwei Schäferhundwelpen zu schenken. Sie begründete ihren Vorschlag mit der Geschichte, dass dem Partisanengeneral während der faschistische Besatzung ein deutscher Schäferhund zugelaufen sei, der ihm nicht von der Seite wich und sich während eines Gefechtes opferte: Er hatte Tito umgeworfen und dabei den Schuss abgefangen, der den Oberbefehlshaber der jugoslawischen Volksbefreiungsarmee treffen sollte. Dem Vorschlag folgte Walter Ulbricht. Die Hunde hatte Tito später immer in seiner Nähe. Der eine war in Belgrad, der andere auf Brioni. Hast du persönliche Erinnerungsstücke von deinem Chef? Anlässlich meines zwanzigjährigen Dienstjubiläums bei ihm als persönlicher Mitarbeiter überreichte er mir am 1. Dezember 1970 ein Anerkennungsschreiben. Ich besitze auch noch einen handschriftlichen Text, den er seinem Freund Nasser gewidmet hatte, und eine Menge Fotografien aus jener Zeit. Wenn du deine Jahre bei Walter Ulbricht im Rückblick siehst: Was bleibt von ihm? Zu seinem 75. Geburtstag 1968 war ich an der Herausgabe eines Bildbandes über ihn beteiligt. Wir nannten das Buch »Ein Leben für Deutschland«. Er glaubte an die »Wiedergeburt Deutschlands als friedliebender, demokratischer und einheitlicher Staat«. Es ist anders gekommen. Doch für mich bleiben der Stolz und die Genugtuung, mit dem bedeutendsten Politiker der DDR für die Verwirklichung einer Politik zum Wohle der Bürger des Landes die aktivsten Jahre meines politischen Lebens vertrauensvoll zusammengearbeitet zu haben.
Ewald Moldt: Unterwegs zum Nil sieben Tage im Land der Pharaonen
Ewald Moldt, Jahrgang 1927, Antifa Jugendausschuss Greifswald, SPD 1945, von 1947 bis 1950 Jugendamtsleiter in Greifswald, danach Studium an der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft in Forst Zinna, Eintritt in den diplomatischen Dienst und von 1953 bis 1958 persönlicher Referent von Außenminister Lothar Bolz. Anschließend tätig an den DDR Botschaften in Rumänien und Polen bis 1963, dann Leiter der Presseabteilung des Ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten, 1965 Botschafter in Bukarest. Von 1970 bis 1978 Stellvertretender Außenminister, danach, bis 1988, Ständiger Vertreter der DDR in Bonn. Nach seiner Rückkehr bis 1990 Stellvertretender Außenminister der DDR. Am 21. Februar 1965 saß ich in einem Sonderflugzeug und flog mit einer IL 18 nach Dubrovnik. Ich gehörte zum Kreis jener, die Walter Ulbricht bei seinem offiziellen Besuch der Vereinigten Arabischen Republik Ägypten begleiteten. Als Leiter der Presseabteilung im Außenministerium war ich für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Bis kurz vor der Abreise – auf nicht authentische Informationen und Gerüchte angewiesen – unternahm die Bonner Regierung verstärkt diplomatische Anstrengungen, um diesen Staatsbesuch zu verhindern. Präsident Nasser war nach Bonn eingeladen worden, doch geheime Waffenlieferungen der Bundesrepublik an Israel, die bekannt geworden waren, belasteten das Verhältnis zur VAR und anderen arabischen Staaten. Einschränkungen in den Beziehungen zu Ägypten, sogar Androhungen wie die Einstellung der Wirtschaftshilfe, die tatsächlich als Sanktion gegen den Ulbricht-Besuch am 7. März 1965 von der Bundesregierung beschlossen wurde, konnten jedoch die ägyptische Entscheidung nicht beeinflussen. Im Hafen von Dubrovnik wartete schon die »Völkerfreundschaft«.[Anmerkung 132] Mit der Fahrt entlang der Adriaküste begann am 22. Februar eine eindrucksvolle Schiffsreise über das Mittelmeer. Dass Militär-Jets der NATO-Anrainerstaaten, die uns keine Überflugrechte gewährt hatten, uns tief überflogen, haben wir als einen billigen Versuch gewertet, um auf die Bundesrepublik und ihre Rolle in der NATO aufmerksam zu machen. Am 24. Februar lief das Schiff in den Hafen von Alexandria ein. Von dort vor Anker liegenden Schiffen grüßten Seeleute das Staatsoberhaupt der DDR mit ohrenbetäubenden Tönen aus Nebelhörnern und Sirenen. Hunderte Ägypter kamen auf ihren kleinen und völlig überbesetzten Booten dem Schiff entgegen, um uns Gäste mit arabischer Herzlichkeit zu empfangen. Hier und da konnte man einen gewollten oder ungewollten Freudensprung ins Wasser beobachten. Ich hatte bereits während der Schiffsreise letzte Vorbereitungen für meinen Arbeitsbereich getroffen. Ulbricht, in bester Laune, zeigte sich schon an Bord zugänglich. Wir gingen gemeinsam mit den begleitenden DDR Journalisten die einzelnen Programmpunkte in Ruhe durch. Zur offiziellen Begrüßung erschienen Vizepräsident Hassan Ibrahim und weitere führende Persönlichkeiten. Eine Formation ägyptischer Streitkräfte war anwesend, und beide Nationalhymnen wurden intoniert. Mit einem Sonderzug ging es, am Suezkanal entlang, Richtung Kairo weiter. Dort empfing uns der Präsident der Vereinigten Arabischen Republik mit allen Ehren und sehr freundschaftlich. Das ganze Kabinett und Mitglieder des diplomatischen Corps nahmen daran teil. Etwa eintausend Menschen waren erschienen, um Walter Ulbricht zu bejubeln. Die Gespräche zwischen beiden Präsidenten verliefen im freundschaftlichen Geist. Gamal Abdel Nasser entwickelte seine Pläne für ein modernes Ägypten auf dem Wege zum sozialen Fortschritt und mit antiimperialistischer Orientierung. Er besaß eine beneidenswerte Ausstrahlung. Walter Ulbricht informierte über die industrielle Entwicklung und die Landwirtschaft der DDR. Er kam auf außenpolitische Themen zu sprechen. Besonders aufmerksam hörte die ägyptische Seite zu, als er die Grenze zwischen beiden Weltsystemen Sozialismus und Imperialismus erläuterte, die sich mitten durch Deutschland zog und zugleich die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten war. Davon leitete er die Verantwortung der DDR für die Sicherung des Friedens ab. Das kam gut an. Dann besuchten wir die Baumwollspinnerei Schibin el Kum.[Anmerkung 133] Die ägyptischen Textilarbeiter begrüßten uns mit ausgelassener, überschwänglicher Freude. Die Ordnungskräfte hatten alle Mühe zu verhindern, dass Ulbricht durch Freundschaftsbekundungen in Atemnot geriet. In großer Anzahl gaben Frauen gemäß dortigem Brauch Kehlkopflaute zum besten. Mit vibrierenden Zungen erzeugten sie schrille Laute, mit denen sie für die hunderttausend Spindeln aus der DDR-Produktion dankten. Wir besichtigten Assuan, wo ein gewaltiger Staudamm am Nil entstand,[Anmerkung 134] die Königsgräber in Luxor und die Pyramiden in Gizeh. Walter und Lotte Ulbricht zeigten sich trotz der hohen Temperaturen und des straffen Programms in guter Form. Am letzten Tag in Kairo verlieh Präsident Nasser an die beiden die höchste Auszeichnung der Vereinigten Arabischen Republik, den Nil-Orden. Auch die Mitglieder der DDR Delegation erhielten je nach ägyptischer Wertschätzung diverse Auszeichnungen. Im Kubbeh-Palast, dem Amtsitz des Präsidenten, leitete ich die internationale Pressekonferenz. DDR-Außenminister Dr. Lothar Bolz wurde mit Fragen geradezu bestürmt. Vor allem ging es um die Freundschaft beider Staaten, die auf der Gemeinsamkeit ihrer Ziele und Interessen durch Ausschaltung jeder imperialistischen Einmischung beruhte. Bolz hob hervor, dass der Besuch nicht nur von großer Bedeutung für die bilateralen Beziehungen sei, sondern er habe für die internationalen Beziehungen Tatsachen geschaffen, nämlich dass die außenpolitische Blockade der DDR durch die BRD nicht mehr funktioniere. Die »Gemeinsame Erklärung«, von beiden Staatsoberhäuptern unterzeichnet, sei von völker- und staatsrechtlicher Bedeutung. Es gab viele Fragen zu den geschlossenen Verträgen auf ökonomischem Gebiet. Dabei standen die ersten Aufgaben des gemeinsamen Wirtschaftsausschusses im Vordergrund. Gerhard Weiß, der stellvertretende Außenhandelsminister, verwies auf die den Verträgen beiliegenden Objektlisten für Chemieanlagen, Metallurgieausrüstungen, Ausrüstungen für die Textil- und für die Druckindustrie. Zu den Vereinbarungen über Kultur, Wissenschaft und Gesundheit äußerte sich der Beauftragte der Regierung der DDR für die arabischen Staaten mit Sitz in Kairo, Botschafter Dr. Ernst Scholz. Bei der Abreise säumte eine begeisterte Menge die mit Fahnen beider Länder geschmückten Straßen vom Kubbeh-Palast bis zum Bahnhof. Alle Mitglieder des Ministerrates und namhafte Persönlichkeiten des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens der VAR sowie Angehörige des diplomatischen Corps waren erschienen. Ulbricht dankte Präsident Nasser und allen ägyptischen Freunden dafür, dass sie ihn und seine Begleitung so aufgeschlossen behandelt hatten. Er werde in der Heimat über die Eindrücke und Erfahrungen berichten.[Anmerkung 135] Unter 21 Salutschüssen verließ der Sonderzug Kairo. Bei Ankunft in Port Said wartete eine begeisterte Menschenmenge auf die Gäste aus der DDR. Zur Begrüßung hatten sich Vizepräsident Hassan Ibrahim, der Gouverneur der Hafenstadt und leitende Mitarbeiter der Suezkanalbehörde eingefunden. Walter Ulbricht würdigte den Neuaufbau der Stadt und erklärte, dass wir uns in Ehrfurcht vor den Söhnen des ägyptischen Volkes verneigten, die 1956 ihr Leben für die Unabhängigkeit ihres Vaterlandes hingegeben und die Errungenschaften der Revolution von 1952 gegen die imperialistische Aggression Großbritanniens, Frankreichs und Israels verteidigt hatten. Es folgte eine Kranzniederlegung am Grabmal des Unbekannten Soldaten. Mit einer Sportveranstaltung und einer interessanten Hafenrundfahrt fand das erlebnisreiche Programm seinen Abschluss. Auf den Kaimauern tanzten viele übermütige Menschen. Immer wieder gab es Hochrufe und das Grußkonzert der Schiffssirenen. Walter Ulbricht und seine Begleitung standen noch lange an der Reeling auf dem Sonnendeck und winkten. Es mangelte nicht an unseriösen Versuchen der westdeutschen Seite, die Bedeutung dieser Reise für die internationale Anerkennung der DDR abzuwerten. An der Hallstein-Doktrin wurde weiter festgehalten. Aber in diplomatischen Kreisen konnte man öfter Meinungen hören, sie sei destruktiv, weil sie sich im Streben nach Entspannung und Verständigung als hinderlich erwies. Ich habe es in meiner Tätigkeit besonders in Afrika erlebt, wie sich Staatsoberhäupter und Außenminister ein konstruktives Verhältnis mit der DDR bis zu diplomatischen Beziehungen wünschten, aber gleichzeitig fürchteten, wirtschaftliche Sanktionen der BRD nicht verkraften zu können. Doch der Prozess der diplomatischen Anerkennung der DDR war nicht mehr aufzuhalten, auch wenn er sich bis 1975 hinzog. Auf internationaler Ebene, auch als Mitglied der UNO seit 1973, hat die DDR für friedliche gleichberechtigte Zusammenarbeit von Staaten und für die internationale Sicherheit bis zum Ende ihres Bestehens aktiv gewirkt.
Gisela Höppner: Was ich an ihm bewunderte? Wie liebevoll er mit Lotte umging
Gisela Höppner, Jahrgang 1927, geboren und aufgewachsen in Berlin, Vater an der Ostfront vermisst, ausgebombt, Lehre als Großhandelskaufmann, Sekretärin bei der IG Metall, dann FDGB-Instrukteur. Nach Gründung der DDR Wechsel ins Zentrale Schreibbüro von Präsident Wilhelm Pieck im Schloss Niederschönhausen. Dann persönliche Sekretärin von Staatssekretär Max Opitz, dem Chef der Präsidialkanzlei. Nach dem Tod Wilhelm Piecks Bildung des Staatsrates und Übernahme in die Protokollabteilung des Staatsrates. Nach dem Tod Walter Ulbrichts tätig in der Protokollabteilung der Volkskammer. Was ist dir spontan an Walter Ulbricht aufgefallen? Seine Hände. Ich erinnere mich an eine meiner ersten Auszeichnungsveranstaltungen im Bankettsaal des Staatsratsgebäudes, es war einer meiner ersten Einsätze dort. Ich stand, wie es sich gehörte, einen halben Schritt hinter ihm. Otto Gotsche sprach, Walter Ulbricht wartete, dass er die 300 Auszeichnungen übergeben konnte, die ich ihm zureichen sollte. Ulbricht hatte, wie stets in solchen Momenten, die Hände auf dem Rücken und ineinander gelegt. Ich studierte sie aufmerksam. Diese großen Tischlerhände faszinierten mich, sie hatten etwas Beruhigendes und Zupackendes zugleich. Mein Vater war Stoffdrucker, der hatte auch solche Proletenhände gehabt, richtige Pranken. Gotsche endete. Ulbricht drehte sich um, lächelte uns zu, und das hieß: Na, dann wollen wir mal. Ich stand stets mit weichen Knien und er wie ein Fels in der Brandung, der durch nichts zu erschüttern war. Während wir aufgeregt prüften, ob alle Urkunden in der richtigen Reihefolge lagen, die Orden – die ich dann ans Revers heften musste – in benötigter Zahl und entsprechenden Stufen aufgetischt waren, und wir die ganze Zeit bangten, ob alle Aufgerufenen auch anwesend waren … Gott, was waren wir nervös. Doch er war die Ruhe selbst. Und das beruhigte uns. An Ende des Auszeichnungsaktes bedankte er sich bei allem vom Protokoll. Das hielt er, wie ich merkte, jedes Mal so. Es gab in der Regel zum 1. Mai und zum 7. Oktober alljährlich eine große Ordenschwemme. Ich meine das nicht abwertend, denn ich weiß, dass eine solche öffentliche Würdigung von Leistungen wichtig war und keineswegs von den Geehrten geringgeschätzt wurde. Egal, ob es sich um die Aktivistenmedaille oder den Karl-Marx Orden, um den Nationalpreis oder das »Banner der Arbeit« handelte. Waren es nur die Hände, die du bemerkenswert fandest? Mich erstaunte, dass er herzhaft und ansteckend lachen konnte. Nicht so ein gekünsteltes, angestrengtes Lachen, womit manche Obere Heiterkeit vortäuschen. Nein, es gab Momente, wo es geradezu unkontrolliert aus ihm herausbrach. Und ich fand das Verhältnis zu seiner Frau anrührend. So eine innige Beziehung war (und ist) in diesen Kreisen vergleichsweise ungewöhnlich. Trotz ihres Alters gingen die beiden warmherzig und offen miteinander um. Sie standen zu ihrer Beziehung, sie waren für alle erkennbar ein Paar. Ich entsinne mich, als mir Lotte erzählte, wie sie sich damals in Moskau in den 30er Jahren beim Schlittschuhlaufen kennenlernten: Da leuchteten noch nach Jahrzehnten ihre Augen, als sei sie wieder ein junges Mädchen und frisch verliebt. Und sie war eine gute Köchin. Bekanntlich geht Liebe durch den Magen. Zwei, drei Wochen vor seinem Tod brachte ich irgendwelche Unterlagen nach Dölln, wo sie beide seit geraumer Zeit lebten. Es war Mittagszeit, und Lotte hatte gerade gekocht, also musste ich einen Teller Nudelsuppe mitessen. Sie achtete darauf, dass Walter strenge Diät hielt. Das fand ich schon recht bemerkenswert: Da schwamm kein Fettauge auf der Suppe, und dennoch schmeckte sie vorzüglich. Das war wirklich große Kochkunst. Du warst 1965 bei der Ägyptenreise dabei? Ja. Das war bis zur Abreise eine Zitterpartie. Auf der einen Seite das Problem der Reiseroute, die NATO Staaten verweigerten das Überflugrecht, weshalb wir mit Titos Zustimmung mit der »Völkerfreundschaft« von Dubrovnik nach Alexandria zwei Tage übers Mittelmeer fuhren. Auf der anderen Seite die Sorge, dass Nasser dem Druck Bonns doch noch nachgeben könnte. Es galten ja unverändert der Alleinvertretungsanspruch und der Strafkatalog der Hallstein-Doktrin. Aber alles war gut, und es war zu spüren, dass Nasser und Ulbricht sich sehr gut verstanden. Da stimmte auf Anhieb die Chemie. Bereits auf der Hinreise hatte unser Außenminister Lothar Bolz gesagt: Walter, wenn die Reise ein Erfolg wird, musst du auf der Rückfahrt ein Bordfest geben. Nun, wir hatten ein Bordfest. Aber etwa ein Drittel der Delegation hing über der Reling, wir hatten ziemlichen Seegang. Auch Lotte war grüngelb im Gesicht. Was war deine konkrete Funktion bei diesem Staatsbesuch am Nil? Ich war für die Geschenke verantwortlich. Das waren rund siebzig Seekisten, die wir genau nach Plan im Casino-Saal im Schloss Niederschönhausen gepackt hatten. Warum Plan? Der war wichtig, um alles gleich zu finden, wann man es brauchte. Ich fertigte Listen, da stand z. B. drauf: Kiste 25, Paket 23 links oben. Dazu der Inhalt und wozu es benötigt wurde, etwa »Besuch im Kindergarten, Spielzeug«. Die Kisten wurden im Präsidentenpalast in Kairo abgeladen und in einem Raum gelagert. Vor den vier Türen zogen vier Posten auf. Mir wurde ein Mitarbeiter der ägyptischen Protokollabteilung zur Seite gegeben. Er hatte aber ein arabisches Problem. Mit einer Frau und dann in diesem Alter gleichberechtigt zusammenarbeiten? Das ging einfach nicht. Er ließ mich deutlich seine Herablassung spüren. Bis wir zum ersten Mal Geschenke aus dem Lager holten. Ich bekam am Vortag immer die Liste der Besuchsstationen des nächsten Tages und die Aufschlüsselung, welche Präsente benötigt wurden. Ich bin also in seiner Begleitung mit dem Posten rein, bat diesen, Kiste Nr. 25 zu öffnen und Paket Nr. 23 links oben herauszunehmen, da sei Spielzeug drin, das brauchen wir für den Kindergarten. Dann Kiste 58, Paket 11, oben rechts: Kamera mit Ausrüstung für den Betriebsdirektor sowieso. Diese Präzision und preußische Ordnung haben den Protokollmann derart beeindruckt, dass er mich fortan sehr höflich und respektvoll behandelte. Walter Ulbricht war zum Zeitpunkt der Reise bereits jenseits der 70, es war heiß und der Terminplan eng. Wie stand er das durch? Er war absolut fit, der trieb sogar auf dem Schiff seinen Frühsport. Er machte in jeder Hinsicht eine gute Figur. Allein oder mussten andere mitmachen? Er zwang keinen dazu. Auch Lotte machte ihre Gymnastik. In welchem Verhältnis standest du übrigens zu ihr? Ich war ihr zugeteilt worden, damit ich mich um sie kümmere, ihr bei bestimmten Fragen helfe. Sie hatte im Staatsrat ein kleines Arbeitszimmer, in welchem sie arbeitete. Sie gab mir eine Kasse mit Bargeld und das Scheckheft der Ulbrichts, um die persönlichen Ausgaben der beiden zu regeln. Sie waren in dieser Hinsicht überkorrekt und ließen sich nichts schenken, jede Quittung, jede Rechnung wurde abgelegt. Am Anfang kam ich mit Lotte Ulbricht nicht klar, bisweilen wirkte sie etwas herrisch. Als sie mich einmal grundlos runterputzte, bin ich zu Max Opitz und habe ihn gebeten, mir eine andere Aufgabe zu übertragen. Nee, sagte er, wenn du Probleme mit Lotte hast, musst du das mit ihr klären, nicht mit mir. Als ich beim nächsten Mal im Zimmer von Lotte war, wusste sie bereits Bescheid. Mensch, Mädel, du weißt doch, dass ich es an der Galle habe, und wenn es mir nicht so gut geht, lass ich das auch andere spüren. Entschuldige. Du kannst mich doch nicht sitzenlassen. – Von da an kamen wir gut miteinander klar. Sie war auch in Modefragen etwas eigenwillig und sperrig. Gerald Göttings Frau erzählte mir, dass sie Lotte bei irgendeinem Empfang ein Kompliment gemacht hatte. Sie trug ein schwarzes Samtkleid mit Pelzbesatz, was Sabine Götting ganz reizend fand und ihr das auch sagte. Ich und reizend, fuhr Lotte sie an, das passe ja wohl kaum zueinander. Ich begleitete sie auch bei Messebesuchen in Leipzig. Als damals die Hosenanzüge aufkamen, da hättest du sie mal erleben sollen, Egon. Sie kriegte sich fast nicht mehr ein. Frauen sollten wie Frauen aussehen und nicht wie Kerle, wetterte sie. Kleider, Röcke und Kostüme seien die angemessene Kleidung. Und? Später trug sie selber gern Hosenanzüge. War sie wählerisch? Kann man so nicht sagen. Sie war nur besonders kritisch. Als ich in Walters Auftrag Trauringe anfertigen ließ, ganz einfache und schlichte, sagte sie: Ick weeß nich … Walter gefielen sie auf Anhieb. Die Protokollabteilung des Staatsrates war wie groß? Vier Personen und eine Sekretärin. Und wir hatten wirklich alle Hände voll zu tun. Nimm nur mal die Auszeichnungsveranstaltungen. Da waren jedes Mal Hunderte von Urkunden auszufertigen und zu siegeln; wir haben doch damals noch mit Lack gearbeitet. Auszeichnungen, Empfänge, Glückwünsche zu Geburtstagen, Beileidsschreiben, Betreuung von Gästen … Wir spürten, wie es den Arbeitern und Bauern im Staatsratsgebäude gefiel, wenn sie zu einer Auszeichnungsveranstaltung kamen. Da war kein Prunk und Protz, eine schlichte Eleganz. Ich habe geheult, als wir nach der Eröffnung des Hauses 1964, zu der Hunderte geladen waren, anschließend das Parkett besichtigten: völlig zerkratzt durch die hohen Absätze. Wir mussten das ganze Parkett gleich erneuern lassen. Wir waren zu großer Sparsamkeit erzogen, jede Ausgabe wurde so behandelt, als sei es eine persönliche. Habt ihr manchmal Spalier bilden müssen? Ich frage deshalb, weil eine Bekannte, die in der Präsidialkanzlei des Bundespräsidenten … Eine Genossin von uns wurde auch übernommen. Nein, die, die ich meine, fing neu und unter Köhler an. Sie war völlig entrüstet, als sie mitbekam, dass die ganze Mannschaft regelmäßig als Kulisse aufmarschieren musste, wenn der Bundespräsident einen ausländischen Gast empfing. Und sie hatte eine Schulklasse zu organisieren, die dabeistand, und in diese Klasse wurde ein Schüler implantiert, der die Landessprache des Staatsgastes beherrschte, welcher sich natürlich freute, wenn er keck von einem Dreikäsehoch begrüßt wurde. Bei sehr fremden Sprachen war dies mitunter eine sehr schwere Übung, ein solches Kind ausfindig zu machen. Habt ihr auch solche Inszenierungen vorbereiten müssen? Nein, so etwas gab es nicht. Du hattest bereits die Reise nach Ägypten erwähnt. Hast du Walter Ulbricht auch bei anderen Staatsbesuchen begleitet? Ja, 1966 nach Jugoslawien. Und im Jahr zuvor, als Tito die DDR besuchte, habe ich Jovanka, seine Frau, beim sogenannten Damenprogramm in Berlin betreut. Josip Broz Tito erhielt damals von Walter Ulbricht den Großen Stern der Völkerfreundschaft für seine hervorragenden Verdienste im Kampf gegen den Faschismus, wie es zur Begründung hieß. Tito sprach Deutsch, die beiden Männer brauchten keinen Dolmetscher. Sie sollen sich auch geduzt haben? Das weiß ich nicht. Ich habe mich auf andere Dinge konzentriert. Warst du auch auf der Insel, auf Brioni, wo Tito seine Residenz hatte? Ja, natürlich. Man brachte uns, also Ulbricht und seine Entourage, mit einer Staatsjacht hinüber. Am Hafen war ein langer roter Teppich ausgerollt. Am Ende stand Tito in blauer Marineuniform, neben ihm Jovanka in einem weißen Kostüm. Sie sah toll aus, eine wirklich attraktive Frau. Und dann kamen sie, auf dem roten Teppich, uns entgegen. Das heißt, Marschall Tito hielt nicht wie ein Monarch Hof, was man, sieht man die Umstände, annehmen könnte, sondern er ging auf den Staatsmann Walter Ulbricht zu und begrüßte ihn herzlich und auf gleicher Augenhöhe. Und mit dem in slawischen Staaten üblichen Bruderkuss. Was war deine schwerste Aufgabe im Staatsrat? Die Vorbereitung und Abwicklung der Trauerfeier. Ich habe noch heute das Bild vor Augen, als Lotte am Sarg mit dem aufgebahrten Walter Ulbricht fast zusammenbrach. Am 7. August 1973, nach dem Ende der Weltfestspiele und eine Woche nach seinem Ableben, nahm die Öffentlichkeit im Amtssitz Abschied. Das Defilee nahm kein Ende, und die Straßen nach Friedrichsfelde säumten Zehntausende. In einer 2011 erschienenen Publikation[128] hieß es, dass »sich überraschend viele Menschen« eingefunden hätten. Und die Autoren lieferten sich selbst die Erklärung, dass offenkundig »Ulbricht in seiner langen Laufbahn als Funktionär und Staatschef der von ihm mitbegründeten DDR tiefere Spuren hinterlassen hat, als es die aktuelle Führung […] in ihren Nachrufen zum Ausdruck gebracht hat«. Da lagen sie mal ausnahmsweise richtig. Es wurde insbesondere im Westen in Abrede gestellt, dass Ulbricht gewünscht habe, dass die Weltfestspiele weitergingen, und sie werteten die Tatsache als einen bewussten, demonstrativen Affront seines Nachfolgers. Ich habe später auch mit Lotte Ulbricht darüber gesprochen. Sie hat mir definitiv bestätigt: Walter habe ihr gesagt, wenn ihm etwas zustieße, sollte das Festival weitergehen. Es seien so viele junge Menschen von weither angereist, sie haben sich auf dieses Treffen vorbereitet und gefreut. Sie dürfe man nicht einfach nach Hause schicken. Lotte ging mit solchen intimen Mitteilungen sehr vorsichtig und sparsam um. Es wird sich schon so verhalten haben.
Bruno Mahlow: »Die schlechten Erfahrungen müssen wir nicht wiederholen«
Bruno Mahlow, Jahrgang 1937, als Sohn eines kommunistischen Emigranten in Moskau geboren, seit 1947 in Berlin lebend. Nach Abitur und sechs Jahren Studium am Institut für Internationale Beziehungen in Moskau Eintritt in den diplomatischen Dienst der DDR, u. a. Erster Sekretär der Botschaft in Peking. Seit 1967 im Apparat des ZK der SED tätig, von 1973 bis 1989 stellvertretender, dann Leiter der Abteilung Internationale Verbindungen. Ab 1990 war er Berater der Internationalen Kommission beim Parteivorstand der PDS, heute gehört er dem Ältestenrat der Partei Die Linke an. Egon Bahr, einst Staatssekretär im Bundeskanzleramt von Willy Brandt, sagte in einem Dialog mit Valentin Falin, in den 70er Jahren Botschafter in Bonn, Germanist, ZK-Sekretär, über die deutsch-russischen Beziehungen im Wandel der Zeiten: Es war ein Glück für Deutschland, dass es zwei große Politiker gab – Adenauer und Ulbricht. Beide hätten gewusst, wie ihre Politik in die der beiden Großmächte einzuordnen war. Nun geht es hier nicht darum, der Gleichsetzung dieser beiden völlig gegensätzliche Interessen vertretende Politiker das Wort zu reden. Ich habe, was meiner Herkunft geschuldet war, oft auch bei Teffen von Funktionären der KPdSU und der SED gedolmetscht und wiederholt auch in Gesprächen erfahren, welche Wertschätzung Ulbricht in der Sowjetunion genoss. Julij Kwizinskij[Anmerkung 136] hat mitunter auch für Ulbricht gedolmetscht und urteilte in seinen Erinnerungen über ihn: »Walter Ulbricht war zweifellos der stärkste Politiker unter allen, die die DDR regierten. Und das Verhältnis Ulbrichts zur Sowjetunion beschrieb er so: »Darüber hinaus konzentrierte sich für ihn, den eisernen Kommunisten und Nichtmitglied der KPdSU, die Idee des Dienens der Sache des Kommunismus letzten Endes unabdingbar auf die Idee des Dienens der Sowjetunion.« Also doch ein treuer Vasall Moskaus? Kwizinskij widerspricht: »Es wäre jedoch falsch und ungerecht, in ihm einen Menschen zu sehen, der nur dazu fähig war auf deutsche Weise das zu wiederholen, was sowjetische Theoretiker und Praktiker des sozialistischen Aufbaus sich erdacht haben. Das war bei weitem nicht so. Walter Ulbricht war eine Persönlichkeit. Das erkannten sogar seine schärfsten Gegner und Widersacher an. Bezüglich der Modelle der Organisation eines sozialistischen Staates sah er schon in diesen Jahren vieles, was wir mit Enthusiasmus für uns neu entdeckten in den 80er Jahren.«[129] Auch Leonid Breshnew verhielt sich gegenüber Ulbricht respektvoll und loyal, er schätzte ihn als aufrichtigen Freund der Sowjetunion. Und dies auch dann, als Walter Ulbricht die Ablösung Chruschtschows durch Breshnew, wie es auch in einer entsprechenden Erklärung des Politbüros des ZK der SED zum Ausdruck kam, faktisch bedauerte. Es stimmt, dass sich Breshnew, wie in einigen Veröffentlichungen angeführt, kritisch über das mitunter sehr fordernde, ja schulmeisterhafte und mit theoretischen Ansprüchen versehene Auftreten Ulbrichts äußerte. Ulbricht konnte, wie sowjetische Partner bezeugen, mit der Faust auf den Tisch hauen. Es stimmt ferner, dass ohne Zustimmung Moskaus und Breshnews eine Ablösung Ulbrichts nicht einfach gewesen wäre. Es stimmt aber auch, dass Erich Honecker nicht der einzige Kandidat war. Gerade 1970/71 gab es aktive Gespräche verschiedener sowjetischen Partner in der DDR, um zu eruieren, wer der geeignetste Nachfolger Ulbrichts wäre. Dabei spielten einige Namen von Führungsmitgliedern bis zu ersten Bezirkssekretären eine Rolle. Ungeachtet Beshnews Zustimmung, Ulbricht von der Funktion des Ersten Sekretärs zu entbinden, besuchte er diesen am Rande des VIII. Parteitages, an dem Ulbricht nicht mehr teilnahm. Unterdessen war eine Arbeitsgruppe des Parteitages damit befasst, in allen Redebeiträgen ausländischer Gäste den Namen Walter Ulbricht durch Erich Honecker zu ersetzen. Vor dem Parteitag besuchte mich in meiner Wohnung in Berlin ein langjähriger Chefkonsultant im ZK der KPdSU und einer der Redenschreiber Breshnews. Alexander Bowin informierte mich, dass Breshnew darum ersuche, Honecker möge anständig mit Walter Ulbricht umgehen. Noch deutlicher wurde Pjotr A. Abrassimow, der, wie er mir persönlich mitteilte, Honecker gesagt habe: »Erich, du … (auf das russische Schimpfwort verzichte ich aus Pietät – B. M.), was machst du mit Ulbricht?« Walter Ulbricht war ein zuverlässiger und aufrichtiger Freund der Sowjetunion, aber zugleich auch ein ehrlicher, die Bedingungen und Interessen der DDR beachtender und daher manchmal ein unbequemer Mitstreiter Moskaus. Moskau drang immer wieder darauf, den Anteil des Privateigentums bei den Produktionsmitteln in der DDR entschieden zu reduzieren und alsbald die volle Verstaatlichung durchzusetzen. Ulbricht meinte, der private Unternehmer, insbesondere in der Dienstleistungssphäre, sei äußerst wichtig für ein normales Funktionieren der sozialistischen Wirtschaft. Man solle das auch in der Sowjetunion ausprobieren und werde sehen, wie sich das positiv auswirken werde. Ein anders Beispiel war die Art und Weise der Vergenossenschaftlichung der Landwirtschaft in der DDR, die aufgrund ihres schnellen Tempos in Moskau zunächst mit Enthusiasmus aufgenommen wurde. Dann jedoch wurde man zunehmend unruhiger, weil das überhaupt nicht der Kollektivierung in der Sowjetunion glich. Ulbricht führte darüber ein offenes Gespräch mit Frol Koslow[Anmerkung 137] in dem er erklärte, dass er nicht daran denke, nach sowjetischem Vorbild zu handeln, denn er habe in den 30er Jahren die Kollektivierung und den mit ihr verbundenen Rückgang der Produktion erlebt. Daher könne er nicht gestatten, unter Bedingungen der DDR diese Erfahrung zu wiederholen, oder sei die UdSSR etwa bereit, ihre Lebensmittellieferungen an die DDR zu erhöhen? Falls nicht, wovon er ausgehe, so mögen ihn die sowjetischen Genossen in dieser Sache in Ruhe lassen. In den Kolchosen sei die Produktivität um ein Vielfaches niedriger und die die Ordnung um vieles schlechter als in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Walter Ulbricht war ein stets Lernender, es war für ihn zunächst nicht einfach, sich in die Wirtschaftspolitik hineinzudenken. Meine Schwester Hedwig Mahlow, die viele Jahre Mitarbeiterin bei Bruno Leuschner[Anmerkung 138] war, berichtete, dass die mit Wirtschafts- und Außenwirtschaftsfragen Befassten wie Heinrich Rau und Bruno Leuschner unter Ulbrichts Entscheidungen bisweilen litten. Ulbricht wollte die DDR als Schaufenster des Sozialismus entwickeln (meine sowjetischen Partner sprachen von der »sozialistischen Schweiz«), benötigte dazu aber die Uterstützung der Sowjetunion und der anderen Verbündeten. Die aber wollten nicht so, wie Ulbricht es wollte. Erst sukzessive gewann bei ihm die Einsicht die Oberhand, dass die DDR allein in diesem Wettstreit mit der BRD nur zweiter Sieger bleiben würde. Für Ulbrichts strategisches Denken spricht die Bildung eines strategischen Arbeitskreises, die Entwicklung des Neuen Ökonomischen Systems, die Verbindung der Erfordernisse der wissenschaftlich-technischen Revolution mit den Errungenschaften des Sozialismus. Walter Ulbricht folgte Chruschtschows Illusion nicht, der 1961 erklärte, dass »unsere Generation im Kommunismus leben wird«. Er setzte dem die These von der relativ selbständigen Gesellschaftsformation des Sozialismus entgegen. Er ging noch weiter, indem er einen sowjetischen Gesprächspartner aus der Führung fragte, ob das Politbüro des ZK der KPdSU sich nicht langsam Gedanken darüber machen müsse, ob es so wie bisher den Staat leiten wolle. Man dürfe nicht so tun, als ob die Partei die Gesetze der Entwicklung der Gesellschaft diktieren könne. Er stelle die Frage, ob die Partei sich nicht ausschließlich damit befassen solle, was ihre Sache sei. Es bedürfe einer radikalen Reform der Partei, der Überprüfung der gesamten Methodik ihrer Arbeit, eines anderen Typs von Kadern, der Veränderung ihrer Rolle im Staatsapparat und in der Produktion. Es bedarf kompetenter Spezialisten. Anderenfalls werde der Parteiapparat zu einer Kaste und sich selbst in die Sackgasse führen.[130] Weit vorausschauend war Ulbricht auch in der nationalen Frage. Er hielt es für unzulässig, wenn die SED auf die Frage der Wiedervereinigung verzichtete und sie dem Westen überlasse.
Valentin Falin: Ulbricht wusste, ein Leben auf Kredit kommt teuer zu stehen
Valentin M. Falin, Jahrgang 1926, geboren in Leningrad, 1930 Übersiedlung der Familie nach Moskau. Während des Zweiten Weltkrieges Arbeit im Rüstungsbetrieb »Roter Proletarier«, 1945 bis 1950 Studium am Moskauer Institut für Internationale Beziehungen, Hauptfächer Deutsch und Völkerrecht. Einsatz in der Sowjetischen Kontrollkommission in Deutschland. Danach über vier Jahrzehnte in Funktionen des sowjetischen Staates und der KPdSU, vorwiegend im außenpolitischen Dienst. Von 1971 bis 1978 Botschafter der UdSSR in Bonn, von 1986 bis 1988 Direktor der Presseagentur Novosti, von 1988 bis 1991 Leiter der Internationalen Abteilung des ZK der KPdSU, zuletzt Sekretär des Zentralkomitees. Valentin Michailowitsch, Sie sind wahrscheinlich unter den Lebenden der beste Kenner der sowjetischen Deutschlandpolitik. Von Stalin bis Gorbatschow waren Sie im Außenpolitischen Dienst. Sie kennen viele deutsche Politiker in Ost und West persönlich. Was fällt Ihnen spontan zu Walter Ulbricht ein? Schärfe und Gewicht der deutschen Frage nach dem 9. Mai 1945 bestimmten das Interesse unserer Öffentlichkeit gegenüber jenen Politikern, die mit dem Erbe des Dritten Reiches fertig werden mussten. Das war in jeder Hinsicht eine äußerst schwere Aufgabe. In diesem Zusammenhang wurde bei uns der Name Walter Ulbricht zum Begriff. Auf einer Veranstaltung der Führung der SED in der Werner-Seelenbinder Halle in Berlin im August 1950 wurde ich zusammen mit anderen frischgebackenen Mitarbeitern der Sowjetischen Kontrollkommission Walter Ulbricht sowie auch Otto Grotewohl, Willi Stoph und Erich Honecker vorgestellt. Sachliche Kontakte ergaben sich auf der Konferenz in Luckenwalde, über die später zu sprechen sein wird. Einen indirekten Austausch mit seinem Gedankengut boten Ulbrichts regelmäßige Kommentare in den Massenmedien und meine Gespräche mit Willi Stoph. Mir schien, dass Walter Ulbricht am Ruder der Republik steht, trotz des Geredes, dass Stalin nur einen echten deutschen Kommunisten kenne, nämlich Wilhelm Pieck. Was konnte den sowjetischen Führer bewogen haben, so zu denken und auch anzunehmen, dass die Vereinigung von KPD und SPD zur Sozialistischen Einheitspartei überstürzt war? Neben übergeordneten außenpolitischen Herausforderungen und Gewaltdrohungen, so nehme ich an, machte sich Stalins Einsicht über den nicht wieder gutzumachenden Schaden bemerkbar, den der Dogmatismus der 20er und 30er Jahre der Sowjetunion selbst, der kommunistischen Weltbewegung, der Idee des Sozialismus zugefügt hat. Mit der Auflösung der Komintern 1943 stellte Stalin Weichen für die Architektur der künftigen Weltordnung. Auf einer Zusammenkunft im März 1945 mit den Mitgliedern der Kommissionen, die Vorschläge zum Nachkriegskurs Moskaus ausarbeiteten, machte er deutlich: Die Spaltung Deutschlands widerspricht den strategischen Interessen der UdSSR. Das Land bedarf keiner Vorposten mit prosowjetischen Regimen. Sein Wohl bestehe in guter Nachbarschaft, ohne Steine im Rücken. Die Fakten sprechen für sich selbst. Soweit dies von Moskau abhing, entwickelten sich die Beziehungen mit Finnland, Österreich und der Tschechoslowakei. Bis ins Jahr 1947, d. h. bis Washington den Beschluss zur Bildung des atlantischen militärischen Blocks und zur Wiederbelebung der Relikte des deutschen Imperialismus für seine Dienste fasste, führten die Regierungen Rumäniens und Ungarns bürgerlich-liberale Politiker. Leider wissen bis heute nur wenige Bescheid über die Operation der Geheimdienste der USA unter dem Decknamen »Spaltung«. Deren Opfer wurden unter vielen anderen Rudolf Slánsky[Anmerkung 139] in der Tschechoslowakei und die Nachfolger Dimitroffs in Bulgarien. In Ungnade fiel Wladislaw Gomulka[Anmerkung 140] in Polen. Über alle Maßen verkomplizierten sich die Beziehungen der UdSSR mit Jugoslawien. Unter den Verdächtigen gab es auch Funktionäre der SED. Walter Ulbricht war gewiss kein bequemer Partner. Er verstand, hart seinen Standpunkt zu vertreten und Werte der Republik zu wahren. Doch darf ich aus eigener Erfahrung und vielen Gesprächen mit ihm unter vier Augen feststellen: Walter Ulbricht war offen für seriöse Argumentation und verstand, sein Wort zu halten. Es gibt keinen Grund, Ulbricht Respekt zu verweigern, weder damals noch im Nachhinein. Er war nach meinem Dafürhalten eine markante Persönlichkeit und ein Staatsmann herausragenden Kalibers. Ulbricht kam Ende April 1945 aus sowjetischem Exil nach Berlin mit dem Gründungsaufruf der KPD[Anmerkung 141] im Gepäck, der von Stalin bestätigt war. Eine entscheidende Direktive hieß: Es ist falsch, Deutschland das Sowjetsystem aufzuzwingen. Das Ziel sei eine einheitliche antifaschistische, demokratische deutsche Republik mit allen demokratischen Rechten und Freiheiten für das Volk. Ulbricht warb für diese Idee und regte Anton Ackermann an, eine Broschüre über den besonderen deutschen Weg zum Sozialismus zu schreiben. Nur einige Jahre später wurden die deutschen Genossen von Moskau angehalten, diesen Weg zu verlassen. Warum? Das Zurückverfolgen der Evolution von Parteien und Staaten gewinnt nicht, wenn bewusst oder unbewusst Zeit und Raum zerschnitten, Realitäten wählerisch sortiert werden. Im Auftrag Churchills bereiteten britische Stabschefs im März-Mai 1945 die Operation »Unthinkable« vor.[Anmerkung 142] Der Dritte Weltkrieg sollte am 1. Juli 1945 beginnen mit dem Ziel, die Sowjetunion dem Willen der Vereinigten Staaten und Großbritanniens zu unterwerfen. Washington hat sich in dieses wahnsinnige Unterfangen nicht eingeschaltet: Die USA hielt der Umstand zurück, dass sie die Unterstützung der Roten Armee benötigte, um Japan zur Kapitulation zu zwingen. Aber zwei Wochen nach Hiroshima und Nagasaki machten sich die »Sternbannerdemokraten« an die Erprobung von Varianten für einen präventiven Kernschlag gegen die Sowjetunion. Irgendwann hatte ich die Formel »die Spaltung des Atoms hat Deutschland gespalten« in Umlauf gebracht. Damit hat man Europa zugeschnitten, den Erdball nach Meridianen und Parallelen zurechtgeschneidert. Ende 1946 hat die Truman-Administration sich festgelegt: Welche Politik Moskau auch durchführen möge, allein die Existenz der UdSSR sei mit der amerikanischen Sicherheit unvereinbar. In dieser Zeit reanimierte Washington den Grundplan, der der US Delegation auf der Pariser Konferenz 1919 vorgegeben wurde. Er sah vor, die Einflusssphäre des Kremls auf die »Mittelrussische Platte« zu beschränken. Um nicht, wie die Russen sagen, in sinnloses Geschwafel zu verfallen, stelle ich die Frage: Wie sollte Stalin reagieren angesichts der auf seinem Schreibtisch liegenden Kopien angeführter und ähnlicher Entscheidungen der Vereinigten Staaten? Er versuchte, den Dingen zuvorzukommen, konkretisierte und entwickelte die sowjetischen Vorschläge, die bereits in Potsdam und gleich im Anschluss an die Konferenz unterbreitet wurden. Gemeint sind vor allem die Initiative zugunsten der Abhaltung von gesamtdeutschen Wahlen auf der Grundlage einheitlicher Wahlprozeduren, die Bildung einer nationalen Regierung entsprechend den Abstimmungsergebnissen und der Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland, nach dessen Inkrafttreten alle Besatzungstruppen in ein bis zwei Jahren aus Deutschland abgezogen sein sollten. Stalin unterstrich mit aller Konsequenz, dass das deutsche Volk das Recht habe, seine sozial-ökonomische Ordnung selbst zu bestimmen. Er gab zu verstehen, dass Moskau nicht widersprechen würde, wenn sich die Mehrheit für eine Ordnung in der Art der Weimarer Republik aussprechen würde. In dieser Position Moskaus kann man natürlich ein Abdriften von der Orientierung auf einen »besonderen deutschen Weg zum Sozialismus« sehen. Wenn man es wünscht, ist es nicht schwer, die Staatspolitik mit dem Leitstern der Ideologie zu identifizieren, indem das Gegebene in Klammern gesetzt wird. Die Politik war und bleibt die Kunst der Aufstellung der Prioritäten. Von 1946 bis 1949 und später blieb die Aufgabe aller Aufgaben: Wie kann man die aggressiven Absichten der Regierenden in den USA, die sich anmaßen, das Atommonopol völlig zu kapitalisieren, unschädlich machen und abwenden? Vergleichen Sie den »Generalplan Ost«[Anmerkung 143] mit dem »Dropshot Plan« oder mit den Programmen zur »Enthauptung der Sowjetunion«, der von Truman im November 1949 als Grundlage für die Außen- und Militärpolitik der USA sowie der NATO festgeschrieben wurde. Als Pragmatiker machte sich Stalin nichts vor. Im Falle der Abhaltung freier Wahlen hätte die Mehrheit der Deutschen einem »sozialistischen Weg« eher nicht zugestimmt. Er rechnete jedoch damit und hatte dafür Gründe, dass die Anhänger der nationalen Einheit des Landes, Gegner der nach Revanche trachtenden »Arier«, die sich in die Fremdenlegion des Pentagon einreihen wollen, die Oberhand gewinnen. 1949 testete die Sowjetunion ihre Kernwaffe. Auch die Arbeit der Konstruktionsbüros zur Herstellung effektiver Träger von Kernladungen nahm immer mehr Gestalt an. Die USA verschoben den Tag »X« von 1952 auf 1955. Washington nahm die Zeit in Anspruch, um zehnfache Überlegenheit gegenüber der UdSSR in konventionellen Waffen zu erreichen. Das Credo des Kalten Krieges machte Veränderungen durch. Es verschoben sich auch die Akzente in den Alltagsangelegenheiten. Die DDR hat stets die Schuld des faschistischen Deutschlands an dem verbrecherischen Krieg gegen die UdSSR betont und die Opfer des Sowjetlandes für die Freiheit Deutschlands und Europas vom Hitlerfaschismus gewürdigt. Gleichwohl: Pieck, Grotewohl und Ulbricht bemühten sich aus humanitären Gründen um die Entlassung deutscher Kriegsgefangener aus sowjetischer Gefangenschaft. Sie zogen dabei auch in Betracht, dass die Kriegsgefangenenfrage zur antisowjetischen Propaganda genutzt wurde. Ulbricht und seine Genossen wurden von Stalin gerügt, weil sie sich angeblich für Kriegsverbrecher eingesetzt hätten. Heutzutage tun bestimmte politische Kreise in Deutschland so, als sei es das Verdienst Konrad Adenauers und nicht der gemeinsame Wille der UdSSR und der DDR gewesen, dass die Kriegsgefangenen nach Hause kamen. Für die UdSSR und die DDR wird von diesen Leuten eine humanistische Haltung von vornherein bestritten. Was können Sie dazu sagen? Die Frage ist nicht korrekt formuliert. Zum Zeitpunkt der Gründung der DDR büßten in der Sowjetunion zwei, drei Gruppen deutscher Kriegsgefangener ihre Strafe ab: Wehrmachtangehörige, das Personal der SS-Formationen, Verantwortliche von Geheimdiensten des Dritten Reiches. Die Mehrheit von ihnen war in Grausamkeiten des Aggressors auf sowjetischem Territorium, in Gräueltaten, bei denen Tausende Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht wurden, verwickelt. Allein in Belorussland haben die Okkupanten 9.200 Ortschaften und Dörfer verbrannt, darunter 5.295 mit deren Einwohnern. Opfer des Genozids wurden 2.230.000 Menschen, jeder dritte Einwohner Belorusslands kam um. Ein ähnliches Bild boten auch die Gebiete von Pskow, Brjansk und Leningrad. Allgemein bekannt ist das tragische Schicksal des tschechischen Lidice. Ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand in Deutschland laut die Legitimität der Bestrafung nazistischer Mörder infrage gestellt hat. Sollten die Verbrecher, die auf dem okkupierten sowjetischen Territorium Gräueltaten verübt haben, mit einem leichten Schrecken davonkommen? Die Sowjetunion rief nicht zur Rache auf, nicht zur Übersetzung der Nazibefehle vom Deutschen ins Russische, in denen die Sieger über die elementaren Normen des Rechts und der Moral gestellt wurden. Lesen Sie den Befehl Stalins vom 19. Januar 1945 »Über das Verhalten (der Soldaten und Offiziere) auf dem Territorium Deutschlands«. Ja, es stimmt, entgegen diesem Befehl war die Weichenstellung mit großen Entgleisungen verbunden. Aber nach Durchlaufen der Hölle nazistischer Machart würden selbst den Engeln die Flügel abfallen. Die »Demokraten« haben gerne die in ihre Netze geratenen Mörder aufgenommen, deckten den Entzug Tausender Verbrecher vor der Vergeltung. Und dies in Verletzung feierlicher Versprechen, die an nazistischen Verbrechen Schuldigen bis ans Ende der Welt zu verfolgen. Ich wiederhole mich. Die Sowjetunion bekundete Bereitschaft, Nachsicht gegenüber denjenigen zu zeigen, die sich nicht selten gegen ihren eigenen Willen in die verbrecherische Orgie einbezogen sahen. Mindestens vier von fünf Deutschen, die der sowjetischen Kriegsgefangenschaft nicht entgehen konnten, wurden zum Herbst 1949 nach Hause entlassen. Vielen derjenigen, die aus der Ostzone stammten, haben Strafminderungen erfahren. Der Appell Piecks, Grotewohls und Ulbrichts veranlasste Stalin, über das Rote Kreuz der Bonner Führung die Bereitschaft der UdSSR zu signalisieren, einen großen Teil der aus Westdeutschland stammenden Gefangenen freizulassen und den BRD Behörden zu übergeben. Konrad Adenauer hat dem westdeutschen Roten Kreuz verboten, in etwaige Verhandlungen mit sowjetischen Partnern zu treten. Das sei keine humanitäre, sondern eine politische Frage; je länger sie in Gefangenschaft bleiben, umso günstiger ist das für uns, erklärte Kanzler Adenauer. Das entsprechende Dokument befand sich nach zuverlässigen Angaben im Koblenzer Archiv. 1950, die DDR war erst einige Monate alt, begann Ihre Tätigkeit in der sowjetischen Kontrollkommission. Mit welchen Vorstellungen und Aufträgen sind Sie zu Ihrem ersten Einsatz nach Berlin gekommen? Eine kurze Abschweifung. Wie kam es, dass statt der englischen oder französischen Ausrichtung meine Wahl beim Eintritt in das Institut[Anmerkung 144] auf das Deutsche fiel? Der Krieg hatte wohl meine kindlichen und jugendlichen Vorstellungen über die mustergültige Anständigkeit der Nation Goethes und Schillers, Bachs und Beethovens völlig ausgelöscht. Zwischen dem Äußeren und Innerem, zwischen Schein und Sein klaffte ein Abgrund. Ich musste eine Erklärung für die Tragödie finden, die gnadenlos auch über meine Familie hinweggegangen war. In die Institutsbibliothek gelangten viele Kriegsbeuteexemplare von Büchern über deutsche Philosophie, Politik, Kultur, Gesellschaftskunde, Wirtschaft. Nachdem ich die Werke der Kritiker und Apologeten der deutschen »Ausschließlichkeit« in mich aufgenommen habe, vermochte ich nicht zu sagen, dass ich mich der Enträtselung der quälenden Frage nach dem »Warum?« genähert hätte. Es blieb die Hoffnung, dass Licht am Ende des Tunnels durchdringen wird, wenn ich vor Ort mit der Spezifik der deutschen Realitäten in Berührung komme. Die Deutsche Demokratische Republik begrüßte mich mit herrlichem Wetter und den Ruinen von Frankfurt an der Oder. Das damalige Berlin machte ebenfalls nicht den Eindruck eines Schaufensters des Wohlergehens. In der Sowjetischen Kontrollkommission (SKK) fiel mir die Aufgabe zu, mich auf das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten und das Verfolgen der inneren Prozesse in der BRD zu konzentrieren, einschließlich der Herausbildung der wechselseitigen Beziehungen in der Bonner Regierungskoalition und der Situation in der SPD und KPD. Der politische Berater W. S. Semjonow und sein Stellvertreter I. I. Iljitschow hielten meine Teilnahme an der Vorbereitung von Berichten über die Arbeit der SKK und von Überlegungen bezüglich möglicher Reaktionen des Zentrums auf Aktionen der drei Westmächte für nützlich. Details lasse ich an dieser Stelle weg. Bemerken möchte ich nur, dass ich zusammen mit einem Kollegen von der SKK Ende 1950 ein Treffen mit Gustav Heinemann[Anmerkung 145] hatte, der als Zeichen des Protestes gegen die Remilitarisierung der BRD demonstrativ mit Adenauer brach. Dienstliche Obliegenheiten bedingten, dass ich die Republik kreuz und quer bereiste. Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Chemnitz, Eisenach. Unheimliche Schwermut überkam mich bei der Besichtigung Halberstadts und natürlich Dresdens. Nur unverbesserlich hartherzige Naturen waren, nachdem sie in das damals zu Sehende eintauchten, fähig, gleichgültig zu bleiben. In die Hauptstadt Sachsens kam ich am 13. Februar 1951. Auf vielen Straßen konnte man nur zu Fuß laufen. Links und rechts nicht abgetragene Ruinen von Häusern, unter denen Kinder, Frauen, Alte begraben sind. Woran und vor wem waren sie schuldig? Ich gehe zum nächstliegenden Friedhof. Bis jetzt sind vor meinen Augen die Grabplatten: Mutter, Großmutter oder Großvater und die Namen der Kinder, von denen die Jüngsten oft noch nicht einmal ein Jahr alt sind. Das hat nichts mit Sentimentalität zu tun, deren man mich damals und auch später bezichtigte. Auch am Ozean des Bösen muss sich irgendwo ein Ufer abzeichnen, aber wie kann man es erreichen ohne in die gleiche Richtung zu unternehmende gemeinsame Anstrengungen? 1964 hatte ich mit Walter Ulbricht ein langes Gespräch über Dresden. Bis heute lässt der Streit darüber nicht nach, wie viele Menschen unter den Bombenteppichen der Stadt umgekommen sind. Stimmt die Behauptung, fragte ich den Gesprächspartner, dass deren Zahl die Opferzahlen nach dem Atombombenabwurf über Hiroshima übersteigt. Nach Ulbrichts Aussagen haben die DDR-Behörden in drei Anläufen alle zugänglichen Dokumente studiert und sind zu der Schlussfolgerung gelangt, dass 38.000 Menschen getötet oder lebendigen Leibes verbrannt sind.[Anmerkung 146] Warum wurde Dresden ein solches Los zuteil? Nach einer der nicht widerlegten Versionen wurden die britischen Piloten vor dem Abflug angehalten, den Russen zu zeigen, wozu die alliierte strategische Luftwaffe fähig ist. Gemäß anderen Angaben erfüllten die amerikanischen Besatzungen, die ihre Angriffe am Tage flogen, den Befehl, die Brücken über die Elbe zu zerstören, um den Vormarsch der Truppen der Roten Armee gen Westen aufzuhalten. Ihrer Autobiografie[131] entnehme ich, dass Sie im Frühherbst 1950 an einer Veranstaltung in Luckenwalde teilgenommen haben, auf der Pieck, Grotewohl und Ulbricht mit Vertretern aus Ost und West über die Gefahr der erkennbaren Remilitarisierung Westdeutschlands berieten. Ihr Chef, W. S. Semjonow, veranlasste Sie, über eine angeblich nicht gewünschte Bemerkung von Wilhelm Pieck in einem Telegramm an Stalin zu berichten. Waren der Präsident der DDR und seine Genossen Ulbricht und Grotewohl für den Chef der sowjetischen Kontrollkommission zuverlässige Verbündete oder kritisch zu Beobachtende? Zur Episode in Luckenwalde. Meines Erachtens sind die Mutmaßungen, die Schatten auf die gegenseitigen Beziehungen Moskaus mit Pieck, Ulbricht und Grotewohl werfen, haltlos. Stalin verfolgte mit angespannter Aufmerksamkeit alles, was in der DDR und der BRD vor sich ging, und auch die Kontakte zwischen diesen Staaten mit angespannter Aufmerksamkeit. Die Hoffnung auf die Wiederherstellung eines souveränen Deutschlands war nicht von der Tagesordnung abgesetzt. Unter der Bedingung einer Juwelierarbeit an der Basis, ohne Verzerrungen nach links und rechts, konnte das Ziel nach seinen abgewogenen Überlegungen in fünf bis sieben Jahren erreicht werden. Aufrufe zum Sturz des Adenauer-Regimes fügten sich nicht in ein solches Szenarium ein.[Anmerkung 147] Umsicht erforderte die allgemeine Situation in der Welt. Die sowjetische Führung wusste um die Machenschaften MacArthurs,[Anmerkung 148] anderer Washingtoner Habichte, von denen die Überleitung des koreanischen Konflikts in eine Kernwaffenphase, und auf diese Weise ein Zusammenfließen des fernöstlichen Kriegstheaters mit dem europäischen provoziert wurde. Übrigens, Korea geriet ins Feuer nicht auf Geheiß Moskaus. Kim Il Sung kam nicht mit Li Sing-Man[Anmerkung 149] zurecht. Es gehörte zur Staatsräson der DDR, die Reparationen als Beitrag zur Wiedergutmachung der der UdSSR im Krieg zugefügten Schäden zu betrachten. Nachdem die Westmächte 1949 entgegen den Festlegungen des Potsdamer Abkommens der UdSSR die Entnahme von Reparationsleistungen aus den Westzonen versagten, lag nun die ganze Last auf den Schultern der SBZ und später der DDR. Das hat die DDR-Wirtschaft belastet. Bei der Realisierung der Reparationsleistungen gab es im Detail auch Konflikte. Walter Ulbricht lag mit Vertretern der sowjetischen Kontrollkommission nicht selten im Streit. Haben Sie Ulbricht in solchen Situationen erlebt, und welche Gedanken und Gefühle hatten Sie dabei? Ein paar Präzisierungen sind sicher nicht abträglich. Um die Jahreswende 1945/46 hat die Truman-Administration festgeschrieben: Der Kalte Krieg ist eben ein Krieg, nur ein mit anderen Mitteln geführter. Zu seinem Arsenal gehören die wirtschaftliche und technologische Blockade der Sowjetunion, das Auftürmen von Schwierigkeiten, die das Heilen unserer wirtschaftlichen Wunden behindern. Anstatt der gemäß den Potsdamer Vereinbarungen der UdSSR zukommenden 25 % der Industrieausrüstungen, die für eine Volkswirtschaft in Friedenszeiten nicht notwendig waren, erhielten wir insgesamt Reparationen in einer Gesamtsumme von 12,5 Millionen Dollar.[Anmerkung 150] Zum Vergleich: USA und England nahmen in ihre Staatskasse allein über die Konfiszierung des deutschen Eigentums im Ausland über 20 Milliarden Dollar ein. Die Lasten bei der teilweisen Kompensation für die Verluste unseres volkswirtschaftlichen Potenzials legten sich auf die sowjetische Besatzungszone. 1946 nahm Stalin den Vorschlag Marschall W. D. Sokolowskijs an, die Demontage der Ausrüstungen einzustellen, die Industrieobjekte in »gemeinsame Betriebe« umzuwandeln, deren Produktion größeren Teils als Reparationen an die Sowjetunion ging. In der Praxis ging es bei der Bestimmung der Nomenklatur der Erzeugnisse, des Volumens und der Termine für die Erfüllung der Aufträge und vor allem der Preise nicht ohne Streit ab. Unsere Wirtschaftsfunktionäre überspitzten oft und es kam zu eingehenden Klärungen, darunter auch auf der Ebene Ulbrichts und W. I. Tschuikows.[Anmerkung 151] Es brauchte Jahre, ehe es mir gelang, die prinzipielle Entscheidung durchzusetzen, dass den Verrechnungen, unter anderem für Uran, das in Thüringen gefördert wurde, die Weltpreise zugrunde gelegt wurden. Nach der Ablehnung der sowjetischen Note zur Deutschlandpolitik vom 10. März 1952 durch die Westmächte (Stalin-Note), bestellte Stalin im April 1952 Pieck, Grotewohl und Ulbricht zu einer Beratung nach Moskau. Es ging unter anderem um den sowjetischen Vorschlag, die Grenze zwischen der DDR und der BRD militärisch auszubauen und eigene Nationale Streitkräfte der DDR zu schaffen. Am Tage der Abreise der deutschen Genossen aus Moskau wurde den Westmächten die zweite Stalin-Note überreicht. Aus Ihren Erinnerungen erfahre ich nun, dass beide Noten hinter dem Rücken der DDR entstanden und den Westmächten übergeben wurden, ohne dass die DDR davon Kenntnis hatte. Was waren die Motive für das Misstrauen gegenüber dem eignen Verbündeten? Über die bekannten sowjetischen Noten vom 10. März 1952 (Entwurf des Friedensvertrages mit Deutschland) und vom 9. April des gleichen Jahres mit dem Vorschlag über die Abhaltung freier gesamtdeutscher Wahlen: Moskau nahm sein Projekt der friedlichen Regelung, das in einigen Runden mit der Führung der SED erörtert wurde, wieder auf. Der Text der März-Note ist vorab den Freunden nicht zur Ansicht übergeben worden, sie wurden jedoch, bevor der stellvertretende Außenminister A. A. Gromyko die Botschafter der drei Westmächte zu sich lud, mit ihr vertraut gemacht. Ein solches ungewöhnliches Vorgehen lag ursächlich, soweit ich hörte, an der »Sache Dertinger«.[Anmerkung 152] Jedes vorzeitige Durchsickern konnte den Effekt der von uns angedachten Aktion vermasseln. Was die Aprilnote betrifft, so wage ich zu behaupten, dass Pieck im Detail in das Wesen der Sache eingeweiht war. Im Zusammenhang mit einer etwaigen Ablehnung der sowjetischen Initiativen durch den Westen ist gerade das Thema der verteidigungsmäßigen Sicherung der Grenze zwischen der DDR und der BRD und der Schaffung einer Nationalen Volksarmee behandelt worden. Es ist angebracht kategorisch denjenigen unter den sowjetischen und russischen »Autoritäten« zu widersprechen, die bemüht sind, die sowjetischen Initiativen im Frühjahr 1952 als politische Finte auszugeben. Der Führer der italienischen Sozialisten Nenni fragte Stalin direkt, wie Moskau reagieren werde, wenn nach den gesamtdeutschen Wahlen proatlantische Fraktionen die Oberhand gewinnen würden. Die Antwort lautete: Das Verdikt wird angenommen. Einige Historiker behaupten, der Beschluss der 2. SED-Parteikonferenz, in der DDR schrittweise die Grundlagen des Sozialismus aufzubauen, sei Ulbrichts Alleingang gewesen. Abgesehen davon, dass Fakten belegen, dass Ulbricht in einem Brief an Stalin vom 2. Juli 1952 um die Stellungnahme des Politbüros des ZK der KPdSU (B) gebeten hatte und dieses Gremium am 8. Juli 1952 unter Leitung Stalins auch die Beschlüsse der 2. Parteikonferenz billigte, frage ich mich: Wäre es überhaupt denkbar gewesen, dass eine so einschneidende Entwicklung der DDR ohne Zustimmung der Besatzungsmacht möglich gewesen wäre? Nach meinem Verständnis kann man die Entscheidung der 2. Parteikonferenz der SED und die Reaktion Moskaus auf diese eher so interpretieren: Stalin warnte die Westmächte wie auch Bonn, dass die Folgen der Einbeziehung der BRD in die NATO nicht auf sich warten lassen werden. Die administrativ staatliche Teilung des Landes wird durch die soziale Spaltung der Nation ergänzt. Mir sind keine Anzeichen von einem Abgehen Stalins von seiner Idee bekannt, dass Deutschland nach Erlangung der Souveränität die gute Nachbarschaft mit der Sowjetunion vorziehen und mit uns gemeinsam einen der Ecksteine für eine bessere Friedensordnung in Europa legen würde. Nur drei Monate nach Stalins Tod und zwei Wochen vor dem 17. Juni 1953 fand am 3. und 4. Juni 1953 in Moskau eine Beratung des Politbüros des ZK der KPdSU mit Ulbricht, Grotewohl und Oelßner statt. Von Seiten der KPdSU nahmen daran u. a. teil: Malenkow, Berija, Molotow, Chruschtschow, Bulganin, Kaganowitsch und Mikojan. Anwesend waren auch Ihr Chef Semjonow und der Oberkommandierende der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, Gretschko. Der DDR wurde eine »fehlerhafte politische Linie« auf ganzer Breite vorgeworfen. Die gleichen Politiker, die noch ein Jahr zuvor die politische Linie der DDR gutgeheißen hatten, distanzierten sich jetzt von ihr. War das das Werk Berijas, den Chruschtschow später als »Provokateur in der deutschen Frage« bezeichnete, oder gab es noch andere Gründe? Der Machtkampf entfaltete sich unterschwellig in Moskau noch vor dem Ableben Stalins. Mit seinem Weggang in eine andere Welt nahm dieser Kampf offene Formen an. Die neuen Machthaber ließen ihre Trümpfe sichtbar werden: Sie versprachen, die Lage des Dorfes zu humanisieren, anderen sozialen Schichten zu gestatten, in den Genuss der Früchte des Friedens zu kommen, Hunderttausenden von Inhaftierten, hauptsächlich kriminelle Rechtsverletzer, die Freiheit zu geben. Die Sphäre der Außenpolitik hörte auf, tabu zu sein. L. P. Berija suchte sich und andere davon zu überzeugen, dass die CDU 1953 die Bundestagswahlen verlieren könnte und somit die neue, von Sozialdemokraten geführte Koalition qualitative Veränderungen in der Haltung Bonns gegenüber der UdSSR einbringen würde. In die Diskussion war auch das Komitee für Information einbezogen worden. Das analytische Papier, das unter meiner Teilnahme im Auftrag des Politbüros erarbeitet wurde, zog die Berija-Prognose in Zweifel. Wir schlussfolgerten, dass der Sieg der SPD wenig wahrscheinlich ist und sogar im Falle ihres Erfolgs die Bundesrepublik in naher Zukunft sich nicht aus der Vormundschaft Washingtons losreißen werde. Ohne sich mit irgendeinem der Mitglieder des Areopags[Anmerkung 153] abzustimmen, beauftragte Berija seine »persönlichen Agenten« zu klären, welchen Preis Washington, London und Paris bereit seien an Moskau zu zahlen, wenn es das westliche Modell der Vereinigung Deutschlands annehmen würde. Berija glaubte nicht an die »Lebensfähigkeit« der DDR. Seine zynische Vorstellung lautete: Besser ist, für eine »angemessene Belohnung« die DDR aufzugeben, als sie bloß zu verlieren. Der Reparationsdruck sowie die Einbeziehung in den verheerenden Rüstungswettlauf wirkten sich enorm auf das Lebensniveau der DDR Bevölkerung aus. Jedes weitere Festziehen der Schrauben drohte zu einem Ausbrechen der offenen Unzufriedenheit zu werden. Nicht ohne das aufmunternde Wirken der westlichen Medien wurden die Ungereimtheiten und Probleme des Alltags politisiert. Eine Krise reifte heran. Mit unserer Teilnahme wurde am Vorabend des 17. Juni 1953 ein Paket von Maßnahmen erarbeitet, mit denen die gegenseitigen Beziehungen zwischen der UdSSR und der DDR vom Besatzungsbeigeschmack gereinigt wurden. Das Kapitel der Reparationsabgaben wurde geschlossen. Die Republik konnte nunmehr über die Unternehmen verfügen, die früher zum gemeinsamen Eigentum gehörten. Unter anderem hatte man auch im Auge, Walter Ulbricht seiner Solopartien zu entledigen, wenn nicht überhaupt in die zweite oder dritte Reihe zu geleiten. Aber in der Hektik verpasste man, den Beschluss über die Lohnkürzungen für die Bauarbeiter sofort rückgängig zu machen. Und nicht von ungefähr meint man im Volke: Eine verlorene Minute ist in vielen Jahren nicht aufzuholen. Oder anders ausgedrückt: Es gibt keine größere Weisheit als die Rechtzeitigkeit, wie Francis Bacon[Anmerkung 154] meinte. Berija hat für seinen Versuch, »den Freund und Verbündeten der UdSSR, die sozialistische Deutsche Demokratische Republik«, zu verraten, teuer bezahlt. Chruschtschow versäumte nicht, mit seinem Hauptrivalen im Machtkampf abzurechnen. Bis heute sind jedoch nicht die Punkte auf dem i gesetzt: Sind von den ersten Personen der DDR selbst aus den Ereignissen vom Juni 1953 die adäquaten Schlussfolgerungen gezogen worden? Die damalige sowjetische Führung ließ eine verhängnisvolle Fehlkalkulation zu – sie gab das Banner der nationalen Einheit Deutschlands aus den Händen. Von da an wurde dieses Feld von den »Demokraten« usurpiert. Eine weitere Grimasse der Politik. Zwischen 1958 und 1961 verstärkte die UdSSR ihre Bemühungen um den Abschluss eines Friedensvertrages mit Deutschland. Im Mai 1961 hat Chruschtschow gegenüber Kennedy erklärt, sollte dies nicht möglich sein, werde die UdSSR einen Friedensvertrag nur mit der DDR abschließen. Nach dem 13. August 1961 hat Ulbricht in einem Schreiben an Chruschtschow den Abschluss eines solchen Vertrages angemahnt und Vorschläge dazu unterbreitet. Am 28. September 1961 antwortete der sowjetische Ministerpräsident, es sollten alle Schritte vermieden werden, die die Situation verschärfen könnten. Was war passiert, dass sich die UdSSR von ihrem eigenen langfristigen Vorhaben, einen Friedensvertrag abzuschließen, schrittweise verabschiedete? Die Situation in den Jahren zwischen 1958 und 1961 ist durch eine Reihe von Ereignissen von erstrangiger Bedeutung gekennzeichnet. N. S. Chruschtschow machte sich daran, Westberlin seiner Funktion als »der billigsten Atombombe im Leibe der DDR« zu entledigen. Seine Rhetorik wurde durch Bezugnahme auf die Regelungen in den Jahren 1945/47 untermauert, u. a. mit einem Bericht des Kontrollrates, wo schwarz auf weiß festgeschrieben war: »Großberlin ist das Gebiet, das gemeinsam von vier Mächten besetzt ist, … und ist gleichzeitig die Hauptstadt der sowjetischen Besatzungszone.« Die Defacto-Spaltung Deutschlands begann mit der Spaltung Großberlins. Die Andeutung – die traditionell amerikanische »erweiterte Interpretation« internationaler Vereinbarungen werde nicht ohne Folgen bleiben – hätte Eindruck machen können. Eine einseitige Revision der Festlegungen des Kontrolrates bezüglich Großberlin stellte den Status der Luftkorridore infrage. Aber das kam nicht aus dem Außenministerium der UdSSR, und Chruschtschow hat sich für die Vorgeschichte nicht interessiert. Stattdessen begann er zu drohen entweder Verwandlung Westberlins in eine freie Stadt oder Abschluss eines Friedensvertrages der Sowjetunion mit der DDR, nach dem alle Vollmachten zur Organisation der Außenbeziehungen Westberlins auf die Republik übergehen würden. Es begann eine neue Etappe in der Konfrontation um Berlin. 1959 fanden Verhandlungen der Außenminister der vier Mächte statt. Erstmalig waren auf ihnen mit Lothar Bolz die DDR und mit Heinrich von Brentano die BRD vertreten. Das Hauptergebnis des gespannten Meinungsaustausches bestand darin, dass die Tür nicht zugeschlagen wurde. Ein übler Streit ist besser als eine gute Schlägerei. Bald »entdeckte« Chruschtschow Amerika und nahm nicht ganz inhaltslose Gespräche mit dem Präsidenten der USA Dwight Eisenhower auf. Und wie es der Teufel will, ohne Einladung flog Powers[Anmerkung 155] in das Gebiet von Swerdlowsk ein und war abgeschossen! Der Abbau der Hindernisse wurde bis in die Zeiten von John Kennedy verschoben. Im Mai 1961 fand das Wiener Gipfeltreffen statt. Es gelang wiederum nicht, sich vom toten Punkt wegzubewegen. Die Leidenschaften erhitzten sich immer mehr. Chruschtschows Drohung, wenn wir uns nicht im Guten verständigen, riegeln wir die Grenze ab, provozierte eine Massenflucht aus der Republik. Walter Ulbricht bestand gegenüber dem sowjetischen Botschafter M. G. Perwuchin darauf, Klarheit zu schaffen: Besser ein schreckliches Ende als ein Schrecken ohne Ende, wie es Friedrich Schiller ausdrückte. Nach dem Wiener Gipfeltreffen, an dem ich als Experte teilnahm, sah mein Arbeitstag etwa so aus: Von 9 bis 17 Uhr– Routinearbeit im Außenministerium, von 18 Uhr bis Mitternacht – im Büro von Chruschtschow. Das zog sich ohne nennenswerte Pausen bis Mitte 1963 hin, als ich aus gesundheitlichen Gründen aus dieser Konstellation ausschied. Mir entging nicht die nicht völlig diplomatische Belebung in den Korridoren der Kremlmacht, die vor dem 13. August 1961 herrschte, vor der Errichtung von Hindernissen und dann der Mauer, die Berlin zerschnitt. Im Oktober 1961 wurde ich in die Mannschaft eingeführt, die die äußerst gefährliche Konfrontation am Berliner Checkpoint Charlie abzubauen hatte. Die USA und die UdSSR trennten buchstäblich 80 bis 100 Meter vom Abgrund, in den sowohl die Rechthabenden als auch die Nichtrechthabenden stürzen konnten. Jede Vereinfachung ist eine Entstellung der Wahrheit. Der Geschichte als genaue Wissenschaft sind Figuren des Verschweigens, des Durcheinanderbringens von Ursache und Wirkung, der Ausgabe von Farcen als Fakten völlig abträglich. Für das Unglück, das das Schicksal von zwei, drei Generationen nach 1945 belastete, sind die Deutschen denjenigen verpflichtet, die ihr Land spalteten, die Westdeutschland in ein Aufmarschgebiet gegen die Sowjetunion und ihre Verbündeten verwandelte, um Washingtons Anspruch auf Weltherrschaft durchzusetzen. Ebenso wie man unter einem Heidenlärm des Aufzwingens von »Demokratie« und »Freiheit« auf amerikanische Art in den 60er und 70er Jahren Indochina in die Steinzeit zu versetzen trachtete. Die Flucht von Einwohnern der DDR gen Westen schadete gewiss dem Prestige der Republik. Und nicht nur dem Prestige. Die offene Grenze kostete der DDR-Wirtschaft jährlich 38 bis 40 Milliarden Mark. »Geduld ist die Kunst Hoffnung zu hegen«, sagte Vauvenargues[Anmerkung 156] erschöpflich. . Doch Geduld ist auch Ich werde mich nicht zur Rechtfertigung auf Präzedenzfälle aus der Weltpraxis beziehen, die Mauern kennt, die höher und länger als die von Berlin sind. Auf die Waagschale, die die sowjetische Seite zu den radikalen Maßnahmen bewegte, drückten vor allem akute Gefahren für unsere nationale Sicherheit. Der »Atomgürtel« durch Berlin als Pendant zum Kernladungsgürtel, den die Amerikaner von Schleswig-Holstein bis Bayern gezogen haben, war nicht denkbar. Es blieb somit ein Ersatz. Haben nun die Länder des Warschauer Vertrages bei der Durchführung ihrer Antwortmaßnahmen die Schwelle der notwendigen Verteidigung überschritten? Die Antwort gab der Chef des CIA Hauptquartiers in Westberlin, der Mitte der 90er Jahre anerkannte: Der Mauerbau hat auf Jahre hinaus die NATO-Pläne auf der europäischen Kriegstheaterbühne durcheinandergebracht. »Enthaltsamkeit ist der Hüter des Lebens«, mahnten die Weisen der Antike. Die Ereignisse von August/September 1961 demonstrierten Washington die Bereitschaft Moskaus, seine Lebensinteressen zu verteidigen. Gleichzeitig lehnte die Sowjetunion die Suche nach Regelungen auf der Grundlage eines Konsenses der vier Mächte, der auch für beide deutsche Staaten annehmbar war, nicht ab. Ende November sah es nach einem Lichtstreif aus. In der Botschaft von John Kennedy an N. S. Chruschtschow sprach sich der Präsident für das Ausbalancieren der Interessen beider Großmächte aus, dabei die früheren alliierten Regelungen mit der Ausformung der sich neu ergebenden Praxis verbindend. Der sowjetische Führer nahm die Vorschläge des Hausherren des Weißen Hauses mit dem Vorbehalt der Notwendigkeit an, sich an den Imperativen der friedlichen Koexistenz und dabei nicht nur am Prinzip der Gleichheit, sondern auch an der Grundlage gleicher Prinzipien zu orientieren. Mich beauftragte man, die Antwortbotschaften Chruschtschows vorzubereiten, und ich kann mich dafür verbürgen, dass sich zumindest auf dem Papier ein Modell des gegenseitigen Verständnisses abzeichnete. Diese korrespondierte nicht in allem mit der Position von Konrad Adenauer. Darauf wurde die Aufmerksamkeit Kennedys gelenkt. »Die Zustimmung Bonns zu erhalten«, so antwortete der Präsident, »ist nicht Ihre Sorge«. Die Intensität des Austauschs von Botschaften hat zum Herbst 1962 merklich abgenommen. Ich erinnere daran, dass der Dialog zwischen Kennedy und Chruschtschow im November 1961 startete. Auf denselben November fällt der Befehl des Präsidenten, die Operation »Mongoose«, des vernichtenden Schlages gegen Kuba, vorzubereiten. Dies geschah in augenscheinlicher Verletzung der in Wien gegenüber Chruschtschow geäußerten Versicherungen und zwar: die Landung in der Schweinebucht[Anmerkung 157] sei ein Fehler, die USA lassen Fidel Castro in Ruhe. »Mongoose« wurde begleitet durch die Verlegung der »Jupiter-Raketen« – der Raketen des Erstschlages, gerichtet gegen die Kommandozentren der UdSSR zu deren »Enthauptung« – auf das Territorium der Türkei und Italiens. Ein weiteres Mal erteilte man uns die Lehre, auf das Wort der US-Führer wie auch auf die von ihnen übernommenen Vertragsverpflichtungen gibt es keinen Verlass. Die Festlegung aus der Eisenhower-Zeit, dass Verhandlungen eine »Waffe im politischen Krieg« (»political warfare weapon«, Memorandum des Nationalen Sicherheitsrates) seien, hat Washington offensichtlich weder früher noch heute ins Archiv gelegt. Nach seiner Rückkehr aus Moskau vom Gipfel der Staaten des Warschauer Vertrages, der die Maßnahmen vom 13. August 1961 beschlossen hatte, äußerte Ulbricht im Politbüro, dass der Ausbau der DDR-Staatsgrenze zu Westberlin zwar notwendig sei, aber leider auch dazu führen würden, dass die Politik einer Konföderation zwischen beiden deutschen Staaten obsolet würde. Als Sie sich im Auftrage von M. S. Gorbatschow am 24. November 1989 zu einer damals geheimen Konsultation mit mir in den Räumen der sowjetischen Botschaft in Berlin trafen,[132] brachten Sie die Konföderationsidee erneut ins Gespräch. Was waren Ihre Beweggründe? Die Idee der deutschen Konföderation hob der Finanzminister der BRD F. Schäffer[Anmerkung 158] auf das politische Niveau. Er fuhr geheim nach Ostberlin und rechnete damit, in einem persönlichen Treffen Walter Ulbricht in die Bereitschaft der Anti-Adenauer-Fronde, Bonn von der NATO auf eine nationale Welle umzustimmen, einzuweihen. Die Absicht Schäffers wurde nach zuverlässigen Angaben von R. Maier[Anmerkung 159] und anderen Freien Demokraten geteilt, mit ihr sympathisierte auch Franz Josef Strauß. Der Beginn spornte nicht zur Begeisterung an. Zu Walter Ulbricht wurde Schäffer nicht zugelassen, man schlug ihm vor, sich mit Markus Wolf und einem Kollegen von Markus aus den sowjetischen Geheimdiensten zu treffen. Washington und Moskau, die, das versteht sich, unterschiedliche Ziele verfolgten, ist es nicht gelungen, die beiden Antipoden Adenauer und Ulbricht an einen Tisch zu setzen. Dulles[Anmerkung 160] suchte den Kanzler zu überzeugen, dass das Größere mit der Zeit das Kleinere sich unterordnet. In unserem Verständnis galt es, den Erfolg des »Zurechtschneidens« der österreichischen Sackgasse zu entwickeln, den Europäern zu zeigen, dass es zum »Balancieren am Rande des Abgrunds« eine Alternative gibt. Die Deutschen haben damals wohl die beste von allen realen Chancen nach eigenem Gutdünken zu leben, verschmäht. Auch der »Deutschlandplan« der SPD zog nicht. Die wohlwollenden Absichten von Otto John[Anmerkung 161] und Axel Springer scheiterten schon an unserer eigenen Beschränktheit. Sie interessieren sich dafür, was mich bei unserem Treffen am 24. November 1989 bewog, an die Idee der Konföderation zu erinnern? Der sich entfaltende Disput »4+2« eröffnete objektiv die Möglichkeit, eine etappenweise Annäherung der zwei deutschen Staaten zur Grundlage zu nehmen. Sogar Teltschik scheute nicht vor einer solchen beweglichen Abfolge zurück. London und Paris »empfahlen« M. S. Gorbatschow beharrlich, der mechanischen Verbindung des Großen mit dem Kleineren zu widersprechen. Sie waren es, die den Begriff der Konföderation, wobei in eingeschränkter Reaktion, belebten. Margret Thatcher und Francois Mitterrand schlossen die Beibehaltung der Mitgliedschaft der BRD in der NATO und der DDR in der Organisation des Warschauer Vertrages nicht aus. Washington zeigte sich bezüglich der Spaltung Deutschlands nicht besonders betrübt. Ihm genügte völlig diese oder jene Form des Heraustrennens der DDR aus dem sowjetischen Verteidigungssystem. Folglich – man hatte eine Wahl. Bis jetzt hat M. S. Gorbatschow seine Gründe für die Aufgabe der Großmachtinteressen des eigenen Landes für eine Prise Tabak nicht vernehmlich offengelegt. Sie schildern in Ihren Erinnerungen eine Begegnung mit Walter Ulbrich, bei der Sie ihn über Aktivitäten der UdSSR mit ihren Partnern aus den USA und der BRD informierten. Sie machen dazu die sarkastische Bemerkung: »Mit Bundesgenossen auf höchster Ebene zu diskutieren, ist nicht der Brauch. Für solch eine unangenehme Mission gibt es Emissäre.« Wussten Sie damals, dass L. I. Breschnew zu diesem Zeitpunkt längst im direkten telefonischen Kontakt mit Erich Honecker[Anmerkung 162] alle die Berlin-Verhandlungen betreffenden Fragen, die die DDR angingen, diskutierte? Selbst die Höhe des Mindestumtausches von DM in Mark der DDR für Besucher aus dem Westen wurde von ihm vorgegeben. Unsere »Zauberei« mit Bahr und Rush erfolgte in einem streng geheimen Regime. Bis zur Überleitung des Verhandlungsprozesses in ein vierseitiges Format durften davon London, Paris und Ostberlin nichts wissen. Wann, was und wie Botschafter P. A. Abrassimow mit Erich Honecker besprach, ist mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, ob Abrassimow meinen Telegramm-Wechsel mit Moskau (bis zu meiner Versetzung nach Bonn erfolgte er über den Kanal der Botschaft der UdSSR in der DDR) ausnutzte. Wenn er es getan hat, so verletzte er grob das strengste Verbot. Ihr Kollege Julij Alexandrowitsch Kwizinskij, einer Ihrer Nachfolger als Botschafter der UdSSR in Bonn, hat in seinen Buch »Vor dem Sturm« vermerkt, dass das Verhältnis seines Landes zur DDR in gewisser Hinsicht »schizophren« war. Wie sehen Sie dies im Rückblick? J. A. Kwizinskij verfügte über ausreichende Fähigkeiten. Seine intellektuellen Voraussetzungen regten mich an, A. A. Gromyko vorzuschlagen, Kwizinskij unter Umgehung aller Karriereformalitäten vom 1. Sekretär der sowjetischen Botschaft in Berlin in die Funktion eines Stellvertretenden Leiters der 3. Europäischen Abteilung des Ministeriums zu heben. Ich gebe zu, Julij Kwizinskij gab später Anlässe, an eine Bemerkung von Konstantin Stanislawski zu erinnern: Je talentierter ein Maler ist, desto gefährlicher sind seine Fehler. Man lernt nie aus. Sie sind ein exzellenter Kenner der deutschen Geschichte. Was sagen Sie zu der Meinung des bekannten bürgerlichen Publizisten Sebastian Haffner, der Ulbricht 1966 als den erfolgreichsten deutschen Politiker nach Bismarck und neben Adenauer bezeichnete? Er meinte, in Deutschland habe Ulbricht nach Adenauers Abgang keinen Gegenspieler, der ihm das Wasser reichen könne. Wenn Sie zurückblicken und Walter Ulbricht in die widersprüchliche Geschichte des 20. Jahrhunderts einordnen, was möchten Sie hervorheben? Jede historische Epoche ist auf ihre Art unikal. Das Alltägliche von gestern lässt sich schlecht mit dem heutigen koppeln und noch weniger mit dem künftigen in Einklang bringen. Wissen ist der Harnisch vor Missgeschick. »Der die Unwahrheit Säende wird Unheil ernten«, heißt es bei König Salomo in der Bibel. Die Unwahrheiten über vergangene Tage legen Minen für den Zugang zur Wahrheit heute, zwingen irrige Überlegungen über die Herausforderungen von Morgen auf. Die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts außer der Wahrheit über sich und auch über die anderen, wurde ich nicht müde gegenüber Gorbatschow zu wiederholen. Nur sie hilft der Gesellschaft, den zweiten Atem zu erlangen. Ich nahm Bezug auf W. I. Lenin – »Die Wahrheit darf nicht von dem abhängen, dem sie dient«. O weh! Ich wurde nicht gehört. Die Wahrheit hängt nicht an der Zeitdauer. Kann man sich das wahre Bild Nachkriegseuropas und nicht nur Europas nicht vorstellen, wenn man aus ihm die Deutsche Demokratische Republik ausstreicht? Kann man die soziale Demontage, die die Europäische Union erschüttert, und das Verlassen der historischen Bühne durch die UdSSR und nicht zuletzt durch die DDR voneinander trennen? Niemandem wird es gelingen zu beweisen, dass die »sozialen Neuerungen« die Immunität unserer Staaten untergraben haben. Nein, wir fielen dem Kreuzzug, der als Kalter Krieg bezeichnet wurde, zum Opfer diesem, wie die amerikanischen Neokonservativen offen erklären, Schlusskapitel des Zweiten Weltkrieges. Und wir selbst sind schuld daran, weil wir uns als unachtsame Schüler der Geschichte erwiesen. Das Werden der Deutschen Demokratischen Republik ist aufs engste mit der Persönlichkeit Walter Ulbrichts verbunden. Es führt zu nichts, wenn man ihn als Taufpaten der Republik in den Himmel hebt. Aber zweifellos ist etwas anderes wahr – seine Energie, Zielstrebigkeit, sein schöpferischer Geist prägten die Errungenschaften der DDR in Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft. Bezüglich der Sorge um die Kinder, um die Jugend, um die älteren Bürger hatte die DDR kaum ihresgleichen. Und die DDR-Schulen, das System des Gesundheitswesens, der Sport waren Muster zur Nachahmung, zwangen die gleiche Bundesrepublik »freiwillig« dem Verpönten nachzuahmen. Meines Erachtens sollte man aus dem Erbe Walter Ulbrichts in erster Linie das bewahren, was seine Opponenten und Feinde zwang, mit ihm zu rechnen – die Fähigkeit, Spreu vom Weizen zu unterscheiden und sogar in der Finsternis die Kehrseite von Versprechen und von Erscheinungen zu erkennen. Walter Ulbricht vergaß nie, dass ein Pelz von einer fremden Schulter sich in eine Zwangsjacke verwandeln kann, dass geborgtes Leben ein teurer Genuss ist. Der Wohltäter wird nicht darauf verzichten, für seine Dienstleistung den Wucherzins abzuschneiden.
Herbert Mies: Revolution im Salonwagen des Zaren
Herbert Mies, Jahrgang 1929, Schriftsetzer, seit 1949 (bis 1953) Mitglied des Zentralbüros, bis 1956 Vorsitzender der illegalen FDJ in der BRD. Seit 1954 Mitglied des ZK, seit 1963 Kandidat des Politbüros der illegalen KPD. 1954 Mitbegründer des »Studentenkurier«, der 1957 in der »konkret« aufging. Mitbegründer der DKP 1969, zunächst Stellvertretender Parteivorsitzender, von 1973 bis 1990 Vorsitzender der Partei. Nach seinem Rücktritt ehrenamtlicher Vorsitzender des Mannheimer Gesprächskreises Geschichte und Politik und Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Mannheim-Schönau. Im November 1960 kamen Vertreter von 81 kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau zusammen. Die Delegation der verbotenen KPD wurde vom Parteivorsitzenden Max Reimann[Anmerkung 163] geleitet, dessen persönlicher Referent ich war. Ihr gehörten noch die Politbüromitglieder Oskar Neumann und Jupp Schleifstein an. Wir reisten ab Berlin in einem Sonderzug gemeinsam mit der SED Delegation. Auch Otto Grotewohl war im Zug, doch er fuhr zu einer medizinischen Behandlung. In Brest gab es einen dreistündigen Aufenthalt, wir wechselten die Untergestelle der Waggons, zudem wurden Salonwagen angehängt, die schon vom Zaren benutzt worden waren. Werner Eberlein, der für Ulbricht dolmetschte, kam vorbei und sagte, dass sein Chef mit uns zu Abend speisen und einiges besprechen wolle. Ulbricht begrüßte uns mit der Bemerkung: »Na, habt ihr schon die Rede fertig?« Wir verneinten. Dann sollten wir darüber reden, sagte er. »Wenn du willst, kannst du dir Notizen machen«, sagte er in meine Richtung. Ich hatte ihn verstanden. Wir nahmen an, dass Ulbricht uns auf die Auseinandersetzung der KPdSU mit der chinesischen Partei einstimmen würde, denn der Konflikt zwischen den beiden größten kommunistischen Parteien hatte natürlich Auswirkungen auf alle. Doch Ulbricht hakte das Thema gleich ab. Er kam stattdessen auf die Lage der Arbeiterklasse in der Bundesrepublik zu sprechen und zeigte sich bestens informiert. Kurz zuvor hatte es den Verbandstag der Metallarbeiter gegeben, und es waren Betriebsratswahlen abgehalten worden. Er meinte, dass die Beschlüsse und die Rede von Otto Brenner[Anmerkung 164] dem »Versuch einer selbständigen Gewerkschaftspolitik und Alternative« darstellten. Auf ihrer Grundlage sollten wir jetzt in den Betrieben und in den Gewerkschaften »alle prinzipiellen Fragen aufwerfen und die Perspektiven erläutern«. Wir müssten »klug und umsichtig« in den Gewerkschaften arbeiten und bei den Kontakten zu den Gewerkschaftsfunktionären Vorsicht walten lassen, wir dürften diese nicht gefährden. Ich spürte, dass das Gewerkschaftsproblem ihm sehr am Herzen lag, da schien er sich auch aufgrund eigener Erfahrungen ziemlich gut auszukennen. Sodann kam er auf die Wirksamkeit der politischen Arbeit unserer Partei zu sprechen. Wie steht es um die legale propagandistische Arbeit? Erreichen wir die Massen? Wie verhält sich die westdeutsche Arbeiterklasse zur Westberlin-Frage?[Anmerkung 165] In Moskau kam es nicht unerwartet zum Eklat, der bereits seit Jahren schwelte. Die Genossen in Peking folgten der Linie des XX. Parteitages nicht und meinten, dass die Führung der KPdSU vom Marxismus-Leninismus abrücke. Für sie waren beispielsweise die Gespräche Chruschtschows mit US Präsident Eisenhower 1959 oder die Verweigerung militärischer Unterstützung ihres Grenzkonflikts mit Indien Ausdruck von unzulässigen Zugeständnissen. Mao Tse-tung[Anmerkung 166] reklamierte zudem nach dem Tod Stalins die Führungsrolle in der kommunistischen Weltbewegung, weil er der Chef der größten Partei war und überdies am längsten eine solche KP führte, nämlich seit 1943. Ein halbes Jahr zuvor, im Juni 1960, hatte Chruschtschow in Bukarest auf dem Parteitag der rumänischen Kommunisten Chinas Innenpolitik kritisiert und Mao »einen Nationalisten, einen Abenteurer und einen Abweichling« genannt, worauf Peking ihn als Revisionisten bezeichnete, der sich »patriarchalisch, willkürlich und tyrannisch« verhalte. Daraufhin hatte der erste Mann der KPdSU in einem 80-seitigen Schreiben die Führung in Peking verurteilt. Jetzt, so fürchteten wir, würde auf der Konferenz in Moskau diese Kontroverse offen ausgetragen werden. Ulbricht aber wollte sich dazu im Zug offenkundig nicht äußern. Und auch auf der Konferenz exponierte er sich nicht. Die chinesischen und die albanischen Genossen provozierten und strapazierten die Geduld der Konferenzteilnehmer, und wir meinten, darauf reagieren zu müssen. Neumann, Schleifstein und ich arbeiteten immer wieder die Rede um. Den dritten Entwurf zeigte ich Ulbricht. Er schaute ihn sich an und sagte nur, es wäre besser, wenn wir unsere Arbeit in der Bundesrepublik nicht so weit nach hinten stellen würden. – Ziemlich geschickt nahm er auf diese Weise unserer antichinesischen Lanze die Spitze. Am Ende der Konferenz kam eine Resolution zustande, mit der eine förmliche Spaltung der kommunistischen Weltbewegung vermieden wurde. Ulbrichts taktisches und strategisches Gespür sollte ich acht Jahre später noch einmal erleben. Intern diskutierten wir schon lange über die Perspektiven unseres Handelns. Die KPD war in den 50er Jahren von den Antikommunisten verboten worden, die Partei arbeitete illegal, was natürlich kaum Wirkung hatte. Wir kämpften seither zwar für die Wiedererlangung der Legalität, doch die Aussichten, dass die herrschende Klasse der Bundesrepublik sich revidierte, schien gering. Gleichwohl brauchte dieses Land eine konsequent linke, marxistische Partei. Deshalb dachten wir gleichzeitig über die Neukonstituierung der kommunistischen Partei nach. Die politische Führung der KPD unternahm dazu erste Schritte. Wir waren in Moskau und konsultierten die Führung der KPdSU. Bis auf Ponomarjow,[Anmerkung 167] der Bedenken anmeldete, waren alle dafür. In Berlin stimmte man auch zu, wobei es eine interessante Diskussion gab, als es um den Parteinamen ging. Jupp Ledwohn provozierte sie, indem er fragte, was man von Deutscher Kommunistischer Partei hielte statt Kommunistische Partei Deutschlands? Walter Ulbricht sagte, ohne zu zögern, er hielte den Namen für »goldrichtig«, denn sie sei eine »deutsche Partei«, eine Partei in der Bundesrepublik, die dort handeln und Politik machen werde, und so solle sie auch international wahrgenommen werden. Auf eine entsprechende Nachfrage Ledwohns bestätigte er, der Name »Sozialistische Einheitspartei Deutschlands« sei und bleibe richtig: politisch und perspektivisch. Wir hatten verstanden. Diese von mir als Geste der Überlegenheit empfundene Haltung bekamen wir gelegentlich zu spüren, ich meinte, dass insbesondere Max Reimann von ihm bisweilen herablassend und etwas selbstherrlich behandelt wurde. So erinnere ich mich etwa an die 23. Parteivorstandstagung der KPD am 18. März 1956, wenige Tage nach dem XX. Parteitag der KPdSU, auf der etliche von uns erregt Ulbricht kritisierten, weil er wenig Herz und Gefühl gezeigt hatte für Genossen, die mit der Abrechnung mit Stalin nicht klarkamen. Nach jener Zusammenkunft im Frühsommer 1968 in Berlin verabschiedete Ulbricht jeden von uns mit Handschlag. Dabei flüsterte mir der 75-jährige Ulbricht ins Ohr: »Lasst euch von den Älteren nicht bremsen.« Ich war damals 39. Dieser Eindruck, dass Ulbricht einen politischen Neuansatz wünschte, der der politischen Realität entsprach – was in gewisser Weise auch einen personellen Bruch bedeuten musste, sollte er glaubwürdig sein –, bestätigte mir Jahre später Max Spangenberg.[Anmerkung 168] Ulbricht sei es nicht nur darum gegangen, dass der Kampf um die Legalisierung der KPD weitergeführt würde, dass man diesen undemokratischen Akt nicht einfach hinnahm und zu den Akten legte. Zugleich aber wollte er auf diese Weise das alte KPD-Führungspersonal von der Leitung der DKP fernhalten. Bekanntlich trat Max Reimann auch erst 1971 der Deutschen Kommunistischen Partei bei und wurde dann deren Ehrenvorsitzender. Für mich bleibt – bei aller Kritik gültig, was Max Reimann, der damalige DKP-Vorsitzende Kurt Bachmann und ich in unserer Kondolenz im August 1973 an das ZK der SED schrieben: »Wir Kommunisten der Bundesrepublik schätzten Walter Ulbricht als einen hochverdienten Funktionär der deutschen und der internationalen revolutionären Arbeiterbewegung, der sein Leben dem Befreiungskampf der Arbeiterklasse widmente.«
Jewgenij Tjashelnikow: Sein Interesse an Jugendfragen war erkennbar groß
Jewgenij M. Tjashelnikow, Jahrgang 1928, 1950 Absolvent des Pädagogischen Instituts in Tscheljabinsk, 1951 Mitglied der KPdSU, 1960 Doktor der Geschichtswissenschaften, 1961 bis 1964 Rektor des Pädagogischen Instituts in Tscheljabinsk, danach Sekretär des Gebietskomitees der KPdSU im Gebiet Tscheljabinsk, 1971 bis 1990 Mitglied des ZK der KPdSU, 1. Sekretär des ZK des Komsomol von 1968 bis 1977, danach, bis 1982, Leiter der Abteilung Propaganda des ZK der KPdSU. 1982 bis 1990 Botschafter der UdSSR in Rumänien. Botschafter der UdSSR im Ruhestand. Walter Ulbricht kannten wir in der UdSSR sehr gut. Wir schätzten ihn als mutigen Kämpfer gegen den Nazismus, als aufrechten Internationalisten und guten Freund, als Helden der Sowjetunion.[Anmerkung 169] Als Aspirant an der Moskauer Staatlichen Universität besuchte ich 1960 zusammen mit Freunden anlässlich des 15. Jahrestages des Sieges über den Faschismus das Museum deutscher Antifaschisten in Krasnogorsk.[Anmerkung 170] Wir erfuhren dort von der Tätigkeit Walter Ulbrichts unter den deutschen Kriegsgefangenen und seinem Beitrag an der Gründung und der Arbeit des Nationalkomitees »Freies Deutschland«. Erstmals persönlich erlebte ich Walter Ulbricht am 30. März 1966, als er zu uns, den Delegierten des XXIII. Parteitages der KPdSU, sprach. Persönlich begegnete ich ihm während der Internationalen Beratung kommunistischer und Arbeiterparteien, die vom 5. bis 17. Juni 1969 in Moskau stattfand. Bei einer Zusammenkunft mit ihm erfuhren wir von seiner kampferfüllten Jugend. Er erwähnte, wie er schon als 15-Jähriger in die Organisation der Sozialistischen Jugend eintrat, 1912 Mitglied der SPD wurde, sich der Gruppe um Karl Liebknecht und 1918 dem Spartakusbund anschloss. Er berichtete aus den Tagen der Novemberrevolution 1918, als er dem Arbeiter- und Soldatenrat in Leipzig angehörte, und wie er später gemeinsam mit Ernst Thälmann und Wilhelm Pieck dazu beitrug, die KPD zu einer marxistisch-leninistischen Massenpartei zu entwickeln. Völlig überraschend für uns war, dass er 1928 auch der Kommunistischen Partei der Allunion (Bolschewiki), kurz WKP (B), beigetreten war, die 1952 in KPdSU umbenannt wurde. Und im Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale vertrat er die KPD. In unserem Gespräch interessierte sich Walter Ulbricht für die Zusammenarbeit von Komsomol und FDJ. Er fragte, wie die KPdSU die Jugendpolitik organisiere. Ulbricht regte an, diese Zusammenarbeit enger und effektiver zu gestalten, und begrüßte den Vorschlag, 1970 in Dresden ein »Festival der Freundschaft zwischen der Jugend der UdSSR und der DDR« durchzuführen. Zum 20. Jahrestag der DDR im Oktober 1969 lud er eine Delegation des Komsomol nach Berlin ein. Ich hatte die Ehre, der Partei- und Staatsdelegation unter Leitung von L. I. Breshnew anzugehören, die mehrmals mit Walter Ulbricht zusammentraf. Als wir am 5. Oktober 1969 in der DDR-Hauptstadt eintrafen, sahen wir überall ein Plakat mit einem bezaubernden Mädchen und dem Ausspruch: »Ich bin zwanzig.« Mit innerer Bewegung erinnere ich mich an die Festveranstaltung, an der Delegationen aus 84 Ländern teilnahmen. In seiner Festrede zeichnete Walter Ulbricht ein beeindruckendes Bild der Leistungen der Werktätigen der DDR. Er sprach allerdings auch über die noch ungelösten Probleme. Für ihn gehörte beides zusammen. Gern denke ich auch an die aus innerer Überzeugung gesprochenen Begrüßungsworte Breshnews an die Adresse der DDR: »Der Sozialismus siegte auf eurem Boden unwiderruflich. Das ist der Wille des Volkes der DDR. Er ist verankert in der sozialistischen Verfassung, die durch einen Volksentscheid gebilligt wurde. Die sozialistischen Errungenschaften sind den Werktätigen mit keinem Mittel, weder mit militärischen, politischen, noch mit Intrigen und Provokationen wegzunehmen.« Wir erlebten in Berlin eine Militärparade, eine Demonstration der Werktätigen und die Manifestation der Jugend, die mit einem Marsch eines viel tausendköpfigen Orchesters der FDJ und einem Fackelzug abgeschlossen wurde. Leonid Iljitsch hat über fünf Stunden mit Begeisterung dieser mitreißenden Schau beigewohnt. Am Abend trafen er und Ulbricht mit den führenden Repräsentanten der Länder des Warschauer Vertrages zusammen, die rumänische Delegation blieb der Zusammenkunft fern. Es fand eine sehr offene Aussprache zu den wichtigsten internationalen Problemen statt, im Zentrum standen die Vorbereitung einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa sowie die Beziehungen mit den USA und China. Während dieser Zeit verhandelte unsere Komsomol-Delegation im Zentralrat der FDJ. Am Ende unterzeichneten sie einen Plan der Zusammenarbeit für das Jahr 1970. Mit Günther Jahn, Egon Krenz, Frank Bochow und ihren Kollegen waren wir am Brandenburger Tor, trafen uns mit Grenzsoldaten der DDR und Angehörigen der Gruppe Sowjetischer Streitkräfte in Deutschland. Ihr Oberkommandierender, Armeegeneral Wiktor G. Kulikow, informierte uns über die Geschichte der Berliner Mauer. Er nannte Einzelheiten, wie sich die Spaltung Deutschlands und Europas vollzog und wie die Ostgrenze der BRD zur Staatsgrenze mit der DDR wurde. Er sprach von der Konfrontation der beiden mächtigsten militärischen Blöcke der Welt, der NATO und der Organisation des Warschauer Vertrages. Kulikow erinnerte an die Erklärung der Warschauer Vertragsstaaten vom August 1961, in der es hieß, dass sich die Regierungen der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages mit dem Vorschlag an die Volkskammer und die Regierung der DDR wandten, an den Grenzen zu Westberlin eine solche Ordnung herzustellen, die zuverlässig den Weg für eine subversive Tätigkeit gegen die Länder der sozialistischen Staaten versperrte, die um das gesamte Territorium Westberlins, einschließlich seiner Grenze zum demokratischen Berlin, einen zuverlässigen Schutz und eine effektive Kontrolle gewährleiste. Der Oberkommandierende der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, so meine ich, wollte damit deutlich machen, dass die Grenzsicherungsmaßnahmen der DDR nicht ein Alleingang der DDR oder gar Ulbrichts waren, sondern eine Entscheidung des Bündnisses. Schließlich handelte es sich bei der Staatsgrenze West der DDR um die Westgrenze des Warschauer Paktes und die Ostgrenze der NATO. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an die Worte von Leonid I. Breshnew während der Feierlichkeiten zum 20. Jahrestag der DDR: »Wir sind sozusagen zweifach Verbündete sowohl nach dem Vertrag zwischen unseren beiden Ländern als auch nach dem Warschauer Vertrag. Derjenige, der beabsichtigt, die Festigkeit unserer Freundschaft, die Unantastbarkeit der Grenzen unserer Staaten zu testen, sollte besser im Voraus wissen: Er wird auf einen vernichtenden Widerstand von gewaltiger Kraft – ich wiederhole – von gewaltiger Kraft der sowjetischen Streitkräfte und der gesamten sozialistischen Gemeinschaft stoßen.« Etwas mehr als zwanzig Jahre, nachdem L. I. Breshnew so eindeutig über die Beziehungen zur DDR gesprochen hatte, ignorierten die Instanzen des vereinten Deutschland, einschließlich der richterlichen, diese historischen Fakten. Der letzte Vorsitzende des Staatsrats der DDR, Egon Krenz, Verteidigungsminister Heinz Keßler, der Leiter des Hauptstabes der Nationalen Volksarmee Fritz Streletz, Generale, Offiziere und Soldaten der Grenztruppen wurden zu langjährigen Gefängnisstrafen wegen angeblichen Totschlags von DDR Bürgern, die die Grenze übertreten hatten, verurteilt. Der Marschall der Sowjetunion, Wiktor G. Kulikow, und Armeegeneral Anatoli I. Gribkow erklärten am 7. Juni 1998 in einem Brief an das Landgericht Berlin mit aller Entschiedenheit, dass die DDR auf militärpolitischem und militärischem Gebiet nicht souverän war. Ihre geomilitärische Lage machte sie zu einem Vorposten der Warschauer Vertragsstaaten. Weil die DDR gleichsam an einer Frontlinie lag, war auf ihrem Territorium eine 500.000 Mann starke Elite-Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte stationiert, einzigartig in ihrer Kampfkraft und mit der modernsten Waffentechnik ausgestattet, Kernwaffen eingeschlossen. Entlang der Staatsgrenze zwischen DDR und BRD verlief der vorderste Abschnitt der ersten strategischen Verteidigungslinie der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages. Die deutschen Gerichte hielten es nicht einmal für nötig, Kulikow, Gribkow und Abrassimow, der die UdSSR 17 Jahre lang als Botschafter in der DDR vertreten hatte, als Zeugen anzuhören. Von der Voreingenommenheit der deutschen Gerichte und auch des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zeugte, dass selbst die Schreiben von Michail S. Gorbatschow ignoriert wurden. Der Ex-Präsident der UdSSR, den man sonst gern den »Architekten der deutschen Einheit«, gar den »besten Deutschen« nannte, überdies Nobelpreisträger, hatte bekräftigt: »Die politisch-juristische Verfolgung führender Persönlichkeiten, Armeeführer, Grenzsoldaten und Tausender Bürger der ehemaligen DDR ist eine Hexenjagd. Der Versuch, Egon Krenz und seine Kollegen für die Lage an der Grenze verantwortlich zu machen, ist nichts anderes als eine politische Rache. Die Öffnung der Westgrenze der DDR im November 1989 und der Befehl von Egon Krenz, keine Gewalt anzuwenden, verhinderten militärische Aktionen mit weitreichenden Folgen.« Die deutsch-deutsche Grenze war nicht nur eine Grenze zwischen BRD und DDR, keine »innerdeutsche«, sondern eine Grenze zwischen zwei Staaten, zwei Völkerrechtssubjekten, die der UNO und internationalen Bündnissen angehörten. Das Grenzgesetz der DDR unterschied sich bekanntlich nicht von entsprechenden gesetzgebenden Normen der Bundesrepublik Deutschland. Während der Existenz beider deutscher Staaten forderte die BRD nie eine völkerrechtliche Verurteilung der DDR für ihr Grenzregime, weder in der UNO noch im Rahmen der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die Bundesrepublik schloss 1972 mit der DDR den Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen den beiden Staaten. Am 12. März 1985 vereinbarten Helmut Kohl und Erich Honecker in Moskau: »Die Unverletzlichkeit der Grenzen und die Achtung der territorialen Integrität und Souveränität aller Staaten in Europa in ihren gegenwärtigen Grenzen (sind) eine grundlegende Bedingung für den Frieden.« Aus diesem Grund stellt die strafrechtliche Verfolgung von DDR Führungspersönlichkeiten, Militärs und Zivilisten im vereinten Deutschland im Nachhinein eine Verletzung der Europäischen Menschenrechtskonvention dar. Sie ist zugleich eine Beleidigung der Verbündeten der früheren DDR, der souveränen Würde der Russischen Föderation, der Rechtsnachfolgerin der Sowjetunion, und des Andenkens an 27 Millionen Sowjetmenschen, die im Kampf gegen den Faschismus ihr Leben gelassen haben. Unserer Meinung nach wurden die gerichtlichen Verfahren gegen staatliche und militärische Persönlichkeiten der DDR tendenziös geführt. Die gefällten Urteile haben deren Rechte, ihre Ehre und ihre Würde aufs Gröbste verletzt. Die Regierenden in Deutschland wiederum behaupten: »Die Bundesregierung ist im Verlauf der deutschen Einigung keinerlei völkerrechtliche Verpflichtungen eingegangen, die die Tätigkeit des Rechtssystems gegenüber staatlichen und politischen Persönlichkeiten der ehemaligen DDR vor Russland oder den anderen Teilnehmerstaaten des Zwei plus-Vier-Vertrags begrenzt haben könnten.« In einer Erklärung des Russischen Außenministeriums vom 18. November 1999 wurde unterstrichen: »Es entsteht der Eindruck, dass die hartnäckige Konsequenz, mit der im vereinten Deutschland politische Persönlichkeiten der ehemaligen DDR gerichtlich zur Verantwortung gezogen werden, das Ziel hat, politisch mit der ehemaligen DDR abzurechnen und den ehemals souveränen und von der internationalen Gemeinschaft anerkannten Staat als unrechtmäßig und seine Führer als eine Gruppe von Kriminellen darzustellen. Darüber hinaus trägt der Urteilsspruch im Fall von Krenz, wie von vielen, darunter auch von deutschen, Experten eingeschätzt wird, nicht zum Prozess der Überwindung der psychologischen Zersplitterung der deutschen Nation bei, die auch bis heute, ein Jahrzehnt nach dem Fall der Berliner Mauer noch nicht der Vergangenheit angehört. Nur die Einstellung der strafrechtlichen Verfolgung von politischen und militärischen Persönlichkeiten, von DDR-Bürgern wird helfen, den Teufelskreis politischer Rache und Revanche zu durchbrechen, und trägt zur Festigung des internationalen Ansehens Deutschlands als Rechtsstaat und der Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen Russland und der Bundesrepublik bei.« Die Bundesrepublik indes ignoriert demonstrativ die früheren Vereinbarungen. Daran war während des 20. Jahrestages der DDR und bei unseren Begegnungen mit Walter Ulbricht wirklich nicht zu denken, eher schon zwanzig Jahre später, zum 40. Jahrestags, zumindest ahnungsweise. Ein weiteres Treffen mit Walter Ulbricht war mit einem wichtigen Ereignis der Geschichte von Komsomol und FDJ verbunden. Es war das Deutsch-Sowjetische Jugendfestival in Dresden. Unsere Delegation traf am 2. Oktober 1970 in Berlin ein. Zu ihr gehörten mehr als 500 junge Aktivisten, ausgezeichnete Schüler, Studenten und Armeeangehörige, begabte Wissenschaftler, Kulturschaffende und Olympiasieger. Unter den Ehrengästen waren Helden der Sowjetunion wie Armeegeneral Iwan I. Fedjuninskij, der Kosmonaut Walerij Bykowski, der Testpilot Georgij Mossolow, der Schriftsteller Boris Polewoj, der Filmregisseur Roman Karmen, die Komponisten Alexandra Pachmutowa, der Dichter Nikolaj Dobronrawow, Professor N. I. Sokolow, der an der Rettung der Schätze der Dresdner Gemäldegalerie beteiligt war,[Anmerkung 171] und die sechsfache Olympiasiegerin Lidija Skoblikowa. Am 3. Oktober 1970 erfolgte die feierliche Eröffnung des Festivals in Dresden. Ungeachtet des strömenden Regens versammelten sich über 100.000 junge Leute aus allen Bezirken der Republik. Die Partei- und Staatsführung der DDR unter Leitung Walter Ulbrichts und der sowjetische Botschafter Pjotr A. Abrassimow waren erschienen. Die Festivalflamme, in der die Ewige Flamme vom Grab des Unbekannten Soldaten an der Kreml-Mauer und die Ewige Flamme von der Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus und Militarismus in Berlin verschmolzen, stieg empor. Es erklangen die Hymnen der DDR und der Sowjetunion. Der 1. Sekretär des Zentralrats der FDJ Günther Jahn wandte sich in einer Rede an die Delegierten und Gäste des Festivals. Für die Jugend der DDR, erklärte er, sei das Festival der Freundschaft mit der Jugend der Sowjetunion der Höhepunkt des Leninjahrs.[Anmerkung 172] Er berichtete leidenschaftlich davon, was die Jugend des Landes im Jubiläumsjahr Lenins geschaffen hatte. Ich überbrachte herzliche Grüße Breshnews und wünschte in seinem Namen dem Festival einen guten Verlauf. Die Beziehungen zwischen Komsomol und FDJ, sagte ich, seien erfüllt vom Geist der Brüderlichkeit und der erfolgreichen Zusammenarbeit. Die Jugend der Sowjetunion und der DDR kämpften gemeinsam für Frieden und Sicherheit in Europa und auf dem gesamten Planeten, sie träten gegen die Verbrechen des Imperialismus in Indochina und im Nahen Osten auf und festigten die Einheit der internationalen Jugendbewegung. Walter Ulbricht wandte sich ebenfalls an die Teilnehmer und sprach davon, dass es wichtig sei, die Zusammenarbeit zwischen FDJ und Komsomol zu erweitern und zu vertiefen, die Freundschaft zwischen den Völkern, zwischen der Jugend der DDR und der Sowjetunion zu festigen. Er berichtete von den Erfolgen der Republik und hob die Bedeutung von Lenins Rede auf dem 3. Kongress des Russischen Kommunistischen Jugendverbands für die Erziehung der heutigen und künftigen Generationen hervor. Das Zentrale FDJ Orchesters intonierte kraftvoll sowjetische und deutsche Lieder. Walter Ulbricht gab anschließend für die sowjetische Delegation einen Empfang. Er begrüßte uns warmherzig und brachte einen Toast auf die unverbrüchliche Freundschaft zwischen unseren Parteien, den Völkern und unserer Jugend aus. Im Auftrag des ZK des Komsomol überreichte ich ihm das Ehrenzeichen »Für aktive Komsomolarbeit« und ein Relief mit den Köpfen von Marx, Engels und Lenin. Gemeinsam mit Ulbricht besuchte ich eine äußerst interessante Ausstellung junger Erfinder und Rationalisatoren, die »Messe der Meister von Morgen«5. Der wirtschaftliche Effekt der umgesetzten Rationalisierungsvorschläge und Erfindungen überstiege 100 Millionen Mark, wie man mir sagte. Ebenfalls in Leipzig fand die wissenschaftliche Konferenz »Der schöpferische Beitrag der Jugend zur wissenschaftlich technischen Revolution« statt. Günther Jahn und ich, die Chefs von FDJ und Komsomol, referierten dort. An der lebhaften Diskussion beteiligten sich junge Wissenschaftler, Ingenieure, Arbeiter und Studenten unserer Länder. Bewegend war der Tag des Gedenkens an die sowjetischen Soldaten und die deutschen Antifaschisten, die im Kampf gegen den Faschismus gefallen sind. An Gräbern der Gefallenen, an Gedenkstätten und Obelisken fanden Kundgebungen statt, wurden Kränze und Blumengebinde des Komsomol und der FDJ, der sowjetischen und deutschen Jugend niedergelegt. Es fanden Dutzende Treffen mit den Ehrengästen des Festivals statt. An dieser Stelle möchte ich an die Rede Roman Karmens erinnern. Der Volkskünstlers der UdSSR, Träger des Leninpreises und weltbekannter Dokumentarist, Regisseur der Filme »Zerschlagung der deutschen Truppen bei Moskau«, »Leningrad im Kampf«, »Berlin« und »Gericht der Völker« über den Nürnberger Prozess. Er drückte aus, was uns bewegte und wir auch mit dem Wirken von Walter Ulbricht verbanden: »Erneut bin ich in der DDR, im alten Dresden, das im hellen Licht der bunten Fahnen, Blumen, dem Lachen der Jugend erstrahlte. Die jungen Hausherren der deutschen Erde haben die Gäste aus der Sowjetunion freundlich aufgenommen. Und mich verlässt nicht das Gefühl der Freude, dass ich an diesem lichten Feiertag der Jugend teilnehme. Ich schaue in die Gesichter der jungen Deutschen und vor meinen Augen stehen Bilder, die als unauslöschliche Meilensteine in meine Biografie eingegangen sind. Das sind sie: 1926. Als junger Fotokorrespondent filmte ich die Ankunft der ersten deutschen Arbeiterdelegation in Moskau. Ich erinnere mich an die zum Rot-Front Gruß erhobenen Fäuste, an flammende Reden, begeisterte Begrüßungen der Moskauer, die ihre Klassenbrüder empfingen. In der gleichen Zeit, in den zwanziger Jahren filmte ich Clara Zetkin. Ich erinnere mich auch an den Roten Platz, an die Trauermärsche. Ich filmte die von Wehmut gezeichneten Gesichter der deutschen und sowjetische Genossen, die die Urne mit den sterblichen Überresten Clara Zetkins an der Kremlmauer beisetzten. August 1936. Barcelona. Der große Hof der Karl-Marx-Kaserne, in dem vor dem Fronteinsatz das Thälmann Bataillon Aufstellung nahm. Es war die erste bewaffnete Abteilung von Antifaschisten, die später den Kern der internationalen Brigaden bildete. Die deutschen Antifaschisten nahmen in diesen Jahren auf spanischem Boden den bewaffneten Kampf mit den Heeren Hitlers auf, die zur Unterdrückung der Spanischen Republik eingesetzt wurden. In diesen fernen Jahren befreundete ich mich mit dem legendären Sänger Ernst Busch, dem Schriftsteller Ludwig Renn, mit vielen deutschen Jungen, die Schulter an Schulter mit unseren sowjetischen Freiwilligen vor den Mauern Madrids kämpften. Im Frühjahr 1945 filmte ich das in Ruinen liegende Berlin, das in den Jahren des Krieges für Millionen Menschen das Symbol des Bösen, des Schreckens war. Ich schaute auf die Kinder, die aus den Feldküchen von sowjetischen Soldaten versorgt wurden, und dachte, ihnen obliegt es, ein neues Deutschland aufzubauen. Es vergingen Jahre. Ich weilte oft in der DDR, gewann viele neue Freunde, traf alte Kampfgefährten, mit denen ich mich auf der spanischen Erde verbrüdert hatte. Aus Ruinen erhoben sich Berlin, andere Städte. Es wuchs eine neue Generation heran. Mich erfreuen junge Menschen, ihre zivile Weisheit, das Gefühl des Internationalismus, ihre Achtung vor den revolutionären Traditionen der deutschen Kommunisten, der deutschen Arbeiterklasse. In eure Gesichter schauend, kehre ich unbewusst mit meinen Gedanken in das Frühjahr 1945 zurück. Ward ihr nicht jene kleinen Wesen, mit denen ich im brennenden Berlin zusammentraf? Mich erfreut die Einheit derjenigen, deren Kampfruf Rot Front! zum Symbol des revolutionären Kampfes der Proletarier der ganzen Welt wurde, derjenigen, die auf spanischer Erde im Thälmann-Bataillon kämpften, derjenigen, die den Kampf in nazistischen Todeslagern fortsetzten, und derjenigen, die in den Kriegsjahren geboren wurden und ins bewusste Leben als junger Bürger des ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden eintraten. Mich erfreut, dass heute in einer Reihe sowohl in vielen Kämpfen gestählte Kommunisten als auch in die Zukunft gerichtete, kühne, voller Pläne, unermüdlich in der Arbeit und im Erkennen der Welt erfüllte junge Bürger der Republik stehen, im wahrsten Sinne des Wortes Meister des morgigen Tages. Den Deutschen, die einen sozialistische Staat schufen, die eine neue Generation erzogen haben, eine kühne, energische Generation, die die revolutionären Traditionen der deutschen Arbeiterklasse fortsetzen, widmeten wir, die sowjetischen Filmschaffenden, unseren Film ›Genosse Berlin‹. In den Titel des Films legten wir die Gefühle der Freundschaft, die die sowjetischen Menschen gegenüber der DDR empfinden, dem Land, das in der vordersten Reihe unseres Lagers des Sozialismus steht. Deshalb habe ich mich, ohne lange zu überlegen, von meiner Arbeit, von den Alterssorgen losgerissen und bin nach Dresden geflogen, in die Stadt, die vom Lächeln der blühenden Jugend erfüllt war. Ich bin erfüllt von einem Gefühl der Freude über neue Treffen mit der fröhlichen, wunderbaren Jugend des sozialistischen Deutschlands, des Landes voller guter Hoffnungen und heller Horizonte.« In jenen Tagen habe ich auch die 66 jährige Lotte Ulbricht kennengelernt, eine Frau von nicht großem Wuchs, energisch, klug, bescheiden, taktvoll und aufmerksam. Sie erzählte, wie sie 1921 in die KPD eintrat und im folgenden Jahr nach Moskau fuhr, um in der Kommunistischen Jugendinternationale zu arbeiten: »Die Jugend- und Parteiarbeit wurde seitdem zum Hauptsinn meines Lebens. Ich bin stolz darauf, dass ich das Glück hatte, Lenin zu sehen und zu hören. Anfang der 30er Jahre lebte ich erneut vier Jahre mit meinem ersten Mann, dem Kommunisten Erich Wendt,[Anmerkung 173] der in den Jahren der Massenrepressalien eines ihrer Opfer wurde, in Moskau. Später heiratete ich Walter Ulbricht, wurde ihm eine treue Kampfgefährtin.« Nach dem Festival besuchten wir eine Einheit der GSSD. Einen unauslöschlichen Eindruck hinterließ das Museum in Karlshorst, wo die bedingungslose Kapitulation Hitlerdeutschlands besiegelt wurde.[Anmerkung 174] Wir besuchten den Treptower Park und legte Kränze an den Ehrengräbern und dem Denkmal für die in den Kämpfen um Berlin gefallenen Soldaten der Sowjetarmee nieder, welches am 8. Mai 1949 eingeweiht worden war. In einer Schweigeminute ehrten wir all jene, die im Kampf gegen den Hitlerfaschismus alles gegeben hatten, die die Ehre, die Freiheit und die Unabhängigkeit der sowjetischen Heimat verteidigten und die Menschheit vor der braunen Pest retteten. Es war unmöglich, die Tränen zurückzuhalten. Jeder, wirklich jedes unserer Delegationsmitglieder, hatte in den tosenden Jahren mindestens einen Familienangehörigen verloren: den Vater, den Großvater, den Bruder, die Mutter, die Schwester … Am Abend des 8. Oktober lud der sowjetische Botschafter zu einem Essen. Unter den Gästen waren Walter Ulbricht, seine Frau Lotte, Mitglieder des Politbüros des ZK der SED sowie herausragende Persönlichkeiten aus Wissenschaft, Kultur und Sport. Das DDR-Staatsoberhaupt wertete das Festival der Freundschaft als bedeutendes politisches Ereignis. Nachdem ich nach Moskau zurückgekehrt war, berichtete ich Breshnew von den wesentlichsten Ergebnissen des Festivals und überbrachte ihm nicht nur die Grüße, sondern auch die Bitte von Ulbricht und Stoph, die wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit zwischen der UdSSR und der DDR zu verbessern. Wir nannten das damals »vertiefen«. Der Generalsekretär erkundigte sich dezidiert nach der Art des Verhältnisses zwischen dem Ulbricht und seinen Genossen, merkliches Interesse bekundete er bezüglich Honecker und Stoph. Im Sommer 1973 nahm ich mit einer Komsomoldelegation an den X. Weltfestspielen der Jugend und Studenten in Berlin teil, zu der mehr als 25.000 junge Menschen aus 140 Ländern gekommen waren. Dies war ein grandioses Treffen der Jugend des Planeten! Uns betrübte daher die Abwesenheit des erkrankten Walter Ulbrichts, der auch für die Vorbereitung dieses Treffens so viel getan hatte. Mit tiefem Schmerz nahmen wir dann die Nachricht auf, dass am 1. August 1973, wenige Tage nach Eröffnung des Festivals, Walter Ulbricht verstorben sei. Er war einer der bedeutendsten Führungspersönlichkeiten der DDR und der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung, ein wahrer Patriot, Internationalist, Freund und Lehrmeister der Jugend.
Erich Buchholz: Die Verfassung von 1968 und die demokratische Rechtspflege
Erich Buchholz, Jahrgang 1927, Jura Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin von 1948 bis 1952, 1956 Promotion, 1963 Habilitation. Seit 1957 tätig als Dozent, ab 1965 als Professor mit Lehrauftrag, später Ordinarius und Leiter des Instituts für Strafrecht an der HUB. 1976 Direktor der Sektion Rechtswissenschaft und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats für Rechtswissenschaft beim Minister für Hoch- und Fachschulwesen. Seit 1990 Tätigkeit als Rechtsanwalt, verteidigte insbesondere Grenzsoldaten in politisch motivierten Verfahren und das Politbüromitglied Erich Mückenberger. Aufgrund seiner Tätigkeit als Abgeordneter in der Weimarer Republik besaß Walter Ulbricht praktische politische Erfahrungen in der (kapitalistischen) Staatspraxis und Politik. Nach der Befreiung vom Hitlerfaschismus beförderte er maßgeblich den Aufbau einer antifaschistisch-demokratischen Ordnung und die Ausarbeitung des ersten Fünfjahrplanes, des entscheidenden Durchbruchs zur Entwicklung einer antifaschistisch-demokratischen Wirtschaft – ein Planungswerk, das ihm, wie ich damals erlebte, auch bei Skeptikern Anerkennung eintrug. Im Kampf gegen äußere und innere Feinde oder Kontrahenten war er auf Bundesgenossen und Ratgeber im Lande und bei Freunden angewiesen. Nicht alle Ratschläge oder Empfehlungen erwiesen sich als gut und glücklich. Der Beschluss der 2. Parteikonferenz der SED im Juli 1952, in der DDR die Grundlagen des Sozialismus zu schaffen, erwies sich meiner Meinung nach aus verschiedenen Gründen als überstürzt und den inneren Verhältnissen der DDR nicht angemessen. Auf strafrechtlichem Gebiet spiegelte sich dieser Beschluss in der Verabschiedung eines rechtspolitisch und juristisch verfehlten Gesetzes zum Schutze des Volkseigentums und anderen gesellschaftlichen Eigentums vom 2. Oktober 1952 wieder. Dieses Gesetz war auf Drängen der SMAD beschlossen worden und eine Kopie von Stalins Erlass zum Schutze des Volkseigentums in der Sowjetunion. Es wurde nach einer Reihe von Korrekturen schließlich durch das Strafrechtsergänzungsgesetz vom 1. Februar 1958 abgelöst. Ulbricht hielt es für notwendig, am 2. April 1958 die marxistisch leninistischen Positionen zu Staat und Recht auf einer Konferenz in Babelsberg neuerlich zu artikulieren (»Die Staatslehre des Marxismus-Leninismus und ihre Anwendung in Deutschland«). Darin kamen auch Zuarbeiten und Ausführungen Karl Polaks[Anmerkung 175] zur Geltung, die sich zum Teil als verfehlt und schädlich erwiesen. Nach der Konferenz und in ihrer Umsetzung wurde beispielsweise der Rechtszweig Verwaltungsrecht abgeschafft.[Anmerkung 176] Auf strafrechtlichem Gebiet erwies sich eine grundsätzliche Äußerung zur Beurteilung von Verbrechen in der DDR als wichtig. Es wurde unterschieden zwischen solchen Verbrechen, die aus antagonistischen (klassenfeindlichen) Widersprüchen erwuchsen, und solchen aus nichtantagonistischen Widersprüchen. Das schlug sich im Strafgesetzbuch der DDR von 1968 in der Unterscheidung von »Verbrechen« und »Vergehen« nieder. Mit diesem Hinweis machte Ulbricht sich nicht zum Richter oder Schiedsrichter in der Auseinandersetzung unter den Juristen, sondern gab ihnen Gelegenheit, selbst eine Lösung zu finden. Die Entwicklung des Wissenschaftsgebietes Kriminologie, einer Kriminologie auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus, wurde durch die Babelsberger Konferenz gefördert.[Anmerkung 177] Ulbricht war konstruktiv und bot Ideen, die umzusetzen oft nicht leicht war, etwa die Vergenossenschaftung der Landwirtschaft. Er wusste um die Probleme der Kollektivierung in der UdSSR. Deshalb trat er für den freiwilligen Zusammenschluss der Bauern ein und unterstützte schrittweise Formen der Vergenossenschaftung, indem drei verschiedene Typen von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) geschaffen wurden, in denen die Vergesellschaftung von Land, Vieh und Geräten unterschiedlich erfolgen sollte. Dazu gehörte, dass der den Bauern als Eigentum gehörende Grund und Boden de jure und so im Grundbuch – auch ihr Eigentum blieb. Lediglich die Bewirtschaftung erfolgte kollektiv. Diese Regelung spielte nach 1990 und in der bundesdeutschen Rechtsprechung eine große Rolle. Später trat Ulbricht dafür ein, die kleinen Gewerbetreibenden, insbesondere Geschäftsleute, als Kommissionshändler in den sozialistischen Einzelhandel und Firmenbesitzer durch Ankauf von Unternehmensanteilen (»halbstaatlich«) in die sozialistische Volkswirtschaft zu integrieren. Die Unternehmer blieben Leiter ihrer Betriebe und leisteten, auch für den Außenhandel, Bedeutendes.[Anmerkung 178] Diese Entscheidung war nicht zuletzt aus bündnispolitischen Erwägungen von erheblicher Bedeutung. Zu den weitreichendsten staatspolitischen Leistungen Ulbrichts gehört – aus meiner Sicht – die Schaffung eines »kollektiven Staatsoberhaupts«, des Staatsrats. Die Mitglieder dieses Gremiums wurden von der Volkskammer gewählt und waren ihr gegenüber verantwortlich. Er wirkte als demokratisches Organ zwischen den Sitzungen des Parlaments und war auf Gebieten tätig, die nicht zur Kompetenz des Ministerrates[Anmerkung 179] gehörten, etwa für die Beziehungen zwischen Bürger und Staat, zwischen den örtlichen Volksvertretungen und dem Parlament und nicht zuletzt für die Rechtspflege, ohne in deren Eigenständigkeit einzugreifen. Die Unabhängigkeit der Rechtsprechung blieb bestehen. Die von der Volkskammer gewählten Richter des Obersten Gerichts (OG) und der Generalstaatsanwalt mussten sich den Fragen und Kritiken des Staatsrates stellen, ohne die von der Verfassung gesicherte Unabhängigkeit der Richter und die Selbständigkeit der Staatsanwaltschaft zu beeinträchtigen. In diesem Sinne wurde am 4. April 1963 der »Erlass des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik über die grundsätzlichen Aufgaben und die Arbeitsweise der Organe der Rechtspflege«[Anmerkung 180] beschlossen. Damit wurde ein neues Kapitel zur Entwicklung einer modernen demokratischen Rechtspflege begonnen. Die dort fixierten Prinzipien fanden auch in der DDR-Verfassung von 1968 ihren Niederschlag. Der Staatsrat veranlasste ferner die Ausarbeitung des Strafgesetzbuches, dessen Entwurf öffentlich diskutiert wurde und darum auf breiter demokratischer Basis zustandekam – ein fundamenaler Unterschied zur Praxis in der Bundesrepublik, wo die Öffentlichkeit grundsätzlich nicht an der Ausarbeitung und Vorbereitung von Gesetzen beteiligt wurde und wird. Für die Ausarbeitung des neuen DDR Strafgesetzbuches war eine Kommission des Staatsrates, nicht des Justizministeriums verantwortlich, auch wenn die Justizministerin Hilde Benjamin den Vorsitz in dieser Kommission führte. Die Ausarbeitung der 68er Verfassung und die Entwicklung der Rechtspflege in der DDR stehen in einem engen und spezifischen Zusammenhang. Die durch Volksentscheid angenommene Verfassung war von elf Millionen Bürgern in einer großen Volksaussprache diskutiert worden. Über 12.000 Vorschläge wurden eingereicht, die zu 118 Änderungen des ursprünglichen Textentwurfes in der Präambel und in 55 Artikeln führten. In Abschnitt 1 wurden die politischen und ökonomischen Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft in der DDR verfassungsrechtlich definiert. Die Volkswirtschaft der DDR beruhte danach auf dem sozialistischen Eigentum an Produktionsmitteln, welches im einzelnen präzise definiert wurde, wobei dem Volkseigentum der zentrale Platz zukam. Daraus folgte: Die Bürger der DDR, das Staatsvolk der DDR, waren kollektive Eigentümer der natürlichen und ökonomischen Ressourcen und Werte. Sie waren daher die Inhaber und Träger der ökonomischen und politischen Macht. Nach Art. 48[Anmerkung 181] war die Volkskammer das oberste staatliche Machtorgan in der DDR. Der Ministerrat hingegen vertrat in dessen Auftrag die Wirtschaft der DDR im Interesse ihrer Bürger. (siehe FN 5) Dies so nachdrücklich herauszustellen ist deshalb geboten, weil in der BRD (wie sonst in der kapitalistischen Welt auch) der Anschein erweckt wird, als läge »die Macht« beim Bundeskanzler, folglich würde bei Parlamentswahlen der vermeintliche Souverän, das Volk, darüber entscheiden, wer künftig »die Macht« haben solle. Ungeachtet des Ausgangs der Parlamentswahlen verbleibt die tatsächliche Macht im Staate bei den Eigentümern an Produktionsmitteln, namentlich der Klasse der Kapitalisten. Bereits im »Kommunistischen Manifest« formulierten Marx und Engels in prägnanter Schärfe: »Die moderne Staatsgewalt ist nur ein Ausschuss, der die gemeinschaftlichen Geschäfte der ganzen Bourgeoisklasse verwaltet.« Der gesamte Staatsaufbau mit Parlament, Regierung und Ministerien usw. erledigt diese gemeinschaftlichen Geschäfte im Gesamtinteresse der ökonomisch herrschenden Klasse, innerhalb derer die großen Kapitalien den Ton angeben. Dieses Staatsgebäude wurde im Kapitalismus, so in der BRD, letztlich nur zu dem Zweck errichtet, um bei dem angeblichen Souverän, dem Wähler, den Glauben zu erzeugen, er habe etwas zu sagen und bestimme mit seinem Votum den Charakter der Gesellschaft. Wir wissen leidvoll aus der Geschichte: Wenn dieser seltene Fall eines politischen Machtwechsels durch Wahlen tatsächlich eintritt, wird diese demokratische Entscheidung mit Gewalt revidiert. Erinnert sei an Spanien 1936 oder Chile 1973. Abschnitt II, Kapitel 1 der DDR Verfassung regelte die Grundrechte und Grundpflichten der Bürger. Diese Aussage ist von prinzipieller und weitreichender Bedeutung. Das Grundgesetz beschränkt sich auf die traditionellen politischen und Bürgerrechte – als ob ein Gemeinwesen ohne Pflichten ihrer Mitglieder existieren könnte! Bereits in der Familie ist selbstverständlich, dass jedes Mitglied vor allem Pflichten hat. Auch das BGB geht – besonders deutlich bei den schuldrechtlichen Beziehungen von wechselseitigen Rechten und Pflichten aus. Keine Rechtsordnung gewährt nur Rechte. Das Grundgesetz ist deshalb verlogen, weil es vorgibt, die Bürger hätten vor allem Rechte, aber keinerlei Pflichten. Indessen ergeben sich aus der BRD Rechtsordnung – nicht nur aus dem Privatrecht, sondern namentlich aus dem öffentlichen Recht, dem Steuer-, Verwaltungs- und Strafrecht – sehr einschneidende Rechtspflichten. Werden diese nicht erfüllt, hat es oft erhebliche Konsequenzen. Davon redet das GG nicht, nicht von ungefähr. Denn das GG suggeriert, als seien die Grundrechte, so vor allem das hauptsächliche Grundrecht des Art. 2 – das allgemeine Freiheitsrecht, das Grundrecht der Entfaltung der eigenen Persönlichkeit das Allerwichtigste nicht nur für das Individuum, sondern für die Gesellschaft: Freiheit über alles! Wer von diesem Grundrecht der Entfaltung seiner Persönlichkeit in der BRD Gebrauch macht, darf sich darin ausprobieren, erproben. Er darf testen, wie weit er gehen darf. Nicht zu Unrecht hieß es in einem Aufsatz zum »Inbegriff der Freiheit«, sie bedeutet: »Nehmen, was man kriegen kann!« Wer von diesem Grundrecht Gebrauch macht, darf – wie die Alltags- und die justizielle Praxis zeigt experimentieren, ob jemand, der sich in seinen Rechten verletzt sieht, sich meldet, ob er das Gericht anruft. Praktisch geht es darum zu testen, ob der Verletzte es wagt, mit entsprechenden Kosten gegen den Verletzer seiner Rechte gerichtlich vorzugehen. Und die Erfahrung lehrt: sehr, sehr viele verzichten auf den nicht sicheren, oft aussichtslosen Gerichtsweg, den das GG ihnen einräumt, und zwar aus verschiedenen Gründen, z. B. wegen der öffentlichen Meinung, des Ansehens oder wirtschaftlicher Einbußen usw. Zutreffend wird in Bezug auf das Recht und die Justiz der BRD nicht nur von Anwälten immer wieder betont: Recht haben und Recht kriegen ist zweierlei. Die Rechte, die das GG und die Gesetze der BRD dem Bürger zuerkennen, bleiben darum nur zu oft totes Papier! Im diametralen Gegensatz zum GG regelte die DDR-Verfassung Grundrechte und Grundpflichten. Sie nahm auch alle Menschenrechte auf, die in den beiden Internationalen Menschenrechtskonventionen von 1966 vereinbart worden waren. Die BRD ist zwar beiden Konventionen beigetreten, missachtet aber dennoch ungestraft die sozialen, ökonomischen und kulturellen Menschenrechte. Die DDR-Bürger gewannen 1990 durch den Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes keinerlei substanzielle Rechte, vor allem keine Grundrechte, hinzu, die ihnen nicht bereits die DDR-Verfassung gegeben hatte. Doch sie verloren massenhaft kostbare Rechte:– das Recht auf Arbeit (Art. 24),– das Recht auf Bildung (Art. 25),– das Recht auf Schutz der Gesundheit und der Arbeitskraft sowie auf unentgeltliche medizinische Versorgung, namentlich auf ärztliche Hilfe, Arzneimittel und andere medizinische Sachleistungen (Art. 35),– die Rechte der Gewerkschaften und der Produktionsgenossenschaften (Art. 44 bis 46). In der DDR-Verfassung wurden zur praktischen Gewährleistung aller Grundrechte entsprechende Festlegungen getroffen. Das GG hingegen überlässt es dem Einzelnen, ob und wie er von den für ihn verbrieften Grundrechten Gebrauch macht. In Art. 96 der DDR-Verfassung war, wie im Art. 97 GG, die Unabhängigkeit der Richter verankert. Aber in der DDR Verfassung war auch die Unabhängigkeit der Schöffen, die den Berufsrichtern in vollem Umfang gleichgestellt waren, sowie die der Mitglieder der Gesellschaftlichen Gerichte (Konflikt und Schiedskommissionen) garantiert. In Art. 99 Abs. 2 der DDR-Verfassung ist, wie auch in Art. 103 Abs. 2 GG, festgelegt, dass eine Tat nur dann strafrechtliche Verantwortlichkeit nach sich zieht, wenn die Tat zum Zeitpunkt ihrer Begehung durch Gesetz unter Strafe gestellt war (Prinzip der Gesetzlichkeit bzw. der Gesetzmäßigkeit). Weiter heißt es: »Strafgesetze haben keine rückwirkende Kraft.« Dieses bedeutsame Rückwirkungsverbot fehlt im GG.[Anmerkung 182] Abs. 4 dieses Art. 99 (Verf. DDR) bestimmte: »Die Rechte der Bürger dürfen im Zusammenhang mit einem Strafverfahren nur insoweit eingeschränkt werden, als dies gesetzlich zulässig und unumgänglich ist.« Art. 100 regelte die Voraussetzungen der Anordnung von Untersuchungshaft sowie die Befugnisse und Pflichten von Richtern in diesem Zusammenhang. Art. 101 bestimmte in Abs.1: »Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden«, (ähnlich Art. 104 GG), und in Abs. 2 hieß es: »Ausnahmegerichte sind unstatthaft« (so auch Art. 101 GG). Art. 102 lautete in Abs. 1: »Jeder Bürger hat das Recht, vor Gericht gehört zu werden«, und in Abs. 2: »Das Recht auf Verteidigung wird während des gesamten Strafverfahrens gewährleistet.« Das GG der BRD kennt keine gleichartige Bestimmung. Dort findet sich lediglich in Art. 103 Abs. 1 der schwache Satz: »Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör.« Zu diesen allgemein anerkannten und üblichen Regelungen für das Gebiet der Rechtspflege erscheinen keine besonderen Bemerkungen erforderlich. Indessen sind folgende Bestimmungen vor allem im Gegensatz zu denen des GG – herauszustellen, weil sie den demokratischen Charakter der sozialistischen Rechtspflege deutlich zeigen: Art. 91 enthält die außerordentlich wichtige, den politischen Charakter der DDR-Verfassung kennzeichnende Bestimmung: »Die allgemein anerkannten Normen des Völkerrechts über die Bestrafung von Verbrechen gegen den Frieden, gegen die Menschlichkeit und von Kriegsverbrechen sind unmittelbar geltendes Recht.[Anmerkung 183] Verbrechen dieser Art unterliegen nicht der Verjährung.« Die DDR-Verfassung vermied es, Nazi- und Kriegsverbrecher durch eine allgemeine, auch den gewöhnlichen Mord umschließende Bestimmung über die Verjährung der Bestrafung zu entziehen. Die entsprechenden Vorschriften des GG, die deren »Väter« nach der Niederschlagung des faschistischen Aggressorstaates ins GG aufnehmen mussten und an einer ungewöhnlichen Stelle, im Abschnitt »Der Bund und die Länder«, platzierten, lauten: »Die allgemeinen Regeln des Völkerrechts sind Bestandteil des Bundesrechts. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.« (Art. 25) Und an anderer Stelle heißt es: »Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen.«[Anmerkung 184] (Art. 26, Abs.1) Die DDR-Verfassung von 1968 – die nicht nur deshalb als Ulbrichts Verfassung bezeichnet wird, weil er zu jener Zeit Staatsratsvorsitzender war knüpfte gleichsam im Vorgriff an die UNO-Konvention über die Nichtanwendbarkeit von Verjährungsbestimmungen auf Kriegsverbrechen und auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit an, welche von der XXIII. Vollversammlung der Vereinten Nationen am 26. November 1968 beschlossen werden sollte. Das Grundgesetz der BRD enthielt keine entsprechende Festlegung. Das brachte Bonn in Zugzwang. Kurz vor Ablauf der Verjährungsfrist fügte man am 4. August 1969 mit Hilfe des 9. Strafrechtsänderungsgesetzes in den § 78 des Strafgesetzbuches ein: »Verbrechen nach § 220 a (Völkermord) und nach § 211 (Mord) verjähren nicht.« Das geschah, wie schon festgestellt, auf internationalen Druck und nicht zuletzt auch wegen der klaren Haltung des anderen deutschen Staates. Dennoch offenbarte selbst diese Aussage den Charakter der Bundesrepublik. Völkermord und Individualmord wurden zumindest hinsichtlich der Nichtverjährung auf eine Stufe gestellt. Diese Gleichsetzung stellt de facto eine Bagatellisierung der Nazi und Kriegsverbrechen des Hitlerstaates dar. Das lag auf der Linie des Art. 102 GG, mit dem bei Inkraftsetzen des Grundgesetzes 1949 die Todesstrafe abgeschafft wurde. Davon profitierten nachweislich Nazi- und Kriegsverbrecher, die veranwortlich waren für Massenexekutionen und industriemäßig betriebenen Mord. Die Verfassung der DDR hingegen sah diese Bestrafung explizit vor, und als die DDR in den 80er Jahren in Moskau vorschlug, die Todesstrafe abzuschaffen, lehnte dies Gorbatschow gegenüber Egon Krenz mit Hinweis auf eben jenen Verfassungsauftrag ab: Die Abschaffung der Todesstrafe könnte so verstanden werden, als würde die DDR in ihrer antifaschistischen Haltung nachlassen. Zudem wäre ein solcher Schritt auch nicht notwendig, so lange etwa in den USA und in vielen anderen Staaten die Todesstrafe noch vollstreckt würde. Nachdem die DDR jedoch schon geraume Zeit keine Todesurteile ausgesprochen und vollzogen hatte, wurde sie 1987 offiziell abgeschafft. Der Gegensatz der Rechtspflege in beiden deutschen Staaten tritt in den Bestimmungen der DDR-Verfassung und des Grundgesetzes deutlich hervor. In der Bundesrepublik wurden und werden Urteile »Im Namen des Volkes« verkündet. Woher nehmen die Richter dieses Recht? In anderen Staaten ist man da ehrlicher. Dort ergehen Urteile im Namen des herrschenden Monarchen oder der Administration, die den Richtern dafür Vollmacht erteilt hat. In der (west-)deutschen Demokratie ergingen und ergehen also die Urteile »im Namen des Volkes«. Hat sie »das Volk« legitimiert? Die Richter, dem sozialen Status und der gesellschaftlichen Stellung nach Beamte, werden von Behörden (gegebenenfalls auf Lebenszeit) ernannt und befördert. Das Volk hat darauf keinerlei Einfluss. In der DDR wurden Richter gewählt. Wem die außerordentliche Macht eingeräumt wird, über das Schicksal, besonders über die Freiheit (auch über das Leben) von Menschen zu entscheiden, bedarf dazu einer besonderen Legitimation! In der für eine gesamtdeutsche demokratische Republik ausgearbeiteten und zuvor diskutierten Verfassung, die 1949 die erste Verfassung der DDR wurde, war in Art. 121 bestimmt, dass die Richter des Obersten Gerichtshofes – wie auch der Oberste Staatsanwalt der Republik – auf Vorschlag der Regierung durch die Volkskammer gewählt wurden. Analog galt das in den Ländern und ab 1952 in den Bezirken. Diesem historischen Schritt hin zur Schaffung einer demokratisch begründeten und legitimierten Rechtspflege folgten weitere. In Art. 95 der DDR-Verfassung von 1968 hieß es: »Alle Richter, Schöffen und Mitglieder der gesellschaftlichen Gerichte werden durch die Volksvertretungen oder unmittelbar durch die Bürger gewählt.« In der DDR war folglich die Urteilsformel »Im Namen des Volkes« begründet und keine demagogische Behauptung. Die grundsätzlich in allen Gerichten (so in Arbeitsrechts-, Zivil- und Familiensachen) tätigen Schöffen waren gemäß Art. 96 Abs. 2 der DDR Verfassung zudem gleichberechtigte »Richter« und nicht, wie in Strafverfahren vor BRD-Gerichten, Staffage, die ohne Kenntnis der Akten neben den Berufsrichtern sitzen, schweigend zuhören und an der Abfassung der – maßgeblichen schriftlichen Urteilsgründe nicht beteiligt werden. Sie unterzeichnen sie auch nicht. Die Schöffen in der DDR taten dies sehr wohl, wenn sie damit einverstanden waren. Die Mitglieder der Gesellschaftlichen Gerichte waren in der DDR wie »ordentliche« Richter tätig. Die Konfliktkommissionen in den Betrieben und die Schiedskommissionen in den Wohngebieten und Produktionsgenossenschaften gehörten zum Justizsystem. Darin unterschieden sie sich auch von vergleichbaren Institutionen in anderen sozialistischen Ländern. Sie erfüllten gerichtliche Aufgaben in vollem Umfang. Ihre Entscheidungen (Beschlüsse) konnten durch Rechtsmittel angefochten werden. Wurden sie rechtskräftig, konnte aus ihnen vollstreckt werden. Der demokratische Charakter der Rechtspflege der DDR zeigte sich auch in anderen Bestimmungen der Verfassung. Der Abschnitt »Sozialistische Rechtspflege und Gesetzlichkeit« (Art. 86) beginnt mit der fundamentalen Aussage: »Die sozialistische Gesellschaft, die politische Macht des werktätigen Volkes, ihre Staats- und Rechtsordnung sind die grundlegende Garantie für die Einhaltung und Verwirklichung der Verfassung im Geiste der Gerechtigkeit, Gleichheit, Brüderlichkeit und Menschlichkeit.« Es folgt mit Art. 87 eine Bestimmung, die den demokratischen Charakter der Rechtspflege in einem wahrhaft demokratischen Staatswesen charakterisiert: »Gesellschaft und Staat gewährleisten die Gesetzlichkeit durch die Einbeziehung der Bürger und ihrer Gemeinschaften in die Rechtspflege und in die gesellschaftliche und staatliche Kontrolle über die Einhaltung des sozialistischen Rechts.« Gesetze zu erlassen ist das Eine (in dieser Hinsicht, heißt es, sei der Bundestag Weltmeister). Viele Gesetze müssen oft wegen Mangelhaftigkeit novelliert, korrigiert oder durch neue ersetzt werden. Darunter leidet zwangsläufig auch die Rechtssicherheit. Das andere ist es, für die Einhaltung der Gesetze zu sorgen und sie auch konsequent durchzusetzen. Der genannte Art. 87 der DDR Verfassung macht deutlich, wie das in einem tatsächlich demokratischen Staatswesen geschehen soll und kann: Die Einhaltung der von der höchsten Volksvertretung im Interesse der Bürger erlassenen Gesetze muss zu einer Angelegenheit der Bürger selbst werden. Wenn sie ihre Gesetze selbständig einhalten und für die Einhaltung durch andere eigenständig sorgen, dann wird die Einhaltung der Gesetze, mithin die Rechtssicherheit, zu einer Selbstverständlichkeit. Die DDR Wirklichkeit bewies in hohem Maße, dass das funktioniert, weshalb der Einwand, die Bürger verhalten sich nur dann und dort gesetzeskonform, wo im Falle der Zuwiderhandlung Sanktionen drohen, billig ist: In einer bürgerlich kapitalistischen Gesellschaft mag er zutreffen, in einer demokratisch sozialistischen nicht. Und diese Einhaltung der Gesetze und damit die Rechtssicherheit wären in DDR noch höher gewesen, wenn nicht vor der Tür im Westen ein Staatswesen mit prinzipieller Negierung von Recht und Gesetz existiert hätte. Neben Schöffen und Gesellschaftlichen Gerichten wirkten auch Kollektivvertreter, gesellschaftliche Ankläger bzw. Verteidiger an den Verfahren vor Strafgerichten mit. Tausende DDR-Bürger trugen in Kommissionen zu Ordnung und Sicherheit bei, arbeiteten in Jugendhilfekommissionen, in Arbeitsschutzkommissionen, im Rahmen der Arbeiter- und Bauern-Inspektionen (ABI), als Helfer der Volkspolizei … In vielfältiger Weise sorgten sie für die Einhaltung der Gesetze durch jedermann. Das bewirkte nicht nur ein hohes Rechts , sondern auch Verantwortungsbewusstsein in Arbeitskollektiven und Hausgemeinschaften. Die Staatsanwälte der DDR besaßen umfassende Vollmacht gegenüber jedermann, auch und nicht zuletzt gegenüber Mitarbeitern der Staatsorgane, bei der Kontrolle der Gesetzlichkeit. Es existierte in der DDR– in der BRD gibt es so etwas nicht ein Gesetz über die Staatsanwaltschaft, in dessen Kapitel V (»Aufgaben, Rechte und Pflichten bei der Allgemeinen Gesetzlichkeitsaufsicht«) deren Befugnisse geregelt waren. Das Gesetz korrespondierte mit Art. 97 und 98 der DDR-Verfassung. Die Staatsanwaltschaft sorge für die »Sicherung der sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung und der Rechte der Bürger«, hieß es dort, sie wache »über die strikte Einhaltung der sozialistischen Gesetzlichkeit«. Auch diese Bestimmung zeugte von einem sozialistischen Rechtsstaat. Wo gab und gibt es Vergleichbares im GG oder in der Rechtsordnung der BRD? Juristisch spielt die Staatsanwaltschaft– als ein ursprünglich bei den Gerichten angesiedeltes Hilfsorgan der Gerichte in der Bundesrepublik eine untergeordnete Rolle. Sie hat nur in Strafsachen die Funktion der Initiierung eines Prozesses und die Aufgabe, Anklagen vor Gericht zu vertreten und/oder – was seit den 70er Jahren üblich ist – einen Deal zwischen Beklagten, Kläger und Richter auszuhandeln. Ein Staatsanwaltschaftsgesetz kennt die Rechtsordnung der BRD bis heute nicht. In der DDR war der Staatsanwalt Hüter der Gesetzlichkeit. Dafür wurden ihm – gemäß Art. 97 der Verfassung Gesetze und Rechtsvorschriften in die Hand gegeben. Art. 97 bestimmte ausdrücklich: Die Staatsanwaltschaft schützt die Bürger vor Rechtsverletzungen. Die Rechtsordnung der BRD kennt solches nicht, in ihr ist die Staatsanwaltschaft eine weitgehend vollmachtlose Institution. In der DDR wandten sich Bürger in Belegschaftsversammlungen, Justizaussprachen und Sprechstunden an Staatsanwälte, die ihnen weitgehend bekannt waren. Sie informierten und reagierten auf eindeutige Verletzungen der Rechte von Bürgern. Sie standen diesen zur Seite. Oft regelte ein Anruf bei der Instanz, über die sich Bürger beschwert hatten, die Angelegenheit ohne großes Gewese. Art. 89 bekräftigt nicht nur die Selbstverständlichkeit, dass Gesetze und andere Rechtsvorschriften nicht der Verfassung widersprechen dürften. Für den Fall, dass Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Rechtsvorschriften des Ministerrates oder anderer staatlicher Organe bestünden, sollte der Staatsrat entscheiden. In der Verfassungsfassung vom 7. Oktober 1974 hieß es dazu weitergehend: »Über Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit von Rechtsvorschriften entscheidet die Volkskammer.«10 Diese Regelung entsprach dem Wesen der Volkssouveränität. Das Parlament als Legislative war das oberste staatliche Machtorgan. Die Regelung im GG der BRD, nach der ein vom Parlament abhängiges Organ– das Verfassungsgericht – das letzte Wort über die Vereinbarkeit von Gesetzen mit der »Verfassung«, also dem GG, hat, ist insofern undemokratisch, als sie das Parlament entmachtet. In der Praxis des BVerfG wird häufig der Weg beschritten, dem Gesetzgeber aufzugeben, innerhalb einer Frist ein (neues) GG-konformes Gesetz zu verabschieden. Der Grundgedanke, dass die Einhaltung der Gesetze zu einer Sache des ganzen Volkes werden muss, wenn im Lande Rechtssicherheit herrschen und eine entsprechende Rechtspflege geübt werden soll, fand in Art. 90 der DDR Verfassung seinen Niederschlag. »Die Rechtspflege dient der Durchführung der sozialistischen Gesetzlichkeit, dem Schutz und der Entwicklung der Deutschen Demokratischen Republik und ihrer Staats- und Gesellschaftsordnung. Sie schützt die Freiheit, das friedliche Leben, die Rechte und die Würde der Menschen.« Von besonderer Bedeutung war Abs. 2 dieses Artikels, es war das Konzentrat der Konsequenzen aus unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen über Wesen und Ursachen der Kriminalität. Er lautete: »Die Bekämpfung und Verhütung von Straftaten und anderen Rechtsverletzungen sind gemeinsames Anliegen der sozialistischen Gesellschaft, ihres Staates und aller Bürger.« Wissenschaftliche kriminologische Erkenntnisse wie auch die Alltagserfahrung der Menschen besagten, dass Straftaten in der Regel und so namentlich im DDR-Alltag nicht urplötzlich auftraten. Oft gingen ihnen soziale und persönliche, familiäre Probleme voraus. Wenn die Mitmenschen solche beobachteten und in angemessener Weise darauf reagierten, konnte man etwa Gesetzesverletzungen (Gewalt, Übergriffe , Diebstahl aus sozialer Not o. ä.) vorzeitig begegnen. Eben deshalb war es für die Verhältnisse in der DDR so wichtig und so sinnvoll, dass die Verhütung von Rechtsverletzungen als gesamtgesellschaftliche Angelegenheit verstanden wurde. Die Folgen solcher Bemühungen sind dokumentiert. Seit 1952 ging die Zahl der festgestellten Straftaten in der DDR zurück, während sie in der BRD zunahm. Die Kriminalität der BRD war, umgerechnet auf die Bevölkerung, etwa zehn Mal so hoch wie in der DDR. Bei der Vorbeugung und Verhütung von Rechtsverletzungen spielte die Teilnahme der Bürger an der Rechtspflege eine entscheidende Rolle, die in Art. 90 Abs. 3 ausdrücklich formuliert war. Art. 93 bestimmte die Aufgaben des Obersten Gerichts im Einzelnen, so dass es die Rechtsprechung der Gerichte auf der Grundlage der Verfassung, der Gesetze und anderer Rechtsvorschriften in rechtsstaatlichen Formen leitete und die einheitliche Rechtsanwendung sicherte. Als Jurist kann ich die Bedeutung dieser Verfassungsbestimmung – angesichts der beträchtlichen, allgemein beklagten Uneinheitlichkeit der Rechtsprechung der BRD – nicht hoch genug würdigen. Denn was kann eine Rechtsordnung ihren Bürgern an Rechtssicherheit bieten, wenn die Gesetze ganz verschieden ausgelegt werden? Nicht grundlos hob Gustav Radbruch[Anmerkung 185] gerade die Einheitlichkeit der Rechtsprechung als ein hohes Gut der Rechtspflege hervor. Dass das Oberste Gericht mit seinen von der Volkskammer gewählten Richtern »kein Gott über allem« war und auch nicht sein durfte, wurde in Abs. 3 dieses Art. 93 der DDR-Verfassung bewusst gemacht. Das Oberste Gericht war der Volkskammer und zwischen ihren Tagungen dem Staatsrat rechenschaftspflichtig. Diese rechtspolitische Verantwortlichkeit des Obersten Gerichts gegenüber der Volkskammer bzw. dem Staatsrat stellte keinen Eingriff in die durch Art. 96 gewährleistete richterliche Unabhängigkeit dar. Art. 94 Abs. 1 der DDR-Verfassung umschrieb, wer in der DDR Richter werden/sein, wer zum Richter gewählt werden konnte: Er musste »dem Volk und seinem sozialistischen Staat treu ergeben« sein und »über ein hohes Maß an Wissen und Lebenserfahrung, an menschlicher Reife und Charakterfestigkeit« verfügen. Diese Bestimmung knüpft an Art. 128 der Verfassung von 1949 an. Bei meinen Begegnungen mit Juristen anderer Länder gewann ich nie den Eindruck, dass diese sich als Gegner ihres Staats verstanden. Auch in anderen Ländern waren (und sind) Richter nicht nur loyal, sondern staatstragend. Ergänzt wurde der Artikel durch eine ebenfalls an den Text der DDR Verfassung von 1949 anknüpfende Bestimmung, dass »die demokratische Wahl aller Richter, Schöffen und Mitglieder der gesellschaftlichen Gerichte gewährleistet, dass die Rechtsprechung von Frauen und Männern aller Klassen und Schichten des Volkes ausgeübt wird«. In diesem Sinne folgte in Art. 95 die Regelung der demokratischen Wahl »aller Richter, Schöffen und Mitglieder der gesellschaftlichen Gerichte durch die Volksvertretungen oder unmittelbar durch die Bürger«. Sie hatten ihren Wählern Bericht über ihre Arbeit zu erstatten. Diese Berichterstattung war sachbezogen auf die Gegenstände der Rechtsprechung – also Rechtsfragen, Rechtsstreitigkeiten und Rechtsverletzungen – ausgerichtet. Die gemäß Art. 96 in ihrer Rechtsprechung unabhängigen Richter, Schöffen und Mitglieder gesellschaftlicher Gerichte hatten selbstverständlich keine Rechenschaftspflicht für ihre rechtsanwendende Tätigkeit, d. h. für die von ihnen (gemeinsam mit den Schöffen) erlassenen Urteile. Deren gegebenenfalls angezeigte Überprüfung erfolgte lediglich in den üblichen gerichtlichen Überprüfungsformen, so in Rechtsmittel und Kassationsverfahren. Der Zweck dieser Berichterstattung gemäß Art. 95 bestand darin, den Bürgern nahezubringen, wie die Rechtspflege agierte und welche Ergebnisse dabei zustandekamen. Zugleich diente sie auch der Vorbeugung und Verhütung von Rechtsverletzungen gemäß Art. 90 der Verfassung und der Stärkung eines demokratischen Rechtsbewusstseins. An die unmittelbaren Bestimmungen der Rechte der Bürger in Art. 99-102 schlossen sich Grundsatzbestimmungen zum Eingabenrecht an (Art. 103 bis 105). Diese wurden durch Gesetze untermauert und spezifiziert. Da das Eingabenrecht nicht zur Rechtspflege gehörte, soll darauf hier nicht näher eingegangen werden. Ich will jedoch daran erinnern, dass die Eingaben der Bürger in der DDR zu den wichtigsten Formen der öffentlichen Äußerung in persönlichen und gesellschaftlichen Anliegen gehörten. Sie vermittelten den politischen Gremien wichtige Informationen über Sorgen und Probleme der Bürger, lieferten ein Bild von der Realität im Lande, benannten Fälle, in denen Verfassungsanspruch und Verfassungswirklichkeit auseinandergingen. Diese Hinweise eröffneten Möglichkeiten, das nicht nur zu registrieren, sondern darauf auch zu reagieren. Im Vergleich dazu gewährt Art. 17 GG jedermann »das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die zuständigen Stellen oder die Volksvertretung zu wenden«. Die »Petitionen« genannten Eingaben allein schon deren Bezeichnung klingt mehr nach Monarchie denn nach Demokratie – müssen an den Petitionsausschuss des Bundestages gerichtet werden, dem die Bearbeitung »der Bitten und Beschwerden obliegt« (Art. 45 c GG). Dabei wird in der Regel nicht der Gegenstand untersucht und Abhilfe angeboten, sondern überprüft, ob die darin involvierten Verfassungsorgane gesetzeskonform gehandelt haben. In der DDR kam der Souverän, das Volk, unmittelbar zu Worte, in der BRD muss »der Rechtsweg« beschritten werden. Art. 106 DDR-Verfassung regelte die Staatshaftung. Er gewährleistete, dass Bürgern Schäden an ihrem persönlichen Eigentum zuverlässig ersetzt bekamen. Im GG findet sich ein Art. 34 mit der irreführenden Überschrift »Haftung bei Amtspflichtverletzungen«. Diese Verkündung erweist sich Eulenspiegelei. »Verletzt jemand in Ausübung eines ihm anvertrauten öffentlichen Amtes die ihm einem Dritten gegenüber obliegende Amtspflicht, so trifft die Verantwortlichkeit grundsätzlich den Staat oder die Körperschaft, in deren Dienst er steht. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten. Für den Anspruch auf Schadensersatz und für den Rückgriff darf der ordentliche Rechtsweg nicht ausgeschlossen werden.« Mit anderen Worten: Regresspflicht für politische oder andere Fehlentscheidungen besteht nicht, und wer das Gefühl hat, betrogen oder belogen worden zu sein, darf gern klagen. Da aber stehen die Prozesskosten vor. Kurzum, die namentlich von Walter Ulbricht auf den Weg gebrachte und per Volksentscheid 1968 angenommene Verfassung war ein Meilenstein in der deutschen Rechtsgeschichte. Sie bildete die Grundlage für wahrhaft demokratische Rechtspflege. Dass sie in etlichen Punkten der Wirklichkeit vorauseilte und manche gesetzliche Ableitung mehr der aktuell-politischen Lage, sprich: der Klassenkampfsituation folgte als den Intentionen der Verfassungsväter, nimmt nichts von ihrem demokratischen, sozialistischen Charakter.
Hans Voß: Die DDR als »sozialistischer Staat deutscher Nation«
Hans Voß, Jahrgang 1931, geboren und aufgewachsen in Demmin, nach Schulbesuch Angestellter beim Rat des Kreises Demmin, Eintritt in den diplomatischen Dienst der DDR 1953 und Studium an der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften »Walter Ulbricht«. Bis 1960 Leiter der Abteilung für Deutsche Fragen im MfA. Von 1965 bis 1970 Leiter der 6. Europäischen Abteilung im MfAA (BRD). 1970 war er Sekretär der Arbeitsgruppe für das deutsch-deutsche Gipfeltreffen in Erfurt und Kassel. Danach (bis 1977) Botschafter der DDR in Rumänien, anschließend in Italien (bis 1985), Zweitakkreditierung für Malta. Von 1986 bis 1989 Stellvertretender Leiter der DDR Delegation beim KSZE-Folgetreffen in Wien. Du bist, wenn man so will, einer der Väter der Verfassung von 1968. Wie lief das damals? Die Verfassungskommission, bestehend aus etwa fünfzig Personen aus verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, hatte sich den Sachverstand von etwa zwei Dutzend Experten hinzugeholt, u. a. Prof. Poppe, Gerhart Eisler, Uwe-Jens Heuer, Kurt Wünsche, Karl-Heinz Schulmeister, Friedrich Dickel und ich. Wir waren ungefähr ein Dutzend Fachleute, von denen jeder ein Thema bearbeitete. Die Arbeit bestand aus drei Phasen: der Ausarbeitung eines Entwurfes, dann die öffentliche Diskussion und schließlich die Einarbeitung der Änderungen, Vorschläge, Ergänzungen etc. Ulbricht gab die Linie vor, wie die Verfassung aussehen sollte? Ja. Dabei legte er großen Wert auf verschiedene Aspekte. Deutschland, deutsche Einheit, Nation, Verhältnis zur Bundesrepublik sollten in einer bestimmten Weise zur Geltung kommen. In seinem Grundverständnis waren die beiden deutschen Staaten temporären Charakters, was in der Verfassung auch sichtbar werden sollte. Deshalb lautete der erste Satz von Artikel 1: »Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation.« Das fand nicht überall Beifall, wie wir wissen. Was konkret war deine Aufgabe? Eben jene deutschlandpolitischen Teile zu formulieren. Das waren, wie ich erst später erfuhr, die neuralgischen Punkte, die heftige Diskussionen im Politbüro hervorriefen. Warum? Ulbricht war dort offenkundig einer der wenigen, vielleicht gar der Einzige, der vom Fortbestand der deutschen Nation ausging und der noch immer an die Möglichkeit der Herstellung der deutschen Einheit glaubte. Wie erfolgte die Vermittlung der von ihm gewünschten Prämissen? Er lud uns ein. Zwei oder drei Mal gab es mit den »Experten« Gesprächsrunden, in denen er uns erläuterte, wie er dieses und jenes gern hätte und warum. Das war die Zeit, wo die Oberen noch mit den Unterstellten direkt sprachen. Also keine Direktive: »Ihr müsst …«, sondern argumentativ begründet. Ja. Allein? Nein, Gerhard Kegel[Anmerkung 186] stand ihm dabei zur Seite. Herbert Graf auch, der der Sekretär der Abstimmungskommission war. Es war erkennbar, dass Ulbricht sich sehr intensiv auf diese Sitzungen vorbereitet hatte. Den nach der Volksaussprache von uns überarbeiteten und redigierten Text behandelte schließlich die eigentliche Verfassungskommission, also die Vertreter aus dem Politbüro und aus den Blockparteien. Dabei kam ein Entwurf heraus, der sich von dem von uns vorgelegten erheblich unterschied. Da waren entscheidende Passagen, sagen wir mal, abgemildert. Konkret? Die Aussage »Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialistischer Staat deutscher Nation« war eliminiert. Dass diese Streichung im Politbüro erfolgt war, wusste ich. Aber es entzog sich meiner Kenntnis, ob das hinter Ulbrichts Rücken oder mit seiner Zustimmung erfolgt war. Der Satz fehlte jedenfalls. Auf der Sitzung der Kommission mit den Experten hatten wir die Möglichkeit, unsere Einwände gegen diese Vorlage vorzutragen. Jeder äußerte sich zu dem Teil, den er verantwortete. Ich stand also auf und erklärte, dass ich mit den Veränderungen der deutschlandpolitischen Passagen nicht einverstanden sei und vorschlüge, beim ursprünglichen Text zu bleiben. Es regte sich Protest. Ulbricht, der die Sitzung leitete, beschwichtigte: »Ruhig, Genossen, hören wir uns doch mal genau an, was der Genosse Voß meint.« Ich denke, Ulbricht sah hier die Möglichkeit, sich in der deutschen Frage noch einmal klar zu positionieren. »Hast du einen genauen Text zur Hand, Genosse Voß? Komm doch mal vor und zeig ihn mir.« Ich ging also zum Präsidium und legte das Papier auf den Tisch. Er schaute darauf und sagte, das scheine ihm nachdenkenswert. Wir sollten darum jetzt nicht entscheiden und nur zur Kenntnis nehmen, was vorgeschlagen worden sei. Ulbricht blieb beim Ursprungstext? Ja. Denn die schließlich durch Volksentscheid 1968 angenommene Verfassung enthält diese nationalen Elemente. Sie wurden bekanntlich erst in der 74er Fassung, nach Ulbrichts Tod, getilgt. Das Festhalten an dieser Formel, die ja praktisch die deutsche Einheit als Perspektive beschrieb, hätte Konsequenzen gehabt. Ich meine nicht jene, dass Ulbricht an die Überwindung der Zweistaatlichkeit unter sozialistischer Flagge dachte, sondern die Zugehörigkeit beider Staaten in verschiedenen Militärbündnissen. Da sich diese feindlich gegenüberstanden, bedeutete dies ein Ausscheiden aus Warschauer Vertrag und NATO. Ist das diskutiert worden? Unter uns Experten schon. Ein vereintes neutrales Deutschland war eine denkbare Option. Wir haben damals ernsthafter, als später dargestellt, über die Möglichkeit einer Konföderation gesprochen. Aber die Machtverhältnisse in einer solchen Konföderation waren doch absehbar, da brauchte man nur auf die Landkarte zu schauen. Im Osten wäre der gesellschaftliche Fortschritt zurückgedreht worden, es hätte – wie nach 1990 brachial erfolgt – eine Restauration überwundener Macht und Klassenverhältnisse gegeben. Ulbricht war für eine sozialistische deutsche Nation. Deshalb hieß es explizit in Artikel 8: »Die Deutsche Demokratische Republik und ihre Bürger erstreben darüber hinaus die Überwindung der vom Imperialismus der deutschen Nation aufgezwungenen Spaltung Deutschlands, die schrittweise Annäherung der beiden deutschen Staaten bis zu ihrer Vereinigung auf der Grundlage der Demokratie und des Sozialismus.«[Anmerkung 187] War das nicht illusionär? Das mag man mit dem Wissen von heute so sehen. Ich glaube aber, dass jede erfolgreiche Politik eine Vision braucht, eine langfristige Perspektive verfolgen muss. Ulbrichts Idee passte weder den Großmächten noch deren Verbündeten in Bonn und Berlin in den Streifen. Deshalb störte er und wurde abserviert. Auch die SPD hatte 1958 einen Deutschlandplan vorgelegt, der gefiel den Amerikanern nicht – deshalb verschwand er innerhalb kurzer Zeit. Das heißt, alle deutsch-deutschen Annäherungsversuche wurden sowohl von der westlichen als auch von der östlichen Führungsmacht beargwöhnt. Dennoch war die Haltung richtig. Ich habe damals Ulbrichts Überlegungen und sein Agieren in der deutschen Frage unmittelbar beobachten können und teile die Auffassung von Egon Bahr, die dieser erst unlängst wieder in seinem Buch »Gedächtnislücken« artikulierte: Es gab in der Nachkriegszeit nur zwei deutsche Staatsmänner von Bedeutung Adenauer und Ulbricht.[Anmerkung 188] Du hast Monate später Ulbricht erneut unmittelbar erlebt in der Vorbereitung der Treffen in Erfurt und Kassel. Ich war im Außenministerium Leiter der für die Bundesrepublik zuständigen Abteilung und im Auftrag Ulbrichts in Bonn. Ich übergab den Brief, den er an Bundespräsident Heinemann geschrieben hatte. Michael Kohl und ich hatten den Brief formuliert, aber die Initiative dazu ging von Ulbricht aus. Er wollte auch mit Heinemann sprechen, was wir ihm aber ausreden mussten: Der Bundespräsident war nicht seine bzw. keine Gesprächs- oder Verhandlungsebene. Heinemann reagierte auch wie erwartet: Die Antwort ging an Ministerpräsident Stoph. Du bist also mit dem Auto nach Bonn ins Bundespräsidialamt gefahren, hast gesagt: Guten Tag, ich bin der Herr Voß, ich habe Post vom Staatsratsvorsitzenden der DDR für den Herrn Bundespräsidenten. Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich war avisiert und wurde bereits von Horst Ehmke und Dietrich Spangenberg erwartet. Ehmke war bis vor kurzem Staatssekretär im Bundesjustizministerium, das Gustav Heinemann in der Großen Koalition führte. Dann war er selber Justizminister, als Heinemann kandidierte und Bundespräsident wurde, und seither, in der sozialliberalen Bundesregierung unter Willy Brandt, war er Bundesminister für besondere Aufgaben und Chef des Bundeskanzleramtes. Spangenberg war unter dem Regierenden Bürgermeister Willy Brandt Chef der Berliner Senatskanzlei, dann Senator für Bundesangelegenheiten und nunmehr Staatssekretär im Bundespräsidialamt. Obwohl das Schreiben nicht an sie gerichtet war, machten sie das Kuvert in meinem Beisein auf und lasen. Dann nahm das Ganze seinen bekannten Lauf. Also halten wir fest: Der Anstoß für den deutsch-deutschen Dialog kam von Ulbricht. So ist es. Und dass Bonn erstmals darauf reagierte, war ein Fortschritt. Es stärkte Ulbricht in seiner nationalen Position. Die beiden Begegnungen in Erfurt und Kassel brachten keine greifbaren Resultate, man trennte sich zu einer »Denkpause«. Lag es nur daran, dass die internationale Konstellation noch nicht so weit war? Sicher lag das daran. Auch in der Führung der SED gab es dafür keine Mehrheit, nach meinem Eindruck war Ulbricht in dieser Frage isoliert. Ulbricht wollte Bewegung in die deutsch-deutschen Beziehungen bringen, das Politbüro nicht. Die machten ihre Witzchen: Denkpause vom Denken oder Denkpause zum Denken hieß es, um das Unternehmen ein wenig herunterzuspielen. Es ist ja nichts dabei herausgekommen, war ja nichts. Du warst Teil der DDR-Delegation in Erfurt und Kassel. Ich war Sekretär der Delegation. – Ich will aber widersprechen. Es ist nicht nichts dabei herausgekommen. Es ist etwas Wesentliches passiert: Zum ersten Mal in der Geschichte verhandelten die beiden deutschen Regierungschefs auf Augenhöhe miteinander! Dass bei dieser ersten Begegnung etwas Greifbares herauskommen würde, war nach zwei Jahrzehnten erbitterter Feindschaft doch nicht zu erwarten. Aber Erfurt und Kassel demonstrierten vor aller Welt: Die beiden Staaten und ihre Spitzen wollen miteinander reden und können auch miteinander reden. Der Gesprächsfaden war aufgenommen und sollte nie wieder reißen. Bei Egon Bahr liest sich das so: »Das erste Treffen der beiden deutschen Regierungschefs war eine Nachricht. Aber überzeugender waren die Bilder aus Erfurt. Sie zeigten, für viele in Ost und West überraschend: Wenn man die Deutschen lässt, wollen sie sich vereinigen.«[133] Von deinem damaligen Chef Otto Winzer stammt der treffende Kommentar auf Bahrs Politik des Wandels durch Annäherung: Er nannte sie Konterrevolution auf Filzlatschen. Hat er es damals schon gesagt oder erst später? Obwohl ich selber recherchierte, wann und wo Winzer das gesagt haben soll, muss ich den Beweis schuldig bleiben. Ich habe keine Quelle gefunden. Aber Bahr meinte einmal: Wer immer das gesagt hat: Er hatte damit Recht! Auf alle Fälle stammt dieses Zitat aus der Zeit vor Erfurt und Kassel. Das Wort kam m. E. im Zusammenhang mit Brandts Regierungserklärung 1969 auf. Er hatte die DDR mit seiner Formulierung der zwei Staaten in Deutschland in Zugzwang gebracht. Inwieweit war man sich auf unserer Seite bewusst, dass diese Annäherung existenzielle Folgen für die DDR haben könnte? Die Winzer zugeschriebene Bemerkung deutet es an, dass man es spürte. In dieser Phase wurde in der DDR Führung heftig diskutiert: aktiv sein oder abblocken? Ulbricht war für aktives, offensives Handeln. Die Mehrheit sah das anders und versuchte – am Ende erfolgreich – mit Moskaus Hilfe zu blockieren. Diese Kontroverse drang nicht an die Öffentlichkeit. Ulbricht aber setzte sich gegen alle durch und erklärte: Wir verhandeln! Und offenkundig hinter dem Rücken der sowjetischen Führung, denn Bahr, der sich seiner exorbitanten Kontakte zu Moskau rühmte, habe dort erfahren, dass Ostberlin das Treffen in Erfurt vorgeschlagen habe, »ohne Moskau zu konsultieren«.[133] Er habe sich für diese Auskunft mit der Nachricht revanchiert, dass Brandt bereits das Treffen vorbereiten lasse. Und schließlich weiter: »Über eine verschlüsselte Standleitung erhielt Moskau aus Bonn schneller, korrekter und ausführlicher als aus Ostberlin Bericht über den für die DDR nicht angenehmen Ablauf der Ereignisse in Erfurt mit dem Durchbrechen der Absperrungen.«[133] Bahr nährt auch den Verdacht einer Inszenierung mit dem Satz: »Was immer man über die DDR denkt, wenn die absperren wollen, können sie das.« Es hieß, die »Willy-Rufer« seien von Personen aus der SED-Führung bestellt worden, um insbesondere Moskau zu zeigen, dass »der Alte« die Sache nicht mehr im Griff habe und sich zudem mit seiner Westpolitik aufs Glatteis begebe, weshalb er wegmüsse. Von solchen Spekulationen hörte ich auch, aber dafür habe ich keine Anhaltspunkte. Ich habe am Vorabend des Treffens mit dem 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung Alois Bräutigam und allen für die Absicherung des Bahnhofvorplatzes Verantwortlichen die Sicherheitslage detailliert durchgesprochen. Da war alles klar, es schien alles sicher. Im Nachgang muss ich sagen: Alle Beteiligten haben den Andrang unterschätzt und nicht mit Hunderten Brandt-Fans gerechnet. Die Bilder waren dann schon längst in alle Welt gegangen, ehe die Parteischüler auf den Platz gebracht wurden, um unseren Willi zu bejubeln. Hat Ulbricht in deinem Beisein jemals dezidiert über die Mitgliedschaft in Militärbündnissen gesprochen? Nein, wobei er das natürlich immer im Blick hatte, weil er sich als Politiker verstand, der Verantwortung für ganz Deutschland wahrnahm und im Interesse der gesamten deutschen Nation handelte. In diesem Punkte unterschied er sich gravierend von Adenauer, der wollte das halbe Deutschland ganz statt das ganze Deutschland halb. Am Ende seines aktiven politischen Wirkens aber wurde Ulbricht bewusst, dass die Klassenkampfsituation sich nicht so entwickelte hatte, wie er es erhofft hatte. Ein sozial gerechtes, demokratisches, ein sozialistisches Gesamtdeutschland war unter den existierenden Umständen– national wie international – nicht möglich. Als er es sich eingestand, hat er resigniert – das war kurz bevor er abgeschoben wurde. Woran machst du das fest? Gab es Äußerungen von ihm? Oder war es eine Empfindung von dir? Eine Empfindung, die sich aus Gesprächen ergab. Als Botschafter begrüßte ich in Rumänien wiederholt Horst Sindermann und Werner Lamberz, mit denen ich ein sehr gutes Verhältnis hatte. Sie sagten auch, dass sie sich schämten, Ulbricht so beiseite geschoben zu haben. Wen machten sie dafür verantwortlich? Moskau.
Kurt Wünsche: Vom Hohenschönhausen Häftling zum Justizminister der DDR
Kurt Wünsche, Jahrgang 1929, Eintritt in die LDPD 1945 und Funktionen im Landesverband Sachsen und von 1951 bis 1954 im Parteivorstand. Im Zusammenhang mit dem 17. Juni 1953 kurzzeitig als »Agent« inhaftiert. Fernstudium an der Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft in Potsdam und Promotion (gemeinsam mit Manfred Gerlach) zum Dr. jur. 1964. Seit 1965 Stellvertretender Vorsitzender des Ministerrates, seit 1967 – in der Nachfolge Hilde Benjamins Justizminister. Rücktritt 1972 wegen der Verstaatlichung von privaten und halbstaatlichen Betrieben. Lehrtätigkeit als Professor für Gerichtsverfassungsrecht an der Humboldt-Universität zu Berlin. Vom 13. Januar bis 16. August 1990 erneut DDR-Justizminister im Kabinett von Hans Modrow und Lothar de Maizière. Als ich befragt wurde, ob ich einen Beitrag zu diesem Buch leisten wolle, war ich mir nicht bewusst, worauf ich mich eingelassen hatte. Mein erstes Manuskript erschien mir (leider erst gegen Ende der Ausarbeitung) durch zu häufige Wiederholungen bekannter Fakten und Daten aus dem Leben und politischen Wirken Walter Ulbrichts misslungen. Neben der eigenen Erinnerung stehen zahllose – sich nicht selten widersprechende – Biografien und Wertungen in Büchern und im Internet auf Abruf bereit. Ein Buch, von dessen Titel her ich es nicht erwartet hätte, war für mich besonders beeindruckend.[Anmerkung 189] Herausgeber Frank Schumann formulierte in seinem knappen Vorwort bis dahin ungewöhnliche, durch den Inhalt des Buches aber anschaulich belegte Thesen. Er bezeichnet dort Walter Ulbricht als »Reformer und Modernisierer«. Und ich verweise auf einen höchst interessanten Essay des klugen und bekannten deutsch-britischen Historikers und Publizisten Sebastian Haffner aus dem Jahre 1966, der sich mit der Frage beschäftigt, wie »gerade Ulbricht der erfolgreichste deutsche Politiker nach Bismarck und neben Adenauer werden konnte«. Walter Ulbricht, der nach der Machtübergabe an die Faschisten steckbrieflich als führender Kommunist und Reichstagsabgeordneter gesucht wurde, konnte sich nach sechs Monaten im Untergrund der Verhaftung durch Flucht nach Paris und später nach Prag entziehen, wo er für die jeweiligen Auslandsorganisationen der KPD arbeitete. 1938 verlegte er sein Exil nach Moskau und wurde Vertreter des ZK der KPD beim Exekutivkomitee der kommunistischen Internationale (EKKI). Er gehörte zu den Initiatoren des Nationalkomitees »Freies Deutschland« (NKFD) und war an der Gewinnung von Generälen, Offizieren und Soldaten, die in sowjetische Gefangenschaft geraten waren, für eine Mitwirkung am demokratischen Aufbau nach dem Sieg über den Faschismus maßgeblich beteiligt. Nach der Rückkehr Walter Ulbrichts in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands war er vor allem mit dem Wiederaufbau der KPD beschäftigt, deren Gründung bereits am 11. Juni 1945 stattfinden konnte. Es folgten kurz danach unter Führung von Otto Grotewohl die Wiedergründung der SPD sowie die Neugründungen der Christlich-Demokratischen Union sowie der Liberaldemokratischen Partei Deutschlands (LDPD), der ich mich mit 16 Jahren anschloss. Am 14. Juli 1945 bildeten diese vier Parteien – unter Wahrung ihrer Selbständigkeit – den Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien in der sowjetischen Besatzungszone. Dies war der Ausgangspunkt für eine über mehr als vier Jahrzehnte währende, erfolgreiche, wenn auch nicht immer unproblematische Zusammenarbeit. Diesem Block schlossen sich die 1948 gebildete Nationaldemokratische Partei (NDPD) und die Demokratische Bauernpartei (DBD) an. Hinzu kamen Massenorganisation wie der FDGB und die FDJ. 1946 fanden Landtagswahlen statt. In der sowjetisch besetzten Zone trat die inzwischen aus KPD und SPD gebildete SED sowie LDPD und CDU an. In allen fünf Ländern ging die SED als die mit großem Abstand stärkste Partei aus den Wahlen hervor. Im Land Sachsen-Anhalt verfügten jedoch LDPD und CDU über mehr Sitze als die SED, so dass die Liberalen in der Person von Dr. Erhard Hübner den Ministerpräsidenten stellte. In den anderen Ländern gehörten entsprechend den Mehrheitsverhältnissen die Ministerpräsidenten der SED an. LDPD und CDU stellten gemäß dem Blockprinzip jeweils mehrere Fachminister. Die Umwandlung der Besatzungszonen der Westmächte in den Separatstaat BRD zwang 1949 bekanntlich zu entsprechenden Reaktionen in Gestalt der Umwandlung der sowjetischen Besatzungszone in die DDR. Walter Ulbricht war im Zusammenhang mit der Vereinigung von KPD und SPD als Mitglied des Zentralsekretariats – de facto als stellvertretender Vorsitzender der SED – gewählt worden und hatte bedeutenden Anteil an der Initiative für die Gründung und Entwicklung der Volkskongressbewegung für Einheit und gerechten Frieden durch Beschluss vom 26. November 1947. Der 1. Volkskongress trat als deutschlandpolitisches Forum am 6. und 7. Dezember 1947 mit etwa 2.000 Delegierten aus Ost und West zusammen, obwohl die westlichen Besatzungsmächte die Mobilisierung für den Volkskongress in ihren Zonen untersagt hatten. Der 2. Deutsche Volkskongress fand am 17./18. März 1948 statt, nicht zufällig 100 Jahre nach dem Beginn einer bürgerlichen Revolution in Deutschland. Der Kongress vereinte wiederum etwa 2.000 Delegierte, darunter 500 westdeutsche. Der Kongress beschloss, aus Protest gegen eine mögliche Staatsgründung in den Westzonen, ein Volksbegehren für die deutsche Einheit in allen Besatzungszonen durchzuführen. Das Volksbegehren, das mit großer Beteiligung vom 23. Mai bis 13. Juni 1948 in der sowjetischen Besatzungszone stattfand, war in den Westzonen nicht genehmigt worden. Außerdem formierte sich ein Deutscher Volksrat, der vor allem mit der Ausarbeitung eines Entwurfs für eine gesamtdeutsche Verfassung beauftragt wurde. Der 3. Deutsche Volkskongress trat am 29./30. Mai 1949 in Berlin zusammen, nachdem 60 Prozent der wahlberechtigten Bürger in der SBZ den namentlichen Delegiertenvorschlägen in geheimer Wahl am 15./16. Mai 1949 zugestimmt hatten. Insgesamt 1.400 Delegierte kamen aus der sowjetischen Besatzungszone und – trotz aller Behinderungen – auch 610 aus den Westzonen. Der Kongress nahm mit einer Gegenstimme den – in Teilen erkennbar an der Weimarer Verfassung orientierten– Verfassungsentwurf an, den der Volksrat auftragsgemäß entworfen hatte und wählte den zweiten Deutschen Volksrat, der sich später taggleich mit der am 7. Oktober neu gegründeten DDR als Provisorische Volkskammer konstituierte.[134] Auf dem 3. Volkskongress wurde auch die Nationale Front des demokratischen Deutschland (später Nationale Front der DDR) in Gestalt einer nach dem Blockprinzip um alle Massenorganisationen erweiterten Volksbewegung ins Leben gerufen. Auf der 9. Tagung des Deutschen Volksrates am 7. Oktober 1949, also am Tage seiner Umbildung zur Provisorischen Volkskammer der DDR, wurde das Manifest der Nationalen Front vorgestellt. Im Februar 1950 konstituierte sich der Nationalrat der Nationalen Front. Eine der wichtigsten Aufgaben der Nationalen Front und ihrer Ausschüsse auf allen Ebenen bestand in der Vorbereitung der Wahlen zu den zentralen und örtlichen Vertretungskörperschaften. Das reichte von der Kandidaten-Vorstellung und Nominierung bis zur Einrichtung der Wahllokale und der öffentlichen Stimmenauszählung. Die jahrelange Zusammenarbeit zwischen den Blockparteien und insbesondere mit dem FDGB hob zwar nicht die Unterschiede zwischen ihnen und zu anderen gesellschaftlichen Organisationen auf, aber in den Vordergrund rückte mehr und mehr eine gemeinsame sozialistische Zielsetzung Natürlich hatten alle diese und spätere im Prinzip progressive Entwicklungen auch – mindestens für Teile der Bevölkerung – scheinbar oder tatsächlich nachteilige Konsequenzen. Ich glaubte zeitweilig selbst davon betroffen zu sein. Ich entstamme einer ausgeprägt bürgerlichen Familie. Vater war Korpsstudent, promovierter Chemiker und Privatunternehmer und gehörte mit meiner Mutter zu den Gründungsmitglieder der LDPD. Ich selbst trat ein halbes Jahr nach Kriegsende ebenfalls der Partei bei. Mitte 1946 schloss ich mich der FDJ an, was mich zunehmend auf den linken, sozialliberalen Flügel der Partei führte. 1948 hatte ich in Dresden erfolgreich die Abiturprüfung abgelegt und wollte wie Vater Chemie studieren. Da musste ich mir sagen lassen, dass ich als Bürgerlicher es später noch einmal versuchen solle, jetzt müssten erst einmal die Kinder der Arbeiter und Bauern studieren. Das nannte man Brechung des Bildungsprivilegs. Ich war verärgert, zog aber – im Unterschied zu vielen anderen abgewiesenen Studienbewerber – nicht nach Westdeutschland. Dort saßen mir zu viele Ehemalige auf den Kathedern. Ganz zufällig wurde mir die vakant gewordene Funktion eines hauptamtlichen Geschäftführers einer großen Dresdener Stadtbezirksgruppe der LDPD angeboten. Die Partei zählte zu jener Zeit mehr als 10.000 Mitglieder in Dresden. Ich habe offenbar gut gearbeitet, denn ich war ein Jahr später bereits Abteilungsleiter im Stadtkreisverband, wieder ein Jahr später in gleicher Funktion im Landesverband Sachsen, und 1951, mit 22 Jahren, berief man mich zum Leiter der Hauptabteilung für Organisation in der zentralen Parteileitung in Berlin. (Wohl auch – wie manch anderer - durch die kriegsbedingte Generationslücke begünstigt). Walter Ulbricht war in jener Zeit maßgeblich und wirkungsvoll bemüht, die Politik eines engen Bündnisses der Klassen und Schichten im Rahmen der Blockpolitik und der Nationalen Front im Interesse der DDR verstärkt fortzusetzen. Seine neuen Funktionen als Generalsekretär des ZK der SED und Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates waren dabei sehr hilfreich. Er ermunterte insbesondere die anderen Parteien dazu, international – natürlich vor allem in anderen progressiven Staaten – Kontakte aufzunehmen und Erfahrungen auszutauschen. Die LDPD war bereits dabei, mit Parteien in Polen und in der Tschechoslowakei in Verbindung zu treten. Walter Ulbricht meinte aber, dass seine Empfehlung auch andere Kontinente einschlösse. Er denke da beispielsweise an die Volksrepublik China, wo es Privatbetriebe mit staatlicher Kapitalbeteiligung gebe. Wir machten uns kundig und erfuhren dabei, dass neben der KP noch acht weitere Parteien existierten, darunter auch solche, die uns ähnlich waren. Im Unterschied zur LDPD bestehen diese noch immer. Die »Gesellschaft für den demokratischen Aufbau Chinas« praktiziert das Modell der staatlichen Beteiligung an Privatbetrieben bis heute sehr erfolgreich. Mit dieser Partei stellten wir freundschaftliche Beziehungen her, tauschten Delegation und nahmen wechselseitig an Parteitagen teil. Mit den dort gemachten Beobachtungen brachten wir Vorschläge für die staatliche Kapitalbeteiligung an privaten Betrieben in der DDR ein, die jahrelang mit sehr guten Ergebnissen arbeiten sollten. Darauf werde ich in anderem Zusammenhang noch zurückkommen. Hier möchte ich etwas aus »Lotte und Walter« zitieren, weil es sich kaum besser formulieren lässt: »Irgendwann hatte Ulbricht begriffen, dass weder das sowjetische Modell 1:1 auf Deutschland übertragen werden kann, noch dass die Sowjetunion unter Stalin es ernst meinte mit der ›Weltrevolution‹. Die UdSSR dachte, was das Recht einer Großmacht ist, seit den 30er Jahren meist an sich, und zwar bedingungslos selbsterhaltend. Als Walter Ulbricht auf der 2. Parteikonferenz am 9. Juli 1952 den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus proklamierte, war das ein Staatsstreich, gleichsam ein Putsch von oben, der Bismarcksches Format hatte. Der Genosse Generalsekretär […] erpresste Moskau mit der Tatsache, dass man einen sozialistischen Verbündeten nicht dem Klassenfeind ausliefern konnte. […] In der sogenannten Stalin-Note vom 15. März 1952 hatte Moskau den Westmächten den Rückzug aus Deutschland (und damit die Preisgabe der DDR) angeboten, wenn die Bundesrepublik nicht in den Westblock eingebunden würde. Über gesamtdeutsche Wahlen sollte ein neutrales Deutschland (als Puffer und Teil eines cordon sanitaire zur UdSSR ) geschaffen werden.«[135] Die Startbasis für das Projekt Aufbau der Grundlagen des Sozialismus war selbstverständlich eine entsprechende Steigerung des Nationaleinkommens, aber diese Basis wuchs nicht, sondern schrumpfte, weil die Westzonen bzw. die BRD ihre Reparationspflichten gegenüber der Sowjetunion, die mit weitem Abstand die größten Kriegsschäden erlitten hatte, nicht erfüllten. Als die Reparationsleistungen 1953 offiziell eingestellt wurden, hatte die Sowjetzone/DDR Leistungen in Höhe von 99,1 Milliarden DM an die Sowjetunion erbracht. Demgegenüber standen Reparationsleistungen der Westzonen/BRD an deren Besatzungsmächte in Höhe von 2,1 Milliarden DM. Das war auch einer der Gründe dafür, dass die Entwicklung der materiellen Lebensbedingungen im Osten mindestens stagnierte, zumal die sowjetische Führung – das Ende der Reparationszahlungen vor Augen besonders kräftig zulangte. Hinzu kam die Forderung nach Erhöhung der »Verteidigungsanstrengungen« durch Moskau, denn in Korea tobte seit Jahren ein heißer Krieg und der Kalte Krieg in Europa spitzte sich zu, in der Bundesrepublik marschierte die Wiederaufrüstung. Unter diesem Druck sah die DDR Führung die einzige Möglichkeit in der Erhöhung der Arbeitsnormen in den volkseigenen Betrieben, der Anhebung der Abgabemengen der Bauern und Kürzungen der Sozialleistungen. Privatunternehmern, selbständigen Handwerkern und Gewerbetreibenden wurden die Lebensmittelkarten entzogen mit Hinweis, sie sollten in der HO kaufen. Dort waren die Lebensmittel erheblich teurer. Diese Maßnahmen sorgten für verständlichen Unmut, die Forderungen nach ihrer Rücknahme wurden immer lauter und waren nicht mehr zu überhören. Die Führung der DDR reagierte darauf und nahm am 11. Juni einen Großteil der unpopulären Vorschriften zurück. Es wurde die Politik des Neuen Kurses verkündet. Doch ehe die Kurskorrektur »unten« ankam, und zumal der Westen insbesondere der Rundfunk im amerikanischen Sektor (Rias) – die sozialen Spannungen zu politischen erklärte und sie zielgerichtet schürte, gingen viele auf die Straße. Am 16. Juni 1953 bildeten sich große Demonstrationszüge von Produktionsarbeitern, die die sofortige Rücknahme der Normenerhöhungen forderten. Etwa 10.000 Werktätige versammelten sich schließlich vor dem Sitz der Regierung im »Haus der Ministerien« in der Leipziger Straße in Berlin. Ihnen wurde mitgeteilt, dass die Regierung auch die Normenerhöhungen wieder zurückgenommen habe. Das wurde begrüßt, aber einzelne Redner versuchten mit einigem Erfolg, die Demonstranten zu radikalisieren und aufzuhetzen, indem sie den Rücktritt der Regierung und Neuwahlen forderten. Dennoch blieb es friedlich. Das änderte sich am nächsten Tag, dem 17. Juni. In Berlin und in anderen Großstädten der DDR, wo es zu Gewalttaten kam, erklärte die sowjetische Besatzungsmacht den Ausnahmezustand und ließ die Panzer rollen. In anschließenden Verfahren gegen Randalierer wurde deutlich, dass westliche Dienste maßgeblich an den Vorgängen beteiligt waren. Egon Bahr, seinerzeit beim Rias, räumte die Beteiligung an den Vorgängen in der DDR ein: »Der Rias war, ohne es zu wollen (? – K. W.), zum Katalysator des Aufstandes geworden. Ohne ihn hätte es den Aufstand so nicht gegeben.« Anfang Dezember 1953 wurde ich in meinem Berliner Quartier in der Schönhauser Allee gegen Mitternacht unsanft laut von drei Herren geweckt. Sie wiesen mir ihre Papiere vor, mit denen sie sich als Mitarbeiter des Staatsekretariats für Staatssicherheit auswiesen. Sie forderten mich auf, sie »zur Klärung eines Sachverhalts« zu begleiten. Es sei sehr dringlich. Am Ende der Fahrt fand ich mich in einer spartanisch eingerichteten Zelle in Hohenschönhausen wieder. Heute heißt man diesen Trakt in der Gedenkstätte »U-Boot«, vielleicht hieß es in der damaligen U-Haftanstalt auch schon so. Binnen eines Vierteljahres wurde ich 46 Mal vernommen. Ich konnte keine substanzielle Antwort auf die ewige Frage nach meiner »Feindtätigkeit« geben. Ich war mir nicht der geringsten Schuld bewusst. Ich gebe zu: Als ich durch die Kellerluke die Weihnachtsglocken hörte, neben mir auf der Pritsche eine Blechschüssel mit lauwarmem Malzkaffee und zwei Scheiben Brot mit Magarine sah, und an die Familie dachte (die, wie ich später erfuhr, nichts von meinem Verbleib wusste), wurde ich sentimental und fast veranlasst, zu gestehen, was man von mir zu hören wünschte – in der illusionären Erwartung, dass ich dann nach Hause gehen könnte. Aber schlimmere als solche »Denkanstöße« gab es nicht, was Mithäftlinge bestätigen. Ich stelle das hier ausdrücklich fest, weil der Leiter der »Gedenkstätte« mit nahezu krankhafter Fantasie Schauergeschichten über die Folter im U-Boot verbreitet. Ich saß dort ein Vierteljahr und weiß es darum besser. Meine Beschwerden und Unschuldsbeteuerungen wurden schließlich doch ernst genommen und die »Belastungszeugen« noch einmal gründlich verhört. Wie später bei einer Gegenüberstellung klar wurde, handelte es sich bei den Denunzianten um den Leiter der zentralen Finanz- und Vermögensverwaltung der LDPD, Bezirkssekretäre aus Halle und Magdeburg und einen Kreissekretär aus dem Kreis Klötze, d. h. ausnahmslos um hauptamtliche Funktionäre der LDPD. Sie waren Agenten des »Ostbüros der FDP« und der KgU des Herrn Hildebrandt und hatten den Auftrag, im Falle einer Verhaftung mich als ihren Chef zu belasten, und zwar mit verschiedenen, nicht miteinander vergleichbaren Zeit- und Ortsangaben. Auf diese Weise sollten Personen in den Blockparteien, die politisch dem Westen nicht in den Kram passten, ausgeschaltet werden. Wie ich später in einem Gespräch von Walter Ulbricht erfuhr, hatte sich während meiner Haft mein väterlicher Freund Johannes Dieckmann, Präsident der Volkskammer, sehr besorgt an ihn gewandt und auch im Namen meiner Angehörigen um Auskunft über meinen Verbleib gefordert. Bei der von Ulbricht zudem veranlassten Überprüfung des Verfahrens wurden diverse Mängel festgestellt, deren Abstellung alsbald zu meiner Haftentlassung führte. Ich erhielt 2.000 Mark Haftentschädigung und einen dreiwöchigen Erholungsaufenthalt in Oberhof mit meiner Frau. Bald danach wurde Manfred Gerlach zum Generalsekretär der Partei berufen und ein Sekretariat des Zentralvorstandes gebildet, dem neben Gerlach vier Sekretäre, darunter auch ich, angehörten. Nach dem Tod von Präsident Pieck 1960 und der Berufung Gerlachs zum Stellvertreter des Vorsitzenden des neu gebildeten Staatsrates übernahm ich die Funktion eines Stellvertreters des Generalsekretärs der LDPD. An einem Chemiestudium war mir nicht mehr gelegen. Auch meine eben genannten bedrückenden Erfahrungen legten mir nahe, ein Jurastudium an der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften zu absolvieren, wo ich später auch promovierte und habilitierte. Außerdem wurde ich 1954 als Abgeordneter der Volkskammer gewählt, der ich bis 1976 angehörte. Zunächst war ich Mitglied des Jugendausschusses, später des Justizausschusses und des Verfassungs und Rechtsausschusses. Die Grenzsicherungsmaßnahmen am 13. August 1961 hatten zwar eine Konsoldierung der politischen und wirtschaftlichen Situation in der DDR bewirkt, die aber zunächst noch nicht zufriedenstellend war. Auf dem VI. Parteitag der SED im Januar 1963 leitete Walter Ulbricht eine Neuorientierung der Wirtschaftspolitik nach dem »Grundsatz des höchsten ökonomischen Nutzeffekts« und der »materiellen Interessiertheit« ein. Am 24./25. Juni 1963 verabschiedete eine gemeinsam vom Zentralkomitee der SED und dem Ministerrat einberufene Wirtschaftskonferenz die Richtlinie für das neue ökonomische System zur Planung und Leitung der Volkswirtschaft (NÖSPL). Sie wurde am 15. Juli vom Staatsrat der DDR als Richtlinie der künftigen Wirtschaftspolitik beschlossen. Das NÖSPL war faktisch ein staatliches Programm zur Reform der Planwirtschaft. Es war auf eine stärkere Eigenständigkeit von Betrieben – auch bei der Verwendung erzielter Gewinne sowie auf die Beschränkung und Präzisierung der Plankennziffern und auf eine stärkere Steuerung durch Zinsen, Prämien, Abgaben und Preise gerichtet. Die »materiellen Hebel« zur Steigerung der individuellen Leistungen (z. B. Prämien, Urlaubsplätze) sollten entwickelt werden. Immerhin stieg 1964 die Arbeitproduktivität um sieben Prozent. Wenn ich mich richtig entsinne, war Walter Ulbricht 1965 von Präsident Nasser nach Ägypten eingeladen und mit allen Ehren eines Staatsoberhauptes empfangen worden, ohne dass bereits normale zwischenstaatliche Beziehungen zwischen beiden Staaten bestanden oder unmittelbar hergestellt werden sollten. Von 1965 bis 1972 war ich als Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates für den aus Gesundheitsgründen ausgeschiedenen LDPD-Vorsitzenden Dr. Suhrbier tätig. 1967 wurde ich zusätzlich als Minister der Justiz berufen. In einem längeren persönlichen Gespräch während des Urlaubs in Dierhagen erörterten Ulbricht und ich auch die Frage, wie wir trotz Hallstein Doktrin und Alleinvertretungsanspruch Bonns volle diplomatischen Beziehungen zu anderen Staaten herstellen könnten. Dabei ging es u. a. um das Angebot des Abschlusses von Rechtshilfeverträgen. Ulbricht zeigte sich dabei als gewiefter Stratege. Zum einen mussten solche Verträge, deren Realisierung vergleichsweise wenig Aufwand erforderte, in aller Regel von den obersten Vertretungskörperschaften der beteiligten Staaten ratifiziert werden, weil es sich um Staatsverträge handelte. Diese Ratifizierung aber war ein Akt, der die beiderseitige staatliche Anerkennung der Partner bewirkte oder bekräftigte. In diesem Sinne und in ständigem Kontakt zum Staatsratsvorsitzenden habe ich 1969/70 gemeinsam mit Spezialisten meines Ministeriums Vertragsverhandlungen mit Nahoststaaten geführt und mit den Staatschefs Al Bakr (Irak), Nasser (VAR) und Atassi (Syrien) Einverständnis zu den genannten Verträge und ihren Konsequenzen erzielt. Walter Ulbricht hatte ein ausgeprägtes Interesse für Inhalt, Form und Wirkung rechtlicher Regelungen. Das zeigte sich besonders in verfassungs-, staats- und verwaltungsrechtlichen Fragen. Er hatte bereits erheblichen Anteil an der Ausarbeitung der DDR-Verfassung von 1949, die zwar starke Anklänge an die Weimarer bürgerlich-demokratische Verfassung aufwies, aber andererseits die Regelungen und Lücken vermied, die die Errichtung der faschistischen Diktatur faktisch begünstigt hatten. Viel Kraft und Zeit widmete er – als der Entwicklungsstand der sozialistischen Gesellschaft es ermöglichte und erforderte – der Ausarbeitung des Entwurfs einer neuen Verfassung. Ulbricht gab vor der Volkskammer am 1. Dezember 1967 eine Erklärung ab, in der er die Notwendigkeit einer neuen Verfassung ausführlich begründete. Das Parlament beschloss einstimmig Bildung und Zusammensetzung einer Kommission der Volkskammer zur Ausarbeitung einer sozialistischen Verfassung der DDR unter Vorsitz Walter Ulbrichts, der Vertreter aller in der Volkskammer vertretenen Parteien und Organisationen angehörten. Zur Unterstützung der Kommission wurden Sachverständige, darunter auch ich, berufen. Der von der Kommission vorgelegte Entwurf wurde mehrere Monate in einer breiten Volksaussprache diskutiert, in der insgesamt 12.454 Vorschläge selbstverständlich viele inhaltlich übereinstimmend – gemacht wurden, die zu 118 Änderungen im Entwurf (in der Präambel und 55 Artikeln) führten. Am 6. April 1968 fand dann der Volksentscheid statt. Von 12.208.986 Abstimmungsberechtigten hatten 11.536.803 – das waren 94,49 Prozent der Verfassung der DDR zugestimmt. Walter Ulbricht würdigte in seiner Begründung für eine neue DDR Verfassung ausdrücklich den Beitrag, den private Unternehmer, Handwerker und andere Gewerbetreibenden beim sozialistischen Aufbau leisteten. Diese sozialen Schichten wie auch Intellektuelle bürgerlicher oder kleinbürgerlicher Herkunft waren für den weiteren sozialistischen Aufbau keineswegs hinderlich. Offenbar konnten dies Breshnew und seine Brüder im Geiste in der sowjetischen Führung ebenso wenig verstehen oder billigen wie den Fortbestand von privaten und halbstaatlichen Betrieben oder auch das ganze NÖSPL. Außerdem war die Ungeduld der mehr oder minder designierten Nachfolger des immerhin schon auf die 80 zugehenden Ulbricht nicht zu übersehen. Hätten sie es doch wenigstens unterlassen, einen siebenseitigen Brandbrief mit der Bitte, Walter Ulbricht gewissermaßen aus dem politischen Verkehr zu ziehen, nach Moskau zu senden, und es selbst in die Hand genommen. Kurze Zeit nach Ulbrichts Ablösung begann auch die Kampagne zur Überführung der Betriebe mit staatlicher Beteiligung und der Privatbetriebe in Volkseigentum. Ich machte im Ministerrat darauf aufmerksam, dass zwei Voraussetzungen gesichert werden müssten: Freiwilligkeit und klare gesetzliche Grundlagen. Weiter kritisierte ich ein Wetteifern von Bezirksleitungen der SED um den schnellsten Abschluss der Überführung. Ich wiederholte das mit Nachdruck auf dem XI. Parteitag der LDPD und fügte hinzu, dass Störungen in der Produktion der Betriebe für die Versorgung der Bevölkerung unbedingt vermieden werden müssten. Das alles wurde nicht beachtet und zwang dazu, in Kombinaten unrentable Sonderabteilungen für die Konsumgüter Produktion einzurichen. Der Staatsratsvorsitzende Stoph und Parteichef Honecker forderten meinen Parteivorsitzenden Gerlach auf, »das bürgerliche Element aus dem Ministerrat und seinem Präsidium zu entfernen«, womit ich gemeint war. Ministerpräsident Horst Sindermann kommentierte gegenüber Manfred Gerlach: »Wenn Wünsche den Mund aufmacht und meist sehr vernünftige Standpunkte vertritt, lässt Willi (Stoph) sofort die Jalousien herunter.«[136] Unter diesen Umständen habe ich selbstverständlich aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen – meinen Rücktritt erklärt, und zwar als Minister und als stellvertretender Parteivorsitzender. Ich bat um eine Botschafterfunktion, was strikt abgelehnt wurde. Also habe ich mich an der Sektion Rechtswissenschaft der Humboldt-Universität um eine Professur für Gerichtsverfassungsrecht bemüht und diese 1972 auch erhalten. Anfang Januar 1990 bin ich wieder Justizminister worden, aber weil ich dem »Einigungsvertrag« nicht zustimmte, trat ich – diesmal tatsächlich auf eigenen Wunsch – am 15. August 1990 zurück. Anschließend habe ich bis zu meinem 70. Lebensjahr in einer Anwaltskanzlei aus mir vertrauten Mitarbeitern des DDR- Justizministeriums gearbeitet. Aus der LDPD bin ich wegen übelster Bedingungen bei der bevorstehenden Einverleibung in die FDP im Juli 1990 ausgetreten.
Inge Lange: In der Frauenpolitik, so Ulbricht, dürfen nicht die Buchhalter reden
Inge Lange, Jahrgang 1927, geboren und aufgewachsen in Leipzig, gelernte Schneiderin, 1945 Eintritt in die KPD, bis 1961 aktiv in verschiedenen FDJ Funktionen, 1963 Kandidat, 1965 (bis 1989) Mitglied des ZK der SED, von 1963 bis 1989 Volkskammerabgeordnete, 1973 Kandidat des Politbüros (bis 1989) und als ZK-Sekretär verantwortlich für Frauenfragen. 1990 Ausschluss aus der SED-PDS. Im Jahr 1961 endete meine politische Arbeit in der Freien Deutschen Jugend, die ich sehr geliebt habe und die mir das Glück bereitete, bis heute viele gute Freunde zu haben. Mit einem Ruck – in den frühen Jahren der DDR geschah das oft – landete ich auf einer verantwortungsvollen Funktion im Haus des ZK der SED: Vorsitzende der Frauenkommission beim Politbüro des ZK der SED. Das war alles andere als ein ruhiger Posten. Die Durchsetzung der Frauenrechte und die Gleichstellung von Frau und Mann hatten einen hohen Stellenwert und waren keinesfalls Randthemen in der Politik der SED und der Regierung der DDR. Meine Mitgliedschaft in der Frauenkommission und meine Verantwortung für die Belange der Mädchen und jungen Frauen in der FDJ hatten mir davon eine Vorstellung vermittelt. Auch hatte ich als Frau, die sich, geprägt durch das Elternhaus, schon in jungen Jahren politisch betätigte, einige Erfahrungen gesammelt, was es hieß, nach Jahrhunderten des Patriarchats auch unter sozialistischen Bedingungen ein Umdenken in Bezug auf die Rolle der Frau in der Gesellschaft zu bewirken. Es galt nicht nur alte Denk- und Verhaltensweisen der Männer aufzubrechen. Auch das Selbstbewusstsein der Frauen zu stärken war nicht einfach. Ich erinnerte mich gut an die Umstände meines Ausscheidens aus der Funktion des 1. Sekretärs der Gebietsleitung der FDJ in der SDAG Wismut im Jahre 1950. Da meldete mir der »Buschfunk« die Meinung leitender Vertreter der Verwaltung des Unternehmens – auch und gerade der sowjetischen –, wie es denn sein könne, dass die Gebietsorganisation der FDJ, die fast ausschließlich aus männlichen Mitgliedern bestand, ausgerechnet von einer Frau geleitet würde. Ich war also schon mit manchen Warnsignalen ausgestattet, als mich Walter Ulbricht Anfang der 60er Jahre zu einem ausführlichen Gespräch einlud. »Du wirst viel kämpfen müssen«, waren seine ersten Worte, und er empfahl lächelnd, mir eine Jacke mit verstärkten Ellenbogen anzuschaffen. »Frauenarbeit ist ein schwieriges Gebiet, ich kenne mich da ein bisschen aus.« Dann erzählte er mir aus seiner Kindheit und Jugend. »Immer, wenn meine Mutter begann, den großen Berg Wäsche zu bügeln, hat sie nach mir gerufen: ›Walter, hol das Buch und lies mir vor!‹ Gemeint war das Werk August Bebels ›Die Frau und der Sozialismus‹.« Walter wollte mir damit offenbar zu verstehen geben, dass er dieses – man kann schon sagen – Lehrbuch für die Frauenpolitik einer sozialistischen Partei selbst gut kannte. Zum Anderen wies er mich auf den theoretischen Leitfaden für meine neue Aufgabe hin. Allein die Tatsache, dass er sich selber die Zeit nahm, mich in die neue Aufgabe einzuweisen, wies auf den hohen Stellenwert hin, den er persönlich der Frauenpolitik einräumte. In der Tat konnte ich in den Jahren unserer Zusammenarbeit seine Sachkunde kennen und schätzen lernen. Nicht in Gestalt kleinlichen Hineinredens. Das kam selten vor. Mehr in verständnisvoller Unterstützung meiner Anliegen zur Frauenförderung in ihrer ganzen Breite. In seiner Frau Lotte hatte er dabei keine schlechte Beraterin. Gleich in das erste Halbjahr meiner neuen Tätigkeit fiel die Erarbeitung des Kommuniqués des Politbüros »Die Frauen – der Frieden und der Sozialismus«, veröffentlicht am 23. Dezember 1961. Kommuniqués, also Verlautbarungen der Parteiführung, waren Richtlinien für Gebiete der Gesellschaftspolitik, die von der Partei zum jeweiligen Zeitpunkt als besonders wichtig erachtet wurden. Sie besaßen keine Gesetzes- oder Verordnungskraft, aber sie waren wohl überlegte, lange diskutierte, vorausschauende Anleitungen zum Handeln. In der Regel wurden sie, weil überzeugend und vernünftig, von der Mehrheit begrüßt und unterstützt. Sie waren ein wichtiges Instrument, mit dem die SED ihrer in der Verfassung der DDR verankerten führenden Rolle gerecht wurde, und so wurden die Kommuniqués auch wahrgenommen. Schwieriger war ihre Verwirklichung. Die erforderte sehr viel Überzeugungsarbeit, Ausdauer, Stehvermögen und realistische Ideen, um in diversen Gesetzen und Verordnungen die Anliegen der Frauen unterzubringen. Obwohl in der Verfassung der DDR die Gleichberechtigung der Frau verankert und mit dem »Gesetz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau« vom 27. September 1950 (aufgehoben mit dem Einigungsvertrag vom 31. August 1990) grundlegende Voraussetzungen für die Entfaltung der Fähigkeiten und Talente der Frauen geschaffen waren, erachtete Walter Ulbricht es als notwendig, dieser gesellschaftlichen Aufgabe mit einem ganz speziellen Beschluss Nachdruck zu verleihen. Es liegt in der Natur der Sache, dass solch ein Dokument viele Mütter und Väter hat, aber ich kann aus eigenem Erleben sagen, dass das Frauenkommuniqué in sehr hohem Maße die Handschrift Ulbrichts trug. Er war auch der Inspirator dieses Wegweisers für die Frauenpolitik der DDR. Die Entwürfe gingen eine lange Zeit hin und her. Nicht nur einmal bekam ich sie mit handschriftlichen Randbemerkungen von Walter zurück. Mir war von vornherein klar, dass es eine vorrangige Aufgabe der Frauenkommission sein würde, den Forderungen des Kommuniqués Gesetzeskraft zu verleihen, was dann auch geschah. Sie alle aufzuzählen, würde Seiten füllen. Allein im Arbeitsgesetzbuch der DDR fanden viele Forderungen ihren Niederschlag. Um die Intentionen Walter Ulbrichts in der Frauenpolitik deutlich zu machen, komme ich nicht umhin, einige Aspekte des Frauenkommuniqués näher zu beleuchten. Aus historischer Sicht ist interessant: Das Hauptanliegen des Kommuniqués, dass »die Frau beim Aufbau des Sozialismus mehr als bisher zur Geltung kommt und ihre Lebensbedingungen verbessert werden«, wurde eingebettet in die großen politischen Ziele der Nachkriegszeit: »Die Verwirklichung dieser Aufgabe erfordert vor allem, durch den Abschluss eines Friedensvertrages und die Lösung der Westberlinfrage die Reste des Kalten Krieges zu beseitigen.«[137] Dass das zweite zehn Jahre später mit Kompromissen gelang, der Friedensvertrag aber nie zustande kam, hat für die Frauen in Deutschland bis heute nachteilige Folgen. Mit voller Berechtigung stellte das Kommuniqué fest: »Dieses neue Leben der Frauen in der Deutschen Demokratischen Republik ist Beispiel und Vorbild für ganz Deutschland«, und es wagte den Ausblick: »Dann werden sie (die westdeutschen Frauen – I. L.) wie die Frauen und Mädchen in der DDR gleichberechtigte Bürger, sie werden der Sorge um den morgigen Tag enthoben sein.«[137] Leider bestimmen soziale Ängste noch heute (und in Ostdeutschland wieder) den Alltag der Frauen in diesem Land. Ulbricht hat stets den Finger in die Wunde gelegt und mochte es, Mängel und Versäumnisse offen auszusprechen (unsere überzogene Furcht vor der »Fehlerdiskussion«, die übrigens auch mit Lenins Auffassung vom Verhalten einer sozialistischen Partei neuen Typus, wenn sie an der Macht ist, kollidierte, hatten wir uns erst später angeeignet). So findet man im Frauenkommuniqué nach der Würdigung des Erreichten unter anderem die harsche Feststellung: »Das Politbüro ist jedoch der Meinung, dass die(se) großen Fähigkeiten und Leistungen der Frauen und Mädchen ungenügend für ihre eigene Entwicklung und für den gesellschaftlichen Fortschritt genutzt werden. Die Hauptursache dafür ist die bei vielen – besonders bei Männern, darunter auch leitenden Partei , Staats-, Wirtschafts- und Gewerkschaftsfunktionären – noch immer vorhandene Unterschätzung der Rolle der Frau in der sozialistischen Gesellschaft. Es ist eine Tatsache, dass ein völlig ungenügender Prozentsatz der Frauen und Mädchen mittlere und leitende Funktionen ausübt, obwohl 68,4 Prozent aller arbeitsfähigen Frauen im Alter von 16 bis 60 Jahren berufstätig sind. Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Zahl der jungen Frauen und Mädchen, die für technische Berufs ausgebildet werden, zurückgeht. Das Politbüro des ZK der SED ist damit nicht einverstanden und fordert besonders die Mitglieder und Kandidaten der Partei auf, sich für die Überwindung dieses Widerspruchs einzusetzen.«[137] Es war mir auch vergönnt, ein anderes wichtiges Merkmal in Ulbrichts Führungsstil kennenzulernen. Er hielt nichts von allgemeinen Appellen. Ob es um Mängel und Versäumnisse ging oder um die Orientierung auf neue Aufgaben, er wollte stets, dass Ross und Reiter genannt werden. Darum wurden im Frauenkommuniqué lückenlos die Adressaten für den Auftrag genannt, in Fragen der Frauenförderung und ihrer Gleichstellung in der Gesellschaft in möglichst kurzer Zeit große Fortschritte zu erzielen: »Von den Genossen im Ministerrat und seinen Organen, in den Leitungen der Staatlichen Plankommission und des Volkswirtschaftsrates, in den Ministerien für Volksbildung, Verkehrswesen, Handel und Versorgung, im Staatssekretariat für das Hoch- und Fachschulwesen, in den Leitungen der VVB, den örtlichen Staatsorganen und den Werkleitungen erwartet das Politbüro, dass Maßnahmen festgelegt werden, die zu einer Erhöhung des Anteils der Frauen in mittleren und leitenden Funktionen führen.« Und um dies nicht dem Zufall zu überlassen, erhielten die Frauenförderungspläne einen höheren Stellenwert. Jede Betriebsleitung und jeder Genossenschaftsvorstand waren verpflichtet, jährlich Frauenförderungspläne zu beschließen. In den volkseigenen Betrieben (VEB) und staatlichen Einrichtungen waren sie Bestandteil des Betriebskollektivvertrages, der zwischen den Betriebleitungen und den Belegschaften jährlich abgeschlossen wurde. Gesetzlich festgelegter Verhandlungspartner für die Werktätigen war die Betriebsgewerkschaftsleitung des FDGB. Natürlich gab es da auch manchen Formalismus, denn nicht überall wurden sie mit der nötigen Sorgfalt ausgearbeitet, und nicht in jedem Betrieb machten sich die Frauen stark genug. Dies wohl wissend stand im Kommuniqué der hohe Anspruch, Frauenförderungspläne »auf wissenschaftlicher Grundlage, d. h. entsprechend unserer großen Perspektive« zu erarbeiten. »Schon bei der Planung der Berufsausbildung und der Ausbildung der Hoch- und Fachschulkader ist die Rolle der Frau in der sozialistischen Gesellschaft und ihre Entwicklung auf technischen und naturwissenschaftlichen Gebieten mehr zu beachten.«[137] Natürlich hatte die Frauenförderung auch eine wirtschaftspolitische Komponente. Im Krieg waren viele Männer geblieben, die als Arbeitskräfte fehlten, und die Abwanderung und gezielte Abwerbung nach dem Westen riss erhebliche Lücken. Dennoch stand diese Frage nicht im Vordergrund der Abfassung des Frauenkommuniqués. Ich erinnere mich, dass im Gegenteil Walter Ulbricht mich immer wieder ermahnte: In der Frauenpolitik dürfen die Buchhalter nicht das erste und letzte Wort haben. Er wollte damit ausdrücken, dass es um ein gesellschaftlich hochrangiges Problem ging, bei dem die Politik die Feder führen musste. Dies entsprang auch seiner festen Überzeugung, dass die Gleichberechtigung der Frau ein unabdingbares Prinzip des Marxismus Leninismus ist. Wie es praktisch gemeint war, lässt sich unter anderem an seiner unmissverständlichen Kritik an falschen Einstellungen erkennen. »Anstatt den Frauen und Mädchen zu helfen, mit ihrer größeren Belastung fertig zu werden, erfinden sie Argumente, die beweisen sollen, dass der Einsatz von Frauen in mittleren und leitenden Funktionen nicht möglich sei. Insbesondere wird behauptet, dass die Berufstätigkeit der Frau mit Haushalt und Kindern volkswirtschaftlich nicht ›rentabel‹ sei. Männer seien zuverlässiger und würden nicht so oft ›ausfallen‹, ja, es gibt auch das ›Argument‹, Frauen hätten weniger Verständnis für technisch organisatorische und wirtschaftliche Probleme als die Männer. All diese und ähnliche Erscheinungen widersprechen dem Wesen unseres Staates. Sie hemmen die Entwicklung der Frau und damit unserer ganzen Gesellschaft.« Hier ging es um eindeutig ideologische Barrieren, die zu überwinden waren. Oftmals wurden sie nicht offen ausgesprochen, sondern hinter fehlenden volkswirtschaftlichen Möglichkeiten versteckt. Geradezu ein Steckenpferd Ulbrichts war die schwerpunktmäßige Orientierung auf die Frauenförderung in den Betrieben und Einrichtungen. Das war insofern auch logisch, weil der Beschäftigungsgrad der Frauen in der DDR sehr hoch lag. Für Singles und Alleinerziehende war es ohnehin selbstverständlich. Für manche verheiratete oder in einer Beziehung lebende Frauen war es notwendig, arbeiten zu gehen, weil das Haushaltsbudget der Familie dies erforderlich machte. Andere haben damit das Familieneinkommen erhöht, um sich mehr leisten zu können. Aber für die übergroße Mehrheit der Frauen gehörte berufliche Tätigkeit einfach zu ihrer Selbstverwirklichung. Es machte sie ökonomisch unabhängig vom Mann. Ein unerfüllter Wunsch der Frauenbewegung in der kapitalistischen Gesellschaft. Daher spielte die Interessenvertretung der Frauen in den Unternehmen eine herausragende Rolle. Nicht von ungefähr betonte Ulbricht die Verantwortung der 1952 gegründeten Frauenausschüsse in den Betrieben, Genossenschaften und Einrichtungen. Ihr Entstehen entsprang einer Empfehlung des Politbüros. »Die Zugehörigkeit zu diesem Ausschuss ist unabhängig von der Mitgliedschaft in politischen und sonstigen Organisationen.«[Anmerkung 190] Es ist verbrieft, dass Ulbricht auf einer Frauenkonferenz zum 4. Jahrestag der Frauenausschüsse 1956 in den Buna Werken selbst an der Diskussion teilnahm. Frauenpolitik, Frauenförderung waren für Ulbricht nie Mittel zum Zweck. Immer ging es um die Selbstverwirklichung der Frau, ihre Persönlichkeitsbildung, um Gleichberechtigung. Und das erforderte, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Es war uns stets bewusst, dass werktätige Frauen mit Familien täglich im Haushalt ihre »zweite Schicht« zu absolvieren hatten. Von praktischer Bedeutung war für sie daher, mit welch realen Maßnahmen der Kampf gegen ideologische Barrieren einherging. Aus dem großen Paket der schrittweise verwirklichten Maßnahmen, die es den Frauen ermöglichten oder erleichterten, Beruf und Familie in Einklang zu bringen, ragte das umfangreiche Programm der Kindertagesstätten heraus. 1989 standen für 80 Prozent der Kinder im krippenfähigen Alter und für 95 Prozent derer im Kindergartenalter Plätze zur Verfügung. Die Kinder wurden von medizinisch und pädagogisch ausgebildeten Kräften betreut. Es ging um mehr als die »Aufbewahrung« während der Arbeitszeit der Eltern. Hier wurden die Bemühungen von Mutter und Vater um die Vorbereitung ihrer Kinder auf das Leben liebevoll und fachkundig unterstützt. In der größer gewordenen Bundesrepublik ist aktuell viel die Rede davon, dass Voraussetzungen geschaffen werden müssen, damit die Frauen Beruf (»die Karriere«) und Familie gleichzeitig verkraften. Da ist sicher viel gute Absicht im Spiel. Das Betreuungsgeld allerdings ist eine Lachnummer. Bei der Erweiterung des Kita-Netzes hört man oft, im Osten gäbe es traditionell mehr Kindertagesstätten. Wenn die sozialistische Tradition der DDR bei der Kinderbetreuung gemeint ist, kann ich gut damit leben. Es muss hier auch angemerkt werden, dass die umfangreichen sozialpolitischen Maßnahmen, mit denen Erich Honecker den Kurs der Erleichterung der Lebensbedingungen der Frauen fortsetzte, von diesen sehr geschätzt wurden, auch wenn fehlende Mittel in den 80er Jahren zu einer gewissen Stagnation führten. Alljährlich war der Internationale Frauentag ein wichtiger Anlass für mich, in direkten Kontakt zu Walter Ulbricht zu treten. Im Gegensatz zu heute oft vertretenen Auffassungen waren wir nicht an einmaligen Feierstunden mit Kaffee servierenden Männern interessiert. Der 8. März blieb für uns ein Kampftag, wie ihn 1910 in Kopenhagen Clara Zetkin initiiert hatte. Weltweit war für die Frauen viel zu tun, damit sie durch Arbeit nicht nur ökonomisch unabhängig vom Mann werden, sondern sich selbst als kreative Menschen verwirklichen konnten. Natürlich waren wir nicht blauäugig und bemerkten sehr wohl, dass manche Leiter es sich einfach machten und die Frauentagsfeier als Feigenblatt für unterlassene Förderung der Frauen und ihr vorhandenes Unverständnis für deren Probleme benutzten. Auch und gerade deshalb gab es jedes Jahr einen Aufruf von Partei und Regierung zum Internationalen Frauentag. Dieser enthielt regelmäßig eine kritische Bilanz und die Aufforderung zur Lösung der jeweils aktuellen Aufgaben. So wurde es den Verantwortlichen erschwert, das von manchen ungeliebte Thema der Frauenförderung in Vergessenheit geraten zu lassen. Dem Anlass angemessen wurde die internationale Solidarität mit den Frauen der Welt hervorgehoben, besonders mit denen, die unter Krieg, Verfolgung, brutaler Ausbeutung und wirtschaftlicher Rückständigkeit zu leiden hatten. Ulbricht hielt uns stets zum Blick über den nationalen Tellerrand an. Solidarität wurde bei den Frauen der DDR mit großen Buchstaben geschrieben, und ihre internationalistische Hilfe war in aller Welt hoch geschätzt. Der Demokratische Frauenbund (DFD) war allseits geachtetes Mitglied in der internationalen Frauenförderation (IDFF), die ihren Sitz in der Hauptstadt der DDR hatte. Ich greife jetzt etwas vor in Ereignisse, die schon nach dem Ableben Walter Ulbrichts lagen, aber unverkennbar Resultat der von ihm begründeten Frauenpolitik der SED und der DDR waren. Das Jahr 1975 war durch die UNO zum Internationalen Jahr der Frau proklamiert worden, wodurch vielfältige Aktivitäten in unterschiedlichen Ländern ausgelöst wurden. Die Weltorganisation der Staaten und Völker brachte damit zum Ausdruck, dass die Stellung der Frau im Leben einer konkreten Gesellschaft dringend veränderungsbedürftig war. Das verstärkte in erheblichem Maße die Arbeit der Frauenorganisationen. Es kann gut und gerne als eine besondere Wertschätzung des DFD bezeichnet werden, dass der Weltkongress im internationalen Jahr der Frau vom 20. bis 24. Oktober 1975 unter dem Motto »Gleichberechtigung – Entwicklung Frauen« in Berlin durchgeführt wurde. Es war auch Walter Ulbricht, der die Tradition begründete, am 8. März jeden Jahres mehrere hundert der tüchtigsten Frauen aus allen Bezirken und allen gesellschaftlichen Bereichen nach Berlin zu einer festlichen Zusammenkunft einzuladen. Das war keine Showveranstaltung. Für die teilnehmenden Frauen war es eine Würdigung ihrer Leistungen, und sie wussten dies zu schätzen. Vor allem aber waren sie ein Weckruf zur weiteren Realisierung der Frauenpolitik. In den Reden des Staatsoberhauptes wurde ihnen nicht geschmeichelt, sondern der Rücken gestärkt für ihr Engagement bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Eine sehr diffizile Aufgabe, an der die Frauenkommission zu arbeiten hatte, war die Selbstbestimmung der Frau über ihren Körper. Mir persönlich war in guter Erinnerung, dass ich gemeinsam mit meiner Mutter meine Großmutter im Gefängnis besucht hatte, die dort mehrere Jahre einsaß. Warum? Sie hatte in einigen Fällen jungen Frauen, vor allem Arbeiterfrauen, geholfen, unerwünschte Schwangerschaften nicht austragen zu müssen. Das war natürlich strafbar. Irgendwann wurde sie denunziert und musste dafür schwer büßen. Junge Frauen in Not hatten eine Helferin weniger. Selbstverständlich war dies keine Lösung des Problems, denn viele Frauen starben an den Folgen unprofessioneller Hilfe oder erlitten gesundheitliche Schäden. An dem Problem haben wir auch in der DDR lange gearbeitet. Es begann unter Ulbricht und wurde in Gesetzesform gegossen, als Erich Honecker schon Erster Sekretär des ZK der SED war. Das »Gesetz zur Regelung des Schwangerschaftsabbruches« wurde von der Volkskammer der DDR am 9. März 1972 verabschiedet. Aus Glaubensgründen hatten sich 14 Abgeordnete der CDU-Fraktion dagegen entschieden, acht enthielten sich der Stimme. Erstmals in der Rechtsgeschichte wurde für den Schwangerschaftsabbruch eine Fristenregelung eingeführt. Den Medizinern wurde Aufklärungs- und Beratungspflicht auferlegt, nicht nur den Abbruch, sondern auch die Schwangerschaftsverhütung betreffend. Aufklärung und Behandlung waren kostenlos. Das Bemerkenswerte an diesem Gesetz war aber etwas anderes. Die Entscheidung der Frau für einen Abbruch der Schwangerschaft in einer Frist von zwölf Wochen nach der Befruchtung wurde als ein Recht der Frau anerkannt. Das ist wohl bis heute ein Novum in der Rechtsprechung. Nur in Dänemark wurde ein Jahr später eine ähnliche Formulierung in die entsprechenden gesetzlichen Regelungen aufgenommen. Leider fiel auch dieses Gesetz dem Einigungsvertrag zum Opfer, sogar gegen die Stimmen von Christdemokraten und Liberalen in der letzten Volkskammer der DDR. Gleichwohl muss man sagen, dass es seine Wirkung auf die Rechtsprechung der BRD in gewissen Grenzen entfalten konnte. Den § 218 StGB der Bundesrepublik Deutschland gäbe es in seiner heutigen Fassung nicht ohne die gesetzlichen Regelungen in der DDR. So kann ich mit einiger Genugtuung feststellen, dass wenigstens in Teilen die Frauen der alten Bundesrepublik von einer wichtigen Erfahrung der DDR partizipieren konnten. Ein seltener Fall allerdings. Ich würde nicht die Wahrheit schreiben, wenn ich behauptete, die Arbeit mit Walter Ulbricht wäre gänzlich problemlos gewesen. Entscheidend aber ist, dass sein Wirken auch für das Wohl der Frauen unverkennbar Früchte trug. Je mehr Zeit ins Land geht, um so mehr spüren in der DDR sozialisierte Frauen, was sie verloren haben. Ich spreche mit vielen von ihnen. Selbst jene, die kritische Bemerkungen an der DDR nicht verhehlen, wünschen sich viele Errungenschaften zurück, die das Leben der Frauen leichter und sozial sicher machten: Vollbeschäftigung, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Rente mit 60, monatlicher Haushaltstag, Ganztagsschulen, Betriebskindergärten, Kinderferienlager und vieles mehr.
Gisela Glende: Lotte war Walters Mitarbeiterin, er aber war der Chef
Gisela Glende, geborene Trautzsch, Jahrgang 1925, Lehre als kaufmännische Angestellte, 1945 KPD,von 1945 bis 1948 tätig in der der SED-Kreisleitung Marienberg, in den 50er Jahren Fernstudium an der Parteihochschule »Karl Marx« und Abschluss als Diplomgesellschaftswissenschaftlerin. Von 1951 bis 1968 stellvertretende Büroleiterin und danach, bis 1986, Leiterin des Büros des Politbüros des Zentralkomitees der SED. Von 1971 bis 1986 Mitglied des ZK, von 1986 bis 1989 Mitglied der Zentralen Revisionskommission der SED. Du kommst aus einem kommunistischen Elternhaus, dein Onkel Walter Trautzsch nahm 1923 am Hamburger Aufstand teil und war ab 1933 Kurier der Auslandsleitung der KPD, der die Verbindung über Rosa Thälmann zum inhaftierten Parteivorsitzenden hielt. Onkel Walter ist, worüber er nie gesprochen hat, 1935 aus einem Krankenhaus getürmt, und meine Mutter– Vater war bereits inhaftiert – hat ihn bei uns daheim in Lengefeld im Erzgebirge versteckt. Ich bin, soll das heißen, bereits als Kind zur Verschwiegenheit erzogen worden … Onkel Walter flüchtete über die Grenze in die Tschechoslowakei und weiter in die Sowjetunion, wo er im September 1935 an der »Brüsseler Parteikonferenz« teilnahm. Die Nazis hatten ihn bereits am 3. März 1933 als einen der ersten »Schutzhäftlinge« eingesperrt. Zwischen 1936 und 1939 pendelte er als Thälmann-Kurier zwischen Paris, Prag, Berlin und Hamburg als »Edwin«. 18 Mal reiste er alle vier bis sechs Wochen illegal nach Deutschland ein. Beim 19. Mal wurde er beim Grenzübertritt in Aachen festgenommen. Um zu verhindern, dass die Gestapo mitbekam, dass er der Kurier zwischen der KP-Führung und Thälmann war, ließ er sich auf deren Angebot ein, als Spitzel in Frankreich zu arbeiten. Darüber informierte er sofort nach seiner Rückkehr die Parteileitung in Paris. Allerdings gingen seine ausführliche Stellungnahme und andere Papiere während des Krieges verloren, weshalb Walter später erhobene Vorwürfe, er sei ein Verräter und Doppelagent gewesen, nie widerlegen konnte. Nach der Überprüfung durch die Zentrale Parteikontrollkommission wurde er 1954 aus dem Parteiapparat entfernt. Er arbeitete dann als Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft und als Fahrstuhlführer und wurde 1959 invalidisiert. 1964 erhielt er den Vaterländischen Verdienstorden und damit seine Rehabilitierung. Spät, aber nicht zu spät. Und einer der Kontaktpartner deines Onkels in der Auslandsleitung der KP war Walter Ulbricht. Darüber hat er mit mir nicht gesprochen. Wer? Walter Ulbricht oder dein Onkel Walter? Beide nicht. Da machten sie aber keine Ausnahme. Die meisten, die ich nach 1945 kennenlernte und die im KZ oder im Zuchthaus oder in einem sowjetischen Lager waren, haben darüber geschwiegen. Rudi Thunig[Anmerkung 191] war der erste Leiter des Büros, dann kam Otto Schön,[Anmerkung 192] dem ich in dieser Funktion nachfolgte: Keiner von ihnen hat jemals ein Wort über die illegale Arbeit und die Nazihaft mir gegenüber verloren. Erich Honecker hat mir einmal gesagt, auch Walter Ulbricht und Wilhelm Pieck hätten mit ihm nie über die Moskauer Jahre gesprochen. Als ich 1951 im Büro des Sekretariats angefangen habe, schwirrten die Verdächtigungen durch die Partei. Diese Noel-Field-Affäre[Anmerkung 193] warf ihre Schatten bis nach Berlin. Das wird wohl auch einer der Gründe gewesen sein: Man schwieg über die Vergangenheit, um sich nicht zu belasten. Man konnte ja nicht wissen, ob einem nicht diese oder jene Bekanntschaft zum Verhängnis werden konnte. Ich denke aber auch, dass die zwölf Jahre Illegalität sie dazu gezwungen haben, nur das Nötigste zu sagen, was eben für die Arbeit notwendig war. Manche Genossen hat das für ihr Leben geprägt, und sie haben diese Eigenschaft nie mehr abgelegt. Aber zurück zu Walter Ulbricht. Wann bist du ihm zum ersten Mal begegnet? Am 3. Januar 1951. Ich meldete mich auftragsgemäß im Büro des Sekretariats. Das war aber der Geburtstag von Wilhelm Pieck, des Parteivorsitzenden, alles wirbelte durcheinander, und man nahm an, ich käme zum Gratulieren. Nein, sagte ich, ich soll hier arbeiten. Dann holte mich Rudi Thunig rein, der mich gleich zu Otto Schön brachte, und der meinte, wir müssten zunächst zu Walter Ulbricht gehen. Da habe ich einen Schreck bekommen: Was, zum Generalsekretär? Ulbricht stellte mir einige Fragen, sagte dann aber, meine Unterlagen seien noch nicht da, ich solle erst einmal wieder nach Hause fahren. Ich bekäme Bescheid. Dann aber schien ihm diese Absage ein wenig hart, denn er fragte: Wo kommst du eigentlich her? Ich sagte: aus der Chemitzer Gegend. O, sagte er darauf, ich glaube, zur Geburtstagsfeier heute Abend in Schloss Niederschönhausen sind bestimmt auch einige Genossen von der Wismut geladen. Otto Schön soll mit dir dorthin fahren und fragen, ob die noch Platz im Auto haben. Das heißt, du warst 1951 auf der Geburtstagsfeier von Präsident Wilhelm Pieck in dessen Residenz? Ja. Neben mir am Tisch saß einer, der mich fragte, wer ich sei. Ich werde hier arbeiten, sagte ich. Worauf er mit der Bemerkung reagierte, er sei für Wohnungsfragen zuständig, da würden wir uns bestimmt wiedersehen. Das war natürlich der Fall. – Vier Wochen später kriegte ich Bescheid. Seit 1949 gab es das Politbüro des Parteivorstandes, seit 1950 das Politbüro des ZK der SED. 1951 wurdest du schon stellvertretende Leiterin des Büros des Politbüros. Welche Aufgaben hattest du? Im Sekretariat protokollierte Edith Baumann[Anmerkung 194] die Sitzungen, sie war von Haus aus Sekretärin und nun aber auch politischer Sekretär. Man war der Auffassung, dass beides nicht gehe. Also übernahm ich ihre Aufgabe: die technische Vorbereitung der Sitzungen, das Ausfertigen der Protokolle und deren Verteilung und so weiter. Edith hat mir alles erklärt, was ich zu tun habe. An den Sitzungen des Sekretariats selbst nahm ich zunächst nicht teil. Jeweils einer der Sekretäre diktierte mir im Anschluss die Mitschriften. Aber schon bald nahm ich an den Sitzungen teil und habe selber mitgeschrieben. Wie sahen die Zusammenkünfte aus? Saßen vorn Pieck, Grotewohl und Ulbricht? Nein, die Sitzungen des Sekretariats fanden im Arbeitszimmer von Walter Ulbricht statt. Der saß an seinem Schreibtisch, und links und rechts am Tisch davor nahmen die Sekretäre Platz: Franz Dahlem, Fred Oelßner, Otto Schön, Paul Verner, Edith Baumann, Paul Wandel, Willi Stoph … Zweimal in der Woche tagte das Sekretariat bei ihm. Daran nahmen Politbüromitglieder nicht teil? Falls sie nicht auch Sekretäre des ZK waren, nein. Und wo tagte das Politbüro? Im Arbeitszimmer von Wilhelm Pieck. Dort saßen links Pieck und Grotewohl und rechts Ulbricht. Ich schrieb an einem Tischchen in der Ecke. Und wer hat die Sitzungen geleitet? Pieck. Und wenn dieser nicht da war, leitete Grotewohl. Selten Ulbricht. Das Politbüro kam einmal in der Woche zusammen. Aber nachdem sich die Strukturen der DDR entwickelten Pieck war Präsident, Grotewohl Ministerpräsident, sie hatten viele Verpflichtungen –, übernahm Ulbricht immer häufiger. Die Zusammenkünfte waren dann kürzer. Die Sekretariatssitzungen hingegen dauerten in der Regel lange. Die Sitzungen begannen 16 Uhr. Erst informierte Ulbricht über aktuelle Fragen, dann wurden die vorgegebenen Tagesordnungspunkte abgehandelt, d. h. es wurde dazu diskutiert. Dir muss ich es nicht erklären, aber zum besseren Verständnis der Nachgeboren will ich noch kurz sagen, worin der Unterschied bestand: Das Sekretariat war ein operatives Arbeitsgremium, die einzelnen Sekretäre waren für bestimmte Bereiche zuständig. Du warst ja später, wenn ich mich richtig erinnere, für Jugend, Sport, Staat und Recht und Sicherheitsfragen verantwortlich. Das Politbüro hingegen war das kollektive politische Führungszentrum, das sich insbesondere mit strategischen Fragen beschäftigte. Aufgrund häufiger Personalunion verschwanden aber in der Außenwahrnehmung zwangsläufig die Grenzen zwischen Sekretariat und Politbüro. Im Archiv liegen zwei Formen der Protokolle – es gibt sie als Rohfassung und als Reinschrift. Aber es existieren keine Wortprotokolle. Warum nicht? Auch darin folgte man dem Vorbild der KPdSU. Manch grundsätzliche Ausführung, die Walter Ulbricht wichtig war, wurde ausformuliert, aufgenommen und auch von der »Allgemeinen Abteilung« ins Russische übertragen. Dieser Text ging nach Karlshorst. Zumindest in den 50er Jahren. Es heißt, bis 1955 habe Semjonow an den Sitzungen des Politbüros teilgenommen. Manchmal ja. Regelmäßig aber nur an den Tagungen des Parteivorstandes. Leider gibt es keine Wortprotokolle. So ist nicht überliefert, welchen Meinungsstreit es in den Führungsgremien der Partei gegeben hat, wie diskutiert wurde, wer was warum wie gesagt hatte und so weiter. Für das Verständnis der Politik der Partei wäre das außerordentlich wichtig gewesen, insbesondere für die Nachwelt. Und außerdem wäre weniger Raum für Spekulationen gewesen. Ich fand es nicht bedauerlich. Weil es weniger Arbeit für dich bedeutete? Nein. Als ich zum ersten Mal nach 1990 zum Verhör zur Staatsanwaltschaft musste und die ganzen Aktenordner dort stehen sah, dachte ich: Bloß gut, dass ich nicht alles aufgeschrieben habe und sie mich nun nach jedem Detail fragen könnten. Aber du hast schon recht: Die sogenannten Aufarbeiter, die keine Ahnung von uns und unserer Geschichte haben, interpretieren alles Mögliche in diese Protokolle hinein, nur nicht das, wie es wirklich war. Manche nehmen die den Protokollen beigefügten Politbürovorlagen gleichsam als Gesetz, ohne zu überprüfen, wie dann der Beschluss am Ende, nach der Diskussion, aussah. Manche Vorlage fiel auch durch, wurde nicht angenommen. Ich habe es den Vernehmern versucht zu erklären und merkte gleich: Das interessierte sie überhaupt nicht. Sie wollten nur Belastendes, nichts Entlastendes. Sie können sich einfach nicht vorstellen, dass in den politischen Führungsgremien der DDR auch heftig diskutiert wurde. Sie wollen es sich auch nicht vorstellen. Denn das passt nicht in ihr Bild von der Diktatur. In ihrer Vorstellung hat immer nur einer geredet und alle anderen haben nur genickt. Das ist nicht wahr. Ich habe heftige Diskussionen erlebt, harte Auseinandersetzungen, bei denen die Fetzen flogen. Wilhelm Pieck konnte richtig laut werden. Das glaubt man kaum, weil das Bild in der Öffentlichkeit das eines grundgütigen, väterlichen Mannes war. Das war er natürlich auch. Aber er konnte in politischen Debatten auch ziemlich heftig werden. Es heißt doch, Pieck sei der Ausgleichende gewesen, während Ulbricht zuspitzte. Wilhelm konnte sehr wohl mit der Faust auf den Tisch hauen. Der hat sich auch vom Walter nicht die Wurst vom Brot nehmen lassen. Wie war das Verhältnis zwischen Pieck, Grotewohl und Ulbricht? Es war wirklich freundschaftlich. Sie waren nicht nur politisch, sondern auch menschlich eng verbunden. Ulbricht, wird nachgetragen, konnte grob sein, insbesondere zu seinen Mitarbeitern. Das ist Unsinn. Als ich kam, war Lotte Kühn seine persönliche Mitarbeiterin. Vor ihr hatte man im Hause sogar mehr Respekt als vor ihm. Sie war in manchen Dingen ja wirklich streng und resolut. Er war zugänglicher, offenherziger. Ulbricht hatte noch eine zweite persönliche Mitarbeiterin, Gustel Zörnig, eine sehr nette Kollegin mit jüdischem Hintergrund, die uns später verließ. Die Gründe sind mir nicht bekannt. Und er hatte noch eine Sekretärin, die Anni Herbold, das war eine Wienerin, die mit ihm aus Moskau gekommen war. Von denen hat man dergleichen nicht vernommen. Kannst du dich noch erinnern, wie die Stimmung im Politbüro nach Stalins Tod 1953 und nach dem XX. Parteitag 1956 war? Nach Stalins Tod wurde nicht groß diskutiert. Es war eine Tatsache, auf die man vorbereitet war. Kein Zeichen von tiefer Bestürzung und großer Trauer. Anders nach dem XX. Parteitag. Ich hatte den Eindruck, dass man etwas enttäuscht war. Man hatte mehr erwartet: tiefere Analysen, gründlichere Untersuchungen gesellschaftlicher Zusammenhänge. Chruschtschow schrieb nun alles Stalin und dem Personenkult zu, und damit hatte es sich. Die Genossen, die in den 30er, 40er Jahren in Moskau lebten, wussten doch, was sich dort zugetragen hatte. In meiner Abteilung arbeitete Mia Niederkirchner,[Anmerkung 195] die war in den 30er Jahren als Staatenlose aus Deutschland ausgewiesen worden und nach Moskau gegangen. Sie sprach auch nur in Andeutungen, was damals in der Sowjetunion geschah. Also mir schien, dass unsere Genossen sich mehr erwartet hatten als nur die Schuldzuweisung an Stalins Adresse. 1953 soll es im Politbüro Auseinandersetzungen gegeben haben, ob Walter geht oder in der Funktion bleibt. Hermann Matern und Erich Honecker, so hat es mir jedenfalls Erich erzählt, hätten für Walter Ulbricht gekämpft und sich durchgesetzt. Hast du davon etwas bemerkt? Da saß ich im Vorzimmer und habe nur Wortfetzen gehört. Bei dieser Sitzung war, wenn ich mich richtig erinnere, auch Semjonow dabei. Plötzlich kam Fred Oelßner zu mir, sagte, hol mal schnell eine Schreibmaschine. Er hatte ein Blatt mit russischer Schrift. Er diktierte mir seine Übersetzung. Das waren Vorschläge der KPdSU. Wie ich hörte, hatte man unserer Delegation in Moskau mitgeteilt, dass der Aufbau des Sozialismus ein Fehler gewesen sein soll. Das war die Berija-Linie, die einige Monate später wieder korrigiert wurde. Ich machte so viele Durchschläge wie möglich. Die hat dann Fred im Politbüro verteilt. Der von dir getippte Text lag dann in der in Leder gebundenen Mappe, die Honecker im Februar 1989 den Politbüromitgliedern zur Information gab. Da stand nur drauf: »Dokumente«. Zuoberst lag dieser Beschluss der KPdSU vom Juni 1953. Die Moskauer Führung hatte am 3. und 4. Juni Ulbricht, Grotewohl und Oelßner (Pieck konnte nicht teilnehmen, weil er krank war) einbestellt, um ihnen zu sagen, was die deutschen Genossen alles falsch gemacht hätten. Vergessen war plötzlich, dass das Politbüro des ZK der KPdSU noch unter Stalins Leitung am 8. Juli 1952 den Aufbau des Sozialismus in der DDR bestätigt hatte, der anschließend auf der 2. Parteikonferenz in Berlin beschlossen worden war. Die Moskauer Beratung vom 3./4. Juni hat im SED-Politbüro zu heftigen Reaktion geführt. Das habe ich gehört. Die Sitzung fand auch nicht wie sonst im Zimmer von Wilhelm Pieck statt, sondern unten im Saal, und ich saß wieder im Vorraum. Diese Sitzung ging sehr lang. 1953 wurden Zaisser und Herrnstadt[Anmerkung 196] aus dem Politbüro entfernt. Was waren das nach deiner Wahrnehmung für Menschen? Sie hatten nach meiner Beobachtung keinen großen Einfluss. Walter Ulbricht hat Zaisser wiederholt gegenüber Dritten verteidigt wegen seiner Verdienste im Kampf gegen die Nazis, oder er sagte: Der hat während des Kapp-Putsches 1920 die Rote Ruhrarmee kommandiert und war Ende der 20er Jahre Militärberater der Kuomintang in der Mandschurei, das ist ein Haudegen. Aber Zaisser hatte, wie ich fand, eine unangenehme, herablassende Art. Man kam sich bei ihm immer sehr klein vor. Dieses Gefühl stellte sich bei Walter Ulbricht nie ein: Mit dem sprach man auf gleicher Augenhöhe. Und Herrnstadt? In der Partei war er kaum bekannt. Und wenn ich mit ihm sprach, glaubte ich, das zwischen uns eine Wand stand. Das war eine unüberbrückbare Distanz, vielleicht auch Dünkel, Anflüge von Arroganz, fast Selbstherrlichkeit. Das erlebte ich später verstärkt auch bei Schirdewan, er hatte sich, wie frühere Vertraute mir sagten, in den 50er Jahren sehr zu seinem Nachteil verändert. Wo warst du am 17. Juni 1953? Wir arbeiten noch im alten Haus an der Prenzlauer Allee. Es wurde gerade renoviert. Und am Eingang saß der Betriebsschutz, nicht wie später die Genossen von der Sicherheit. Aber bei uns blieb alles ruhig, das meiste spielte sich ja auf dem Potsdamer Platz, vorm Haus der Ministerien, ab. Wir haben prophylaktisch die Schränke vor die Glastüren am Eingang geschoben. Es passierte jedoch nichts. Dann kamen auch schon die sowjetischen Soldaten. Wer waren Ulbrichts wichtigste Mitarbeiter im ZK? Wolfgang Berger, der war für ökonomische Fragen zuständig. Ein kluger Kopf. Er genoss hohe Autorität im Hause. Und Richard Herber,[Anmerkung 197] der langjährige Parteisekretär des ZK Apparates. Du hast mit Walter Ulbricht die Tagesordnung fürs Politbüro gemacht? Ja. Er hat vorgegeben und dann gesagt: Sprich dazu mit dem und dem, besorge noch dazu dieses Papier, na, also die ganzen technische und personellen Vorbereitungen der Sitzung. Hat er dich gerufen, gab es feste Termine? Nein, in der Regel rief ich ihn an und fragte, ob ich kommen könne. Dann hat er, sofern es um die Politbürositzung ging, die Tagesordnung bestätigt. Und bevor das Protokoll der vorigen Sitzung im Politbüro verlesen wurde, hat er es sich natürlich ebenfalls angesehen und bestätigt. Er war dabei nicht kleinkariert oder gar pingelig. Das erklärt ja auch, dass die Reinschrift nur selten von der Rohfassung abweicht, d. h. er bestätigte im Wesentlichen, was ich protokolliert hatte. Und dann gab es noch die Anlagen zum Beschlussprotokoll. Die Sekretariatssitzungen übernahm, nachdem Ulbricht 1960 Staatsratsvorsitzender geworden war, Erich Honecker. Aber die Politbürositzungen leitete er selbst. Ja. Und ziemlich konzentriert und straff, auch wenn er Diskussionen zuließ und keineswegs unterband. Alfred Neumann und Kurt Hager waren sehr diskutierfreudig. Die Sitzung fing um 10 Uhr an und dauerte zwei, drei Stunden. Selten, das unterbrochen wurde, um eine Mittagspause zu machen. Hat er Kritik an sich abprallen lassen, war er nachtragend? Ich brauchte ihn nicht zu kritisiert. Er war auch nicht nachtragend. In der Dokumentenmappe, die ich bereits erwähnte, war auch ein Papier von Günter Mittag über die ökonomischen Fehler Ulbrichts. Dieser warf Ulbricht vor, er habe anfänglich Dubcek unterstützt und ihn dafür gelobt, dass dieser alle Dogmatiker aus dem Politbüro der KPTsch rausgeworfen habe. Kannst du dich an so etwas erinnern? Ob Ulbricht so etwas gesagt hat, weiß ich nicht mehr. Aber dass er die Reformbestrebungen in der Tschechoslowakei zunächst mit Sympathie, dann aber zunehmend kritisch begleitete, war doch auch verständlich. Das sowjetische Gesellschaftsmodell musste reformiert werden. Wir hatten dazu das NÖS. Die tschechoslowakischen Genossen hatten das »Manifest der 2000 Worte«, aber kein ordentliches Konzept und wollten alles radikal umgestalten, wobei ihnen die politische Führung entglitt. Das lief aus dem Ruder. Der Westen hat das ausgenutzt, um die CSSR aus dem Bündnis zu brechen. Ulbricht hat wiederholt mit Dubcek darüber diskutiert. Um das Reformkonzept der DDR zu sichern, hat er versucht, ihn zu beeinflussen, ihn zur Besonnenheit zu mahnen. Als alles nicht half, entschieden die Führungen europäischer sozialistischer Staaten die militärische Aktion, an der aber die DDR nicht teilnahm. Das hatte Walter Ulbricht im Gespräch mit Breshnew erreicht. Welchen Platz in der Geschichte würdest du Ulbricht zuweisen? Walter Ulbricht hat in einer schwierigen Zeit etwas vollbracht, was kaum ein Zweiter hätte bewältigen können. Er hat den kleineren, schwächeren Teil Deutschlands in zwanzig Jahren zu einem Staat geformt, der auf vielen Feldern anderen Gesellschaften einen historischen Schritt voraus war. Natürlich, er hat das nicht allein bewerkstelligt, sondern Millionen Menschen waren an diesem Aufbauwerk beteiligt. Aber er war der Stratege und der Organisator, er vermochte die Partei und über sie auch die Massen zu mobilisieren und zu inspirieren. Selbstverständlich machte er auch Fehler. Nur wer nichts unternimmt, kann keine Fehler begehen. Hat sich Walter Ulbricht von seinen Mitarbeiter, also auch von dir, verabschiedet, als er 1971 gehen musste? Nein. Er war ja für uns auch nicht völlig aus der Welt. Ich traf ihn danach wiederholt in Dölln und an anderen Orten. Er wurde damals auch ein wenig unleidlich. Selbst bei Lotte hat er dann manchmal gestichelt. Nach seinem Tod habe ich sie offiziell weiter betreut. Einmal war sie bei Erich Honecker, da bat er mich hinzu. Das passte ihr nicht. »Muss denn Gisela mit dabei sein?« Darauf sagte er: »Sie muss doch wissen, was du hast.« Da schluckte sie merklich. War das denn so privatim, was sie von ihm wollte? Ach wo. Es ging um die von ihr als Zurücksetzung empfundene protokollarische Herabstufung, weil sie ja nun die Witwe des Staatsratsvorsitzenden und nicht mehr wie heißt das heute? – First Lady war. Du bist 1986 in Rente gegangen, aus dem Parteiapparat ausgeschieden. Bist du auch irgendwann aus der Partei ausgetreten? Nein. Ich glaube, die haben mich nach 1989 nicht gewollt. Nach der Umbenennung zur PDS kam keiner mehr zu mir. Aber die Polizei und die Staatsanwaltschaft kamen? Es gab 1991 eine Hausdurchsuchung. Und ich wurde mehrmals vorgeladen zur Zeugenvernehmung. Im Prozess gegen dich war ich, wie du weißt, ebenfalls als Zeugin, es ging um die Grenze, um die Politbüroprotokolle und darum, was ich ihnen versuchte begreiflich zu machen, dass es auch Dinge gab, die überhaupt nicht dokumentiert wurden. Es gab zum Beispiel Umlaufvorlagen mit sensiblen Papieren, die nicht protokolliert wurden. Also wenn beispielsweise Helmut Schmidt an Honecker geschrieben hatte, dann nahmen die Politbüromitglieder den Inhalt des Schreibens zur Kenntnis, aber der Brief wurde nicht ins Protokoll genommen. Oder Aktennotizen von vertraulichen Gesprächen mit Bonner Ministern. Der Chef schrieb darauf »Umlauf Politbüro«, das Papier wurde gelesen und still zu den Akten genommen. Das verstanden die im Gericht aber nicht. Sie konnten doch froh sein, dass das nicht ins Protokoll gekommen war: Manche ihrer Politiker, die nach 1990 kein gutes Haar an Honecker und der DDR ließen, hätten sich in Grund und Boden schämen müssen, wenn publik geworden wäre, was sie Honecker damals Schmeichelhaftes geschrieben hatten. Das haben wir ihnen erspart. Gisela, du warst eine gute Zeugin in meinem Verfahren. Warum? Weil du trotz eines gewaltigen Drucks auf dich die Wahrheit gesagt hast. Du hast dich nicht einschüchtern lassen wie manch anderer, der Angst vor der Bestrafung durch die Justiz hatte. Du warst selbstbewusst und tapfer. Ich habe geweint. Wenn ich große Ungerechtigkeit empfinde, fühle ich mich hilflos und fange an zu heulen. Das passierte mir nach 1990 häufiger als in den vierzig Jahren davor.
Solveig Leo: »Held der Arbeit« in der DDR, in der BRD das Bundesverdienstkreuz
Solveig Leo, Jahrgang 1943, Lehre als Landwirt im VEG Ludwigshof in Thüringen, danach, von 1961 bis 1964, Besuch der Landwirtschaftlichen Fachschule in Weimar. LPG Vorsitzende in Banzkow seit 1968, 1969 Auszeichnung als »Held der Arbeit« (u. a. mit Margot Honecker), von 1992 bis 2009 Bürgermeisterin in Banzkow in Mecklenburg-Vorpommern. 2007 wurde Banzkow im Landeswettbewerb »Unser Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll schöner werden« Sieger. Beim Bundeswettbewerb, an dem 3.625 Gemeinden teilnahmen, errang Banzkow eine der acht Goldmedaillen, die Bundeslandwirtschaftsminister Horst Seehofer auf der Grünen Woche in Berlin an die Bürgermeisterin Solveig Leo überreichte. Solveig Leo ist seit 2011 Trägerin des Landesverdienstordens von Mecklenburg-Vorpommern und des Bundesverdienstkreuzes, das sie 2001 verliehen bekam. Als Kind hatte ich nur einen Berufswunsch – ich wollte Landwirt werden. Meine Eltern waren darüber nicht sonderlich begeistert, aber ich ließ mich nicht davon abbringen. Zum Abschluss des Studiums an der Fachschule in Weimar wurde eine kleine Gruppe von Studenten des letzten Semesters vom Weimar-Werk nach Markkleeberg zur agra geschickt, um dort einerseits die Exponate des Landmaschinenproduzenten zu erklären und andererseits Kundenforschung zu betreiben. Wir waren stolz, dass wir von den Besuchern ernst genommen wurden, aber wir trugen ja auch die weißen Kittel der Werksvertreter mit dem Emblem des Betriebes. Höhepunkt unseres dreiwöchigen Einsatzes war der Besuch von Walter Ulbricht an unseren und weiteren Ständen auf dem Maschinengelände. Neu war damals die Präsentation von kompletten Maschinensystemen, bei uns eben Technik von der Kartoffelpflanzung bis hin zur Aufbereitung in Lagerhallen einschließlich Kartoffelwäsche. Walter Ulbricht kam eine halbe Stunde früher von der Präsentation eines anderen Betriebes. Bei uns lief alles problemlos, Walter Ulbricht fragte gezielt, besonders interessierte ihn, wann die vorgestellten Neuentwicklungen in die landwirtschaftliche Praxis eingeführt werden sollten. Nach Besichtigung und der sehr angeregten Diskussion an den Maschinen verabschiedete er sich. »Gut, gut, das Weimar-Werk hat gute Arbeit geleistet.« Alle waren natürlich sehr erleichtert und auch stolz, am meisten natürlich wir Studenten, obwohl unser Beitrag an der Entwicklung dieser Maschinen Null war. Dieses mehrwöchige Praktikum auf der agra sollte Folgen für mich haben. Wiederholt war an unserem Stand der Vorsitzende der LPG »Clara Zetkin« aus Banzkow im Bezirk Schwerin erschienen. Er suchte junge Kader für seine Genossenschaft und schwärmte von den Perspektiven, die unsereinen dort erwarteten. Allerdings hatten wir bereits unsere Absolventenverträge in der Tasche, die unseren Einsatz in Thüringen vorsahen. Dennoch folgten zwei seiner Einladung. Wir sahen uns drei Tage in Banzkow um und waren begeistert. Wir lösten unsere Verträge in Thüringen und fingen im Norden an. Nach einem Jahr war ich Viehzuchtbrigadier, und im Januar 1968 wählten mich die 160 Mitglieder der 1.000 Hektar großen Genossenschaft zu ihrer Vorsitzenden. Ich war damals 24 Jahre alt, mit Martin verheiratet, Mutter eines wenige Monate alten Kindes, Fernstudentin an der Universität Rostock im dritten Jahr. Mein Vorgänger hatte den Wechsel sehr einfühlsam mit den Genossenschaftsbauern vorbereitet, sie unterstützten mich in jeder Beziehung und machten dem Namen »Clara Zetkin« alle Ehre. Von den reichen Erfahrungen der Bauern habe ich viel und gern gelernt. Die LPG entwickelte sich erfolgreich, und ich durfte sie noch im gleichen Jahr auf dem X. Deutschen Bauernkongress in Leipzig vertreten. Ich berichtete dort über unsere Arbeit. Während einer Pause traf ich, inzwischen also zum zweiten Mal, auf Walter Ulbricht, der von einer Traube umringt war und diskutierte. Er wurde begleitet von Willi Stoph und Georg Ewald, dem Landwirtschaftsminister. Neben mir stand Else Götze von der LPG Görzig, die bereits landesweit bekannt war. Vor einigen Jahren hatte dort, im Kreis Köthen, eine mehrtägige Fachtagung zum vollmechanisierten Zuckerrübenanbau stattgefunden, auf der sich anderthalbtausend Praktiker, Wissenschaftler und Studenten über den Stand der Mechanisierung informierten. Es waren acht verschiedene Ernteverfahren demonstriert worden, wobei der Geräteträger RS 09 die mit Abstand wichtigste Arbeitsmaschine war. Der Traktor fand in der Landwirtschaft der DDR derartige Verbreitung, dass etwa beim Bau von Stallgebäuden seine Spurbreite, Höhe und Wendekreis berücksichtigt wurde. Mir lief das Herz über, ich redete munter drauflos, und als Ulbricht ging, hörte ich ihn zu seinen Begleitern sagen: »Eine junge Bäuerin spricht selbstbewusst über den Aufbau moderner Dörfer. Wo hat es das vor zehn Jahren schon gegeben?« Damit hatte er gewiss recht: In den 60er Jahren war die Entwicklung auf dem Lande gewaltig vorangekommen. 1969 wurde die DDR 20. Ich war neben meiner Berufstätigkeit noch immer aktiver FDJler. Der Zentralrat der FDJ lud einige Jugendliche aus Anlass des Republikgeburtstages nach Berlin ein. Wir landeten im Friedrichstadtpalast in der bekannten Fernsehsendung mit Hans Georg Ponesky »Mit dem Herzen dabei«. Vor mir saß Landwirtschaftsminister Georg Ewald mit seiner Gattin. Während der Sendung kam Ponesky mit einem Blumenstrauß von der Bühne und drückte mir diesen in die Hand, der sei für mich abgegeben worden. Das wiederholte sich im Laufe des Abends noch zwei Mal. Dann löste sich alles auf. Sie spielten einen Film ein, der während meiner Abwesenheit in unserem Dorf gedreht worden war. Und dann war auch ich bei der Arbeit und mit meiner Familie zu sehen, wir waren inzwischen zu viert. Dann ging das Licht an, und Minister Ewald bekam ein Mikrofon gereicht und erklärte, dass auf höchster Ebene beschlossen worden sei, mich mit dem Titel »Held der Arbeit« auszuzeichnen. Im Saal gab es daraufhin einen riesigen Applaus, aber ich nahm alles nur im Unterbewusstsein wahr, und die Tränen trübten meinen Blick. Dann aber kam die Frage auf: Was ziehe ich zur Auszeichnung im Staatsratsgebäude an? Nun, ein FDJler trägt seine blaue Bluse, einen schwarzen Rock und Absatzschuhe, mit denen ich, sonst an Gummistiefel gewöhnt, noch einigermaßen sicher laufen konnte. So vorbereitet betrat ich das Staatsratsgebäude und wurde zu dem für mich vorgesehenen Platz geleitet. Neben mir saß Lotte Ulbricht. Sie zog mich gleich ins Gespräch, ich spürte die vielen Blicke in meinem Rücken. Lotte schaute auf meine weißen Pumps, schüttelte den Kopf und meinte nur, dass die nun überhaupt nicht zu meinem Rock passten. Es hätten zu diesem feierlichen Anlass schwarze sein müssen. Als ich nach vorn gerufen wurde, um von Walter Ulbricht und Gisela Höppner meine Auszeichnung in Empfang zu nehmen, hatte ich das Gefühl, dass der ganze Saal auf meine Füße starrte. Meine Knie waren weich wie Butter. Wenige Wochen später kam ein Paket von Lotte Ulbricht. Ich fürchtete schon, dass es schwarze Absatzschuhe wären, die ich auf dem Lande nicht wirklich brauchte. Es waren zwei Bücher mit Widmung von ihr. Die konnte ich in der Tat gebrauchen. Ich besitze sie noch heute.
Gert Wendelborn: Die sozialistische DDR ist auch ein Staat der Christen
Gert Wendelborn, Jahrgang 1935, Theologiestudium in Rostock von 1953 bis 1958, 1962 Eintritt in die CDU, 1964 Promotion, 1969 Habilitation. Hochschuldozent für Ökumenische Kirchengeschichte und Angewandte Theologie von 1969 bis 1977, danach Professor für Ökumenik und Neue Kirchengeschichte an der Universität Rostock bis 1992. Von 1976 bis 1990 Volkskammerabgeordneter, Mitglied der Christlichen Friedenskonferenz (CFK) und des Weltfriedensrates sowie Vizepräsident des Friedensrates der DDR. Das Verhältnis Staat-Kirche unterlag in den 50er Jahren mancher Spannung. Die Konflikte spitzten sich 1952/53 und 1957/58 besonders zu. Zu Beginn des Jahrzehnts ging es vor allem um die Junge Gemeinde. Ich selbst gehörte ihr seit meinem zehnten Lebensjahr an. In meiner Oberschulklasse trugen viele Schüler das Kugelkreuz, so dass der Eindruck entstehen konnte, neben der FDJ gebe es noch eine zweite Jugendorganisation. Zugegeben, in der Jungen Gemeinde wurde nicht gerade Verständnis für den Aufbau einer qualitativ neuen Gesellschaft gefördert. Auf der anderen Seite provozierte die staatlich gesteuerte Kampagne gegen die Junge Gemeinde auch unseren Widerstand. Mit dem Neuen Kurs seit Juni 1953 entspannte sich die Sache ein wenig, doch nunmehr wurde erbittert um das Verhältnis von Konfirmation und Jugendweihe gestritten, für die seit 1954 forciert geworben wurde. Die Kirche hielt beides für unvereinbar. 1957/58 wurde die atheistische Agitation beträchtlich verstärkt. Das war das legitime Recht der herrschenden Partei, aber es bestand die Gefahr, dass die mögliche Gemeinsamkeit von Marxisten und (progressiven und loyalen) Christen dabei verloren ging. Walter Ulbricht hat das wohl gespürt und war sich bewusst, dass auch die marxistische Religions- und Kirchenpolitik weiter reifen müsse, wenn möglichst viele Bürger für die Mitgestaltung der sozialistischen Gesellschaft gewonnen und künftig Konflikte vermieden werden sollten. Er war 1960 jedenfalls in seinen diesbezüglichen Überlegungen viel weiter als mancher seiner Genossen. Ich entsinne mich, Jahre später, eines Disputs mit einer Marxistin aus der Leitung des Friedensrates der DDR, die mich vor einer Reise in die BRD, auf der ich für Frieden und Verständigung werben wollte, folgendermaßen instruierte: Wir vertreten entgegengesetzte weltanschauliche Positionen, aber wir wirken vertrauensvoll zusammen. Ich stimmte ihr prinzipiell zu, hielt diese Formel jedoch für zu einfach. Wenn es in geistiger Hinsicht Gegensätze zwischen uns gebe, die man auch noch herausstelle, dann könne man kaum »vertrauensvoll« zusammenarbeiten. Die Genossin verschloss ihr Gesicht, sie hatte mich also verstanden. Ulbricht setzte bereits am 4. Oktober 1960 bei der Konstituierung des Staatsrates neue Akzente in der Kirchenpolitik, die ich für bedeutungsvoll hielt. In seiner Programmatischen Erklärung sagte er sinngemäß: Um Menschen zu überzeugen, brauche man nicht nur Klarheit, sondern auch Geduld, nicht die Lautstärke entscheide, sondern das bessere Argument. Einer Zusammenarbeit mit »einer westdeutschen sogenannten deutschen Kirchenleitung« erteilte er eine Absage, d. h. die Leitung der evangelischen Landeskirchen in der DDR durch die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD) in Westberlin hielt er für unmöglich. Diese hatte nicht nur mit der BRD-Regierung einen Militärseelsorgevertrag[Anmerkung 198] geschlossen, sondern ihr Oberhaupt, Bischof Otto Dibelius,[Anmerkung 199] bestritt der DDR-Führung, überhaupt Obrigkeit zu sein. Damit zeigte er sich als Scharfmacher und Kalter Krieger. Ulbricht hatte aber sehr wohl wahrgenommen, dass sich in den Kirchenleitungen in der DDR andere Tendenzen durchzusetzen begannen. »Die kirchlichen Amtsträger in der DDR überzeugen sich mehr und mehr von der Richtigkeit der von Friedensliebe und den Prinzipien wahrer Menschlichkeit geleiteten Politik unserer Regierung.« Damit unterstrich der neue Staatsratsvorsitzende: Christentum und die humanistischen Ziele des Sozialismus sind keine Gegensätze. Der Begriff der (möglichen) humanistischen Gemeinsamkeit wurde in den folgenden Jahren zur Kernaussage, auf die sich progressive Christen beriefen. Das konnte aber nicht der End , sondern allenfalls Ausgangspunkt für weitere Überlegungen sein. Ich selbst habe als Theologe und politischer Funktionär in Wort und Schrift versucht, diesen Gedanken mit Leben zu erfüllen. Zwischen dem christlichen Gebot der Nächstenliebe und der sozialistischen Zielstellung voller sozialer Gerechtigkeit bestand eine grundlegende Gemeinsamkeit, mögen die einen mehr individuell, die anderen mehr kollektiv denken. Aber wir Christen mussten lernen, dass es nicht ausreicht, dem Durstigen ein Glas Wasser zu geben, sondern dass vielleicht eine Wasserleitung gebaut werden muss. Dass der unter die Räuber Gefallene nicht nur verbunden, sondern die ganze Gegend von Gesetzesbrechern gesäubert werden muss. Und Marxisten mussten begreifen, dass die großen Ziele auch in der kleinen Münze des Alltags zu haben sein mussten, damit sie nicht zur Phrase wurden. Unter der christlichen Bevölkerung gab es damals Zustimmung zur richtungsweisenden Rede Ulbrichts. Emil Fuchs,[Anmerkung 200] der große alte religiöse Sozialist, sammelte für ein Dankschreiben an Ulbricht mehr als 32.000 Unterschriften. Er übergab dieses Schreiben am 9. Februar 1961 an Ulbricht in dessen Amtssitz in Berlin Niederschönhausen. Bei dieser Begegnung formulierten beide noch einmal ihren Standpunkt. Es war das erste offizielle Gespräch des Staats- und Parteichefs mit christlichen Bürgern – Fuchs wurde von einer Delegation von Pfarrern und Laienpredigern begleitet. Und es war keineswegs zufällig, dass dieses erste Treffen nicht mit Vertretern von Kirchenleitungen erfolgte. Dazu schienen für Ulbricht wohl noch nicht die Voraussetzungen zu bestehen. Die Delegation konnte nicht für »die Kirchen« sprechen, sondern artikulierte ihre gedanklich geklärte und in Jahren praktischer Zusammenarbeit erprobte Gemeinsamkeit. Alle progressiven christlichen Traditionen der Vergangenheit fänden in der DDR ihre Erfüllung, erklärte Fuchs. Und Ulbricht äußerte seine Genugtuung darüber, dass die Unterzeichner des Briefes Sinn und Ziel seiner Programmatischen Erklärung und ihre Bedeutung für das Verhältnis von Staat und Kirche wie auch für die menschlichen und politischen Beziehungen zwischen Christen und Nichtchristen in der DDR gut verstanden hätten. Der Sozialismus habe in der historisch kurzen Zeit seines weltgeschichtlichen Wirkens mehr für die Verwirklichung der humanistischen und sozialen Ideale und Gebote des Christentums getan als alle früheren Gesellschaftsordnungen zusammen. Feudalismus und Kapitalismus verfolgten – ungeachtet ihres oft aufdringlich christlichen Anstrichs Ziele, die in unversöhnlichem Gegensatz zu sittlichen Leitwerten des ursprünglichen Christentums stünden. »Ich komme aber im Zuge unserer praktischen und freundschaftlichen Zusammenarbeit immer mehr zu der Überzeugung«, so Ulbricht weiter, »dass Sozialisten, Kommunisten und Christen unbeschadet ihrer verschiedenen Weltanschauung – bei der Gestaltung des Lebens und der Gesellschaft und der Sicherung des Friedens auf dieser Erde zusammengehören und einfach zusammenarbeiten müssen. Ein Christ, der seine humanistischen und sozialen Ideale ernst nimmt, der seinen Kopf freimacht von Vorurteilen und Ballast einer toten Vergangenheit, sollte eigentlich gar nicht anders können, als sich mit dem Sozialismus zu vereinen. Und ich finde, wir sollten ihn immer und auf jeder staatlichen und gesellschaftlichen Ebene herzlich willkommen heißen und mit Achtung und Freundschaft begegnen.« In den 60er Jahren erlebten die progressiven christlichen Gruppierungen ihre größte Ausstrahlungskraft. Ich denke an den Weißenseer Arbeitskreis, an die kirchliche Bruderschaft Sachsens, den Bund Evangelischer Pfarrer in der DDR, an den »Thüringer Weg« unter Landesbischof Moritz Mitzenheim[Anmerkung 201] die CDU in der DDR. Die und Arbeitsgruppen »Christliche Kreise« der Nationalen Front leisteten auf Bezirks und Kreisebene einen guten Beitrag zum Gespräch von Christen und Marxisten. Das war eine Verständigung über die Grundlagen praktischer Politik, zuvörderst der Friedenspolitik. Im Sommer 1964 konferierte Ulbricht mir Vertretern der Thüringer Kirchenleitung unter Bischof Mitzenheim. Dabei ging es nicht nur um geistige Grundfragen, sondern auch um aktuelle politische Erfordernisse der Friedenspolitik und des Verhältnisses der beiden deutschen Staaten. Die Thüringer Kirchenleitung schöpfte weit stärker als die anderen Landeskirchen in der DDR die Möglichkeiten der Kooperation und des konstruktiven Miteinanders aus. Mitzenheim war von völlig anderen theologischen Voraussetzungen als Fuchs zu ähnlichen Schlüssen wie dieser gelangt. An sich ein eher konservativer Kirchenmann warmer volkskirchlicher Prägung, vermied er als dezidiert lutherischer Christ, christliche Ansprüche an die Gesellschaftsgestaltung zu stellen. Auf der Grundlage von Luthers Zwei Reiche-Lehre bestand er darauf, dass Kanzel und Rathaus nicht verwechselt werden dürften. Dass also Kirche und Staat ihre jeweils spezifische Aufgabe wahrzunehmen hätten. So war er gefeit auch vor der Gefahr, modernistisch die Predigt des Wortes Gottes als Aufruf zu politischer Veränderung misszuverstehen und somit in falscher Weise zu politisieren. Erst recht aber erkannte er, dass Christen als Staatsbürger das jeweils Vernünftigste und dem Menschen am ehesten Dienende mit durchzusetzen haben, und dass die kirchlichen Amtsträger sie hierzu im Sinne der Politischen Diakonie zu ermuntern haben, wie die Kirche auch zu den Grundfragen des Lebens wie etwa zur Friedensfrage nicht in falscher Weltabgehobenheit schweigen darf. Wie kaum ein anderer Bischof war Mitzenheim vom humanistischen Grundcharakter der sozialistischen Ordnung überzeugt, für die er zunehmend Partei ergriff. Ihm zur Seite standen Oberkirchenrat Gerhard Lotz[Anmerkung 202] und eine Reihe von Pastoren der Landeskirche. Unmittelbarer Anlass für das Wartburggespräch mit Walter Ulbricht war Mitzenheims Kanzelabkündigung zum Beginn der Weltkriege vor 50 bzw. 25 Jahren, die er allen evangelischen Bischöfen in beiden deutschen Staaten zusandte. In diesem Gespräch am 18. August 1964, das in der Folgezeit neben das Gespräch vom 9. Februar 1961 gestellt wurde, konstatierte Ulbricht, dass in den vergangenen dreieinhalb Jahren Marxisten und Christen in ihrer Gemeinsamkeit ein gutes Stück vorangekommen seien. Diesen Weg müsse man weiter beschreiten, denn je fester die Einheit der DDR-Bürger sei, umso eher werde es möglich sein, die Bundesbürger zu einem aktiven Wirken für Frieden und Verständigung zu gewinnen. Mitzenheims Kanzelabkündigung habe dieser Sache gedient, besonders die Mahnung, mehr zu tun, damit Kriege verhindert werden, sagte Ulbricht. Die Regierung der DDR trete für eine allgemeine und vollständige Abrüstung in Deutschland als Ergebnis eines schrittweisen Prozesses ein. Kein deutscher Staat, so Ulbricht weiter, solle Verfügungsgewalt über Atomwaffen erhalten. Sie sollten sich stattdessen über eine atomwaffenfreie Zone unterhalten. Man müsse von der realen Lage ausgehen, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt und die zur Existenz zweier deutscher Staaten geführt habe. In diesem Sinne müsse die Nachkriegszeit beendet werden und eine Periode des Friedens beginnen. Dann könnten auch viel eher menschliche Erleichterungen erreicht werden, etwa durch ein neues Passierscheinabkommen[Anmerkung 203] mit dem Westberliner Senat, ließ Ulbricht Mitzenheim wissen. Bei einer Begegnung im August 1969 zum 5. Jahrestag ihres denkwürdigen Treffens unterstrich Bischof Mitzenheim erneut, dass es sich bei der Gemeinschaft von Christen und Marxisten nicht um ein Zweckbündnis handele, diese Verbindung wurzele tiefer. Die sozialistische DDR sei auch der Staat der Christen, da sie wüssten, dass eine Gesellschaftsordnung, die Egoismus, Ausbeutung und Unterdrückung sowie Konkurrenzkampf als Strukturprinzipien habe, nicht die Zukunft bestimmen dürfe.
Manfred Scheler: Wie man mit Kadern arbeiten soll
Manfred Scheler, Jahrgang 1929, Maschinenschlosserlehre, 1945 Eintritt in die SPD, 1946 SED, von 1946 bis 1949 Sekretär der FDJ-Kreisleitung Weißwasser und Niesky, 1953/54 Studium an der Komsomolhochschule in Moskau, danach 1. Sekretär der FDJ-Bezirksleitung Dresden, von 1963 bis 1982 Vorsitzender des Rates des Bezirkes Dresden, danach, bis 1990, Vorsitzender des VdgB, von 1986 bis 1990 auch Vorsitzender der Volkskammerfraktion des VdgB, Anfang der 90er Jahre Mitglied des Bundesgerichts des Deutschen Fußballverbandes (DFB). Im Jahr 1963 sollte ich die Funktion des Vorsitzenden des Rates des Bezirkes Dresden übernehmen, bis dahin war ich Landwirtschaftssekretär in der SED Bezirksleitung. Zur Bestätigung wurde ich zur Sitzung des Politbüros nach Berlin eingeladen. Walter Ulbricht nahm sich viel Zeit. Er stellte mir einige Fragen, zum Beispiel wollte er wissen, was mich für diese neue Aufgabe qualifiziere und wie ich mir die Arbeit in dem Bezirk vorstelle, den er für kompliziert hielt. Aber welcher Bezirk hatte keine Besonderheiten und war nicht »kompliziert«? Er bohrte und hakte immer wieder nach. Ich hatte nicht den Eindruck, dass ihn meine Antworten überzeugten, und meinte bereits, dass ich wohl für diese Funktion nicht bestätigt werden würde, obgleich mir einige Politbüromitglieder zur Seite sprangen. So etwa der 1. Sekretär der Leipziger BL, Paul Fröhlich. Ulbricht hatte wohl meine innere Kapitulation bemerkt und meinte mich mit der Bemerkung aufmuntern zu müssen, er examiniere mich nicht, um Gründe zu finden, den Vorschlag ablehnen zu können, sondern er wolle in Erfahrung bringen, wo und wie mir geholfen werden könne, mich auf diese Aufgabe vorzubereiten. Es wurde schließlich beschlossen, dass ich vier Wochen lang beim Ratsvorsitzenden im Bezirk Leipzig hospitieren solle. Und mir wurde eine Arbeitsgruppe des ZK an die Seite gegeben, mit deren Hilfe ich die Lage der Betriebe im Bezirk gründlich analysieren sollte. Danach sollte ich die Untersuchungsergebnisse im Bezirkstag vortragen und Vorschläge zur Verbesserung machen und diese auch erläutern. Danach sollte ich mich zur Wahl stellen. So geschah es. Ich sollte dann fast zwei Jahrzehnte in dieser Funktion arbeiten. Auch mit der Erfahrung, wie man mit den Kadern arbeiten soll, die ich mir bei Ulbricht abgeschaut hatte. Und noch etwas hatte ich von ihm gelernt: dass man sich besser eine eigene Meinung bildete, als sich eine fremde einreden zu lassen. Im Herbst des Vorjahres war die Kartoffelernte mehr als schlecht, der Bezirk Dresden lag im Vergleich zu anderen Bezirken weit zurück. Am Landwirtschaftssekretär der Bezirksleitung blieb letztlich alles hängen. Walter Ulbricht war gemeinsam mit Erich Apel und Günter Mittag im Gästehaus des Ministerrates in Gohrisch abgestiegen und bat das Sekretariat der Bezirksleitung um eine Aussprache. Der 1. Sekretär der Bezirksleitung hatte, wie der Volksmund sagt, Fracksausen, denn er fürchtete ein Donnerwetter insbesondere wegen der schlechten Versorgungslage. Lass dir was einfallen, forderte er mich auf, was du dem Alten erzählst, warum du die Pläne nicht erfüllst. Und übe Selbstkritik. Selbstkritik kommt immer gut. Da ich mir wegen des Wetters kaum Asche aufs Haupt streuen konnte, meinte ich die Leitungsarbeit dafür haftbar machen zu müssen. Wir waren im Jahr nach der Vergenossenschaftung, also es gab Anlaufschwierigkeiten bei den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, würde ich sagen, wir haben es nicht vermocht, alle Bauern mitzureißen. Hier haben wir ideologische Fehler gemacht, Genosse Ulbricht … Ulbricht erwartete uns. Genossen, fing er an, bevor ich meine Zerknirschung vortragen konnte. Auf dem Weg hierher habe ich große Flächen unter Wasser stehen sehen, das ist ja ein Jammer. Ich kann mir vorstellen, welche Schwierigkeiten den Bauern die Ernte macht, da verfaulen ja die Kartoffeln bereits im Acker … Ich ließ meine selbstkritische Rede stecken. Was sollte ich da von ideologischen Problemen reden, wenn es sich doch um metereologische handelte, was Ulbricht selbst wahrgenommen hatte. So konnten wir denn sehr ruhig und konzentriert darüber miteinander reden, was zu tun war, um den LPG-Bauern zu helfen.
Klaus Steiniger: Nicht nur Soldaten sollten für Ordnung im Spind sorgen
Klaus Steiniger, Jahrgang 1932, Sohn eines Berliner Rechtsanwalts, verlor zahlreiche Verwandte in Auschwitz. Mit 16 trat er in Westberlin der SED bei. Nach Übersiedlung in den Ostteil Berlins Jura-Studium. Später Staatsanwalt, Bürgermeister und Redakteur des Deutschen Fernsehfunks. Ein Jahr nach der Promotion 1966 wechselte er in das Außenpolitikressort der Tageszeitung Neues Deutschland, deren Redaktion er bis Ende angehörte. Seit 1998 ist er Chefredakteur der Monatszeitschrift »RotFuchs«. Ich bin Walter Ulbricht persönlich nur sehr periphär begegnet, allerdings in »historischer Stunde«. Im Oktober 1949 stellte mich ihm mein Vater Peter-Alfons Steiniger im späteren Haus der Ministerien vor. Im Steinsaal des klotzigen Gebäudes hatte ich, knapp 17, in dem nur durch eine rote Kordel abgetrennten winzigen Zuschauerbereich an der Gründung des Staates DDR teilnehmen können. So war ich dabei, als die jüngste Abgeordnete der Provisorischen Volkskammer Margot Feist dem gerade zum Präsidenten gewählten Wilhelm Pieck im Namen des Hohen Hauses gratulierte. Die Ära, in der Parteiführer vom Format Wilhelm Piecks, Otto Grotewohls, Walter Ulbrichts, Heinrich Raus, Hermann Materns und Bruno Leuschners eine ganze Generation aufbauwilliger und engagierter junger Menschen zu begeistern vermochten, ist jenen, welche folgten, nur ansatzweise vermittelbar. Damals gab es noch keinerlei Abstand zwischen »großen« und »kleinen« Genossen, erstickte kein übertriebenes Protokoll die physische und emotionelle Nähe. Viele Funktionäre waren aus Klassenkämpfen des Proletariats, nicht aus Machtkämpfen im Apparat hervorgegangen. Die Partei verflachte noch nicht zu einer Karrieristen anziehenden »Massenorganisation« und wurde daher vom klassenbewussten Teil der Arbeiterschaft als echte Vorhut empfunden. Als die Pionierrepublik 1952 in der Berliner Wuhlheide eröffnet wurde, war die DDR noch keine drei Jahre alt. Als höchster Ehrengast konnte der Staatspräsident begrüßt werden. Nach einem kurzen »Festakt« sah sich Wilhelm Pieck ein wenig auf dem weitläufigen Gelände um. Es ergab sich ganz zufällig, dass ich mich zu einem bestimmten Zeitpunkt gerade mit drei oder vier anderen Genossen, unter denen vielleicht auch ein »Leibwächter« war, direkt an seiner Seite befand. Da rief uns plötzlich ein älterer Mann von proletarischem Aussehen, der irgendwo am Wegesrand stand, sieben eindringliche Worte zu: »Passt ja auf den ollen Willem auf!« Die kleine Szene widerspiegelt Großes: Das Staatsoberhaupt jener Zeit war in den Augen dieses Arbeiters der »olle Willem« geblieben. Wäre eine solche Wärme und Nähe auch später noch denkbar gewesen? Otto Grotewohl war ebenfalls ein Politiker »zum Anfassen«. Das erste Mal begegnete ich ihm am Eingang zum Klub der Kulturschaffenden in der Jägerstraße, der damals – lange vor der Eröffnung des Künstlerklubs »Die Möwe« – ein beliebter Treffpunkt der Berliner Intellektuellen war. Dort stellte mich mein Vater dem landesweit bekannten Parteiführer vor. »Ich heiße Otto Grotewohl«, sagte dieser zu mir fast noch Halbwüchsigem. Grotewohl galt als besonders schlagfertig. Im Senatssaal der Humboldt-Universität sprach er gelegentlich zu Professoren, wobei er sich beim Zitieren einer Marx-Äußerung irrte, indem er dem großen Alten die Worte zuordnete, Kriege seien stets die Lokomotiven der Geschichte gewesen. Als ihm daraufhin ein den Originaltext kennender Teilnehmer aus dem Publikum zurief, Marx habe aber die Revolutionen als Lokomotiven der Geschichte benannt, ließ sich Grotewohl nicht aus der Ruhe bringen und erwiderte: »Die Kriege auch!« Als der chinesische Regierungschef Tschou En-lai, nachdem ihm mein Vater als Dekan der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität den Ehrendoktortitel verliehen hatte, bei einer Veranstaltung im Auditorium Maximum durch Grotewohl begrüßt werden sollte, war unserem Ministerpräsidenten der Name des hohen Gastes aus Fernost plötzlich abhanden gekommen. So zählte er nacheinander sämtliche Ämter und Funktionen des gerade Geehrten auf. Als ihm die »Munition« auszugehen drohte, eilte ein aufmerksamer Beobachter des Geschehens zum Podium, um Grotewohl in letzter Sekunde einen rettenden Zettel zu reichen. Aufatmend sagte dieser: »Genossen Tschou Enlai«. Das Feld der Großen jener Tage aber wurde durch den keineswegs populistischen oder populären Walter Ulbricht noch überragt. Durchaus nicht ohne die Gabe der Schlagfertigkeit, war er indes kein Meister des geschliffenen Wortes, sondern eher Anhänger eines spartanischen Sprech- und Lebensstils. Worthülsen waren ihm ein Graus. Vieles über Ulbricht erfuhr ich von meinem Vater Peter-Alfons Steiniger. Er war einer der 400 Abgeordneten der Provisorischen Volkskammer, welche die DDR am 7. Oktober 1949 ins Leben rief. Wie etwa Viktor Klemperer gehörte er der Kulturbundfraktion an. Zuvor war er – wie alle anderen an der Staatsgründung Beteiligten – Mitglied des Deutschen Volksrates gewesen und hatte als Sekretär des von Otto Grotewohl geleiteten Verfassungsausschusses bei der Ausarbeitung der ursprünglich für ein einheitliches Deutschland gedachten ersten Konstitution der DDR mit Hand angelegt. Pikant vielleicht: Wesentliche Teile des Textes entstanden in unserer Westberliner Wohnung am Botanischen Garten. Als Präsident der Deutschen Verwaltungsakademie in Forstzinna, wo die DDR-Leitungskader für die Kreis und Bezirksebene ausgebildet wurden, hatte mein Vater ständig mit Walter Ulbricht zu tun. Dieser mischte sich und zwar im durchaus positiven Sinne als Gesprächspartner, Ratgeber und konstruktiver Kritiker in das Geschehen an »seiner« Akademie ein. Das erfuhr ich von meinem Vater, der am 27. Mai 1980 verstarb und am Pergolenweg der Gedenkstätte der Sozialisten in Berlin Friedrichsfelde bestattet worden ist. Den politischen Stil und das Bestreben Walter Ulbrichts, jeglicher Schönfärberei einen Riegel vorzuschieben, habe ich dann auch als Journalist selbst kennengelernt. Zweieinhalb Jahrzehnte war ich leitender Redakteur und Auslandskorrespondent des Neuen Deutschland. Das Zentralorgan der Partei kam oftmals recht schwerfällig daher und war keineswegs immer von professionellem Glanz geprägt. Dennoch spürte man bei der Lektüre stets das sozialistische Anliegen und eine dem Marxismus verpflichtete Ideologie. Während der als Chefredakteur fähige, später aber zur menschlichen und politischen Charakterlosigkeit eines in der Wolle gefärbten Renegaten verkommene Günter Schabowski selbst aus ZK-Protokollen noch jede kritische Sentenz mit dem Bemerken herausstrich, der Feind kritisiere uns schon genug, da müssten wir es nicht auch noch selber tun, folgte Ulbricht einer absolut konträren Motivation. Er hasste jedes Vertuschen von Missständen. Schwarz blieb für ihn stets schwarz und weiß immer weiß, während Zwischentöne weit weniger seine Sache waren. Ulbricht drängte darauf, dass die Defizite und deren – möglicherweise auch recht hochgestellte – Verursacher ohne Ansehen der Person beim Namen genannt wurden, wobei er bisweilen das Kind mit dem Bade ausschüttete. Damals herrschte in der Partei eine Tendenz zu geradezu grotesker Prüderie. Kurze Zeit nach dem Krieg dominierte bei uns ein ebenso geradliniger wie oftmals rauer Umgangston. An der Humboldt Universität kolportierte man zu meiner Zeit nicht ganz grundlos folgenden Witz: Der Sekretär der Zentralen Parteileitung trifft den Parteisekretär der Fakultät. »Wieviel Genossen seid ihr?«, will er wissen. »Einhundert«, lautet die Antwort. »Und wieviel davon haben bereits eine Parteistrafe wegen unmoralischen Verhaltens?« »Achtundneunzig.« Nach kurzem Zögern: »Mach dir keine Sorgen, Genosse, die beiden erwischen wir auch noch.« In den Spalten des ND erschienen unter so bedeutenden Chefredakteuren wie Hermann Axen und Rudolf Herrnstadt etliche in die Pressegeschichte der DDR eingegangene Artikel, in denen Klartext geredet und reiner Tisch gemacht wurden. Dabei war den eigenen Genossen Missratenes durchaus kein Tabu. Ein Beispiel: In dem Beitrag »Kollege Zschau und Kollege Brumme« ging es um den Führungsstil eines sehr verdienten und auf Landesebene hoch angesiedelten Genossen, der wegen Unterdrückung von berechtigter Kritik gerügt und in der Funktion herabgestuft wurde. Ein anderer einprägsamer Titel lautete: »Misstöne im Brandenburgischen Konzert.« Er beschäftigte sich mit dem Verhalten Verantwortlicher im Stahlwerk Brandenburg und fand ebenfalls großen Widerhall. Walter Ulbricht lag wie ein Schießhund auf der Lauer, um Mängeln und Versäumnissen in der Wirtschaft auf die Spur zu kommen. Daraus resultierte eine in die Annalen des alten ND eingegangene Groteske: Den Vorstellungen des Generalsekretärs entsprechend eröffnete die Redaktion bisweilen selbst in ihren später oftmals gähnende Langeweile verbreitenden Leitartikeln das Feuer auf Säumige und Frevler. An einem Frühlingstag Ende der 60er Jahre war der schon vor langer Zeit verstorbene verdienstvolle Journalist Franz Krahl damit beauftragt, einen solchen Beitrag zu schreiben. Dabei ging es u. a. um das Fehlverhalten leitender Mitarbeiter eines volkseigenen Betriebes im Bezirk Karl-Marx-Stadt. Als Krahls Kolumne dann in einem kleinen Kreis diskutiert wurde, stieß sich einer der Begutachter daran, dass der Autor das kritisierte Werk als »Beispiel« bezeichnet hatte. Franz, der für seine unleserliche Schrift bekannt war, ersetzte das beanstandete Wort durch die Vokabel »typisch«. Als die Seite zur abendlichen Endkontrolle kam, lasen die erstaunten Korrektoren: »In einem bekannten Karl Marx-Städter Werk, das auch als Appiset für viele andere Betriebe gelten kann …« Der Setzer hatte Krahls Krakel »typisch« nicht lesen können und seiner Phantasie freien Lauf gelassen. Doch die Genossen im Großraum wussten Rat. Die unbekannte Wortschöpfung leite sich aus dem Französischen her und gehöre überdies längst zum üblichen Wirtschaftsvokabular auch der DDR, erklärte ein »Kenner«. Ihm widersprach niemand. So gingen 850.000 Exemplare der A-Ausgabe durch die Druckmaschinen. Als der diensthabende Chefredakteur Günther Kertzscher zu später Stunde ins Haus kam, konnte die erst in der Nacht produzierte B-Ausgabe für Berlin, Brandenburg und das Ausland noch vor einer Fortsetzung des Unheils bewahrt werden. Kertzscher stolperte sofort über die Phantasievokabel in der ersten Zeile des Leitartikels, ließ sich das Manuskript kommen, entzifferte Krahls Hieroglyphen und veranlasste die Korrektur. Tags darauf bat mich die Redaktion der Frauenzeitschrift Für Dich um ein geeignetes Pseudonym für eine Serie kleiner außenpolitischer Beiträge, die ich dem Blatt zugesagt hatte: Ich empfahl »Claudia Appiset«. Von welchem Format Walter Ulbricht gewesen ist, wurde nicht zuletzt auch durch die Tatsache erhellt, dass er sieht man von gehässiger Verhöhnung seiner Mundart und Sprechweise oder feindseligem Anmachen ab – zur Zielscheibe unzähliger geistreich pointierter Witze geworden ist. Einer war kurz nach der Herstellung diplomatischer Beziehungen zwischen der DDR und den Malediven in Umlauf gebracht worden. Die meisten DDR Bürger mussten erst auf der Karte nachschauen, wo das Inselreich lag. Walter Ulbricht erblickt in diesen Tagen vor dem Staatsratsgebäude morgens, mittags und abends denselben Wachsoldaten. Als er sich bei diesem erkundigt, warum er denn niemals abgelöst werde, bekommt er zur Antwort: »Genosse Staatsratsvorsitzender, ich stehe Strafe!« »Warum?« »Weil ich nicht gewusst habe, wo die Malediven sind.« Ulbricht ermahnt den jungen Mann: »Nun, das ist nicht gut. Ein Soldat muss in seinem Spind Ordnung halten!«
Klaus Wenzel: Ohne die beiden Ulbrichts gäbe es das Hotel »Neptun« nicht
Klaus Wenzel, Jahrgang 1937, Fischer, Koch, Hoteldirektor auf der »Völkerfreundschaft«, von 1966 bis 1969 Direktor des Hotels »Warnow« in Rostock, Initiator und seit der Eröffnung 1971 Direktor des Hotels »Neptun« in Rostock-Warnemünde. 2002 in den USA als Spitzen-Hotelier ausgezeichnet, 2003 als bester deutscher Hotelier geehrt. Inzwischen Rentner. Die Ulbrichts stiegen immer in dem von mir geleiteten Hotel »Warnow« ab, wenn sie zur Ostseewoche nach Rostock kamen. Das war die damals wohl größte und wichtigste internationale politische Veranstaltung, die die DDR jährlich ausrichtete. Die beiden fühlten sich bei uns sehr wohl, und Lotte Ulbricht fragte mich wiederholt, ob ich nicht einen Wunsch hätte. Offenkundig wollte sie sich erkenntlich zeigen. Ich winkte stets dankbar und bescheiden ab. Als sie nicht nachließ, platzte ich heraus: »Ich will ein neues Hotel!« Und sie reagierte gelassen: »Schreiben Sie das mal auf ein Blatt Papier, Genosse Klaus.« Das tat ich. Ich skizzierte meine Überlegungen und gab damit zu erkennen, dass ich mich in den Engpässen der DDR-Volkswirtschaft doch nicht völlig auskannte. Aber die Ulbrichts waren von meiner Idee angetan, ein Hotel mit Weltniveau – der Ostseewoche würdig – in den Warnemünder Sand zu setzen. Walter Ulbricht arrangierte ein Treffen mit dem 1. Sekretär der SED Bezirksleitung Rostock, Harry Tisch, und anderen wichtigen Leuten, darunter dem Generaldirektor der Interhotels. Dieser begann seine Ausführung mit dem Hinweis, dass ich mit meinen 32 Jahren für eine solche Aufgabe doch wohl noch ein wenig zu jung sei, worauf Ulbricht erklärte: »Genosse Siegert, die Beratung ist für Sie beendet.« Am Ende gab es eine kurze Notiz und einen Beschluss der Bezirksleitung – und dann konnte ich loslegen. Ich schaute mir zunächst 42 Hotels in sechs Ländern an und wusste: Ich hatte Geld für einen »Trabant« aber ich wollte einen »Mercedes«. Außer Ulbrichts Zusage, ich könne jederzeit bei ihm anrufen, wenn es partout nicht weitergehe, gab es von Berlin keine Hilfe. Ein einziges Mal nur machte ich von seinem Angebot Gebrauch. Als Folge schickte er mir alle Minister, zwei Dutzend hatten wir, nach Rostock. Sie haben mich, den jungen Schnösel, wegen meiner Forderungen gehasst. Ich wollte moderne Kücheneinrichtungen haben, worauf man mich auf sowjetische Einrichtungen verwies. Da müsste meine Küche doppelt so groß werden, um alle Geräte unterzubekommen, lästerte ich. Das gleiche bei der Telefonanlage. Oder die Belüftung. Ich wolle keinen Anbau … Der einzige, der mir zur Seite sprang, war Verkehrsminister Otto Arndt. Dem schien mein unerschütterbares Selbstbewusstsein und mein unbändiger Wille zu imponieren. Und er stimmte schließlich seine Kollegen um. Am 20. Jahrestag der DDR, am 7. Oktober 1969, erfolgte der erste Spatenstich. Zuvor hatte ich noch die Warnemünder überzeugen müssen, dass sie den am Bauort befindlichen Seerosenteich und den Gedenkstein verlegten. Das ging mit der angrenzenden Entbindungsstation natürlich nicht. Da wir auch nachts in der Baugrube arbeiten – vor allem die lautstarken Rammarbeiten waren lästig–, habe ich erklärt, dass das künftige Hotel die Patenschaft über alle in der Nacht geborenen Kinder übernehmen würde. Komisch, von Stund an kamen dort tagsüber keine Kinder zur Welt, nur noch in der Nacht war Betrieb im Kreißsaal. Am 4. Juni 1971 wurde unser Haus unweit der Warnemünder Mole eröffnet. Fast ein Jahr später kam Fidel Castro mit einer kubanischen Delegation, das »Neptun« wurde seine Residenz, dort führte man auch die politischen Verhandlungen mit der DDR-Spitze. Auf Wunsch Castros nahmen auch die Ulbrichts an einer Schiffsreise teil, und Fidel hatte sie am nächsten Tag, das war der Samstag, ins Hotel gebeten. Sie selbst logierten außerhalb, ich glaube in Dierhagen. Morgens standen die beiden alten Leute im Foyer – und lösten in den Kulissen Hektik aus. Werner Lamberz zerrte mich beiseite und verlangte, ich solle den beiden die Tür weisen. »Du musst die rauswerfen, Honecker will sie hier auf keinen Fall sehen.« »Wieso ich?«, fragte ich zurück. »Weil du der Hausherr bist!« Lamberz’ Erklärung duldete keinen Widerspruch. Also erfüllte ich den mir unangenehmsten Auftrag, den ich jemals bekommen habe. Ich begrüßte die beiden Ulbrichts und verwies darauf, dass das gesamte Hotel zum Protokollbereich erklärt worden sei und ich keine freie Minute hätte, um mich ihnen mit der nötigen Aufmerksamkeit zu widmen. Ich würde sie aber gern zum Montag einladen, da wäre ich den ganzen Tag nur für sie da und könnte ihnen, wie versprochen, das ganze Haus zeigen. Die beiden waren klug genug, um den eigentlichen Grund des Rauswurfs zu begreifen, und ersparten mir die Peinlichkeit einer Nachfrage. Sie drehten sich um und verließen wortlos das Hotel. Am Montag verbrachten wir einen sehr angenehmen Tag miteinander. Ich zeigte ihnen das Haus, sie ließen sich manches Kunstwerk erläutern und fragten interessiert nach. Beide zeigten mit jeder Geste, dass sie mir nichts nachtrugen. Vielleicht aber war ihnen auch bewusst, dass diese Stillosigkeit, mit der man ihnen begegnete, nicht über Nacht gekommen war. Sie war ihnen darum nicht neu. Ins Gästebuch trug er mit seiner breitlaufenden, schwer zu lesenden Schrift ein: »Gen. Direktor, Genossen Mitarbeiter des Hotels Neptun! Herzlichen Dank für die ideenreiche Einrichtung des Hotels und die gute Versorgung der Gäste. Im Wesentlichen ist das Hotel ein Sanatorium mit vielen Einrichtungen für die Rehabilitation der Gesundheit der Werktätigen und ihrer Familienangehörigen. Herzlichen Dank Gen. Wenzel, der als Direktor sich größte Mühe gegeben hat, mit Unterstützung der Bezirksleitung der SED das Weltniveau kennenzulernen und das Beste fürs Neptun anzuwenden. Den Ministerien und dem Hotelwesen sind hier viele gute Beispiele gegeben. Ich wünsche Gen. Wenzel und den Mitarbeitern weitere Erfolge und persönlich alles Gute. 26.6.72.«
Edmund Weber: Ablösung mit Waffengewalt in Dölln? Das ist absoluter Unsinn
Edmund Weber, Jahrgang 1927, sowjetische Kriegsgefangenschaft in Karelien von 1945 bis 1949, danach Neulehrer für Russisch in Heiligenstadt, dort unterrichtete er auch in der Kreisdienststelle des MfS, was dazu führte, dass er als Dolmetscher eingestellt wurde. Von 1952 bis 1990 tätig bei der Hauptabteilung Personenschutz, letzter Dienstrang Oberstleutnant. Von September1961 bis August 1973 als »persönlicher Begleiter« für die Sicherheit von Walter Ulbricht verantwortlich. Du warst zwölf Jahre lang für die Sicherheit von Walter Ulbricht zuständig, hast dich bisher an deine Schweigepflicht gehalten und bist erst jetzt bereit, auf Fragen über ihn zu antworten. Du bist ein Zeitzeuge, der aus eigenem Wissen berichten kann und nicht auf Gerüchte und Vermutungen angewiesen ist. Daher meine erste Frage: Hat es jemals einen Anschlag auf Walter Ulbricht gegeben? Nein, nie. Das lag aber wohl weniger an uns, sondern daran, dass er – ob man das heute wahrhaben will oder nicht immer die Nähe zu anderen Menschen suchte. Genau dort lag aber unser Problem: Er ging zu den Leuten, schüttelte Hände, redete ohne Arg mit ihnen. Kein Gedanke von ihm, dass da etwas passieren könnte. Wir schwitzten manchmal Blut und Wasser. Wir kannten ja aus der Literatur und aus dem Fernsehen diverse Anschläge und Attentate auf Politiker anderer Länder. (Angefangen von US-Präsident Garfield, dem 1881 auf einem Bahnhof in den Rücken geschossen wurde, über Lenin, auf den 1918 nach einer Rede in einer Moskauer Fabrik die Sozialrevolutionärin Kaplan feuerte, oder Mahatma Gandhi, der 1948 von einem hinduistischen Fanatiker ermordet worden war, bis hin zu US-Präsident J. F. Kennedy 1963.) Die Liste der Mord und Terroranschläge war schon damals sehr lang. Insofern waren und sind öffentliche Personen, selbst wenn sie geliebt werden, stets gefährdet. Denk an John Lennon, der hatte nun wirklich keine Feinde – sieht man mal vom FBI ab, das ihn in den 70er Jahren bespitzelte. Also, Walter Ulbricht bereitete uns manchmal echte Sorgen, wenn er auf die Leute ohne Argwohn und ungeschützt zumarschierte. Erzähle doch mal, wie ein normaler Arbeitstag im Leben des Staatsratsvorsitzenden aus der Sicht des Personenschützers ablief? Es begann mit Frühsport. Er machte Gymnastik auf der Terrasse oder lief auf Rollerski durch die Waldsiedlung. Das dauerte etwa eine halbe Stunde. Und nach dem Frühstück ging es zur Arbeit. Da habe ich ihn von zu Hause abgeholt. Etwa 8.30 Uhr saß er an seinem Schreibtisch im ZK oder im Staatsrat. Sein Hauptbüro befand sich aber im Gebäude des SED-Zentralkomitees. Ja. Wenn er staatliche Aufgaben wahrnahm, wechselte er in das Staatsratsgebäude. Bis zur Fertigstellung des Baus im Jahre 1964 residierte er im Schloss Niederschönhausen. Ist er vom ZK ins Staatsratsgebäude zu Fuß gegangen? Er wollte es. Aber wir sind gefahren. Insofern triumphierte die Sicherheit über ihn. In Berlins Zentrum waren immer sehr viele Menschen unterwegs. Auch aus dem Ausland. Das schien uns doch ein unvertretbar hohes Risiko zu sein. Wie war es mit den Mahlzeiten? Gegen 13 Uhr aß er Mittag. Ich habe vorher oben im Speisesaal in der 7. Etage angerufen. Er aß ja keine Kartoffeln. Die Küche bereitete Reis oder Nudeln vor. Manchmal rief ich aber auch die Schwester seiner Frau Lotte an. Sie wohnte mit den Ulbrichts in Pankow unter einem Dach. Dort lebten sie, bevor die Familie in die Waldsiedlung nach Wandlitz zog. Das heißt, Walter Ulbricht behielt auch nach dem Umzug seine Stadtwohnung und hat dort gelegentlich seine Mahlzeiten zu sich genommen? So war es. Die Schwester von Ulbrichts Frau war quasi Haushälterin und Köchin der Familie. Walter Ulbricht lebte sehr gesund. Nicht nur, weil er es ihm vorgeschrieben war oder weil er eitel auf seine Linie achtete, sondern weil es ihm ein Bedürfnisse war. Völlerei und Trinkerei waren ihm zuwider, er lebte geradezu asketisch. Nach dem Essen hat er sich zurückgezogen und ein wenig geruht. Das aber erst, als er jenseits der 70 Jahre war. Früher nicht. Wie hast du seinen Arbeitstag danach wahrgenommen? War er im Büro, hat er den Nachmittag für Gespräche reserviert. Da gaben sich die Leute die Klinke in die Hand. Sein Arbeitspensum war enorm. Man sagt, dass es zumeist Besucher von außen waren: Experten, Künstler, Sportler ... Stimmt. Er beriet sich gern mit Fachleuten. Da konnte er geduldig zuhören. Ich erlebte, dass er nach den Gesprächen neue Ideen hatte, die er dann seiner Sekretärin diktierte. Und wann war Feierabend? In den letzten Jahren so gegen 18, 19 Uhr. Manchmal wurde es aber auch viel später, vor allem, wenn es Termine gab. Gern ging er ins Theater oder ins Konzert, tauschte sich anschließend mit Künstlern aus. Wenn wir früher als gewohnt nach Wandlitz fuhren, wussten wir: Er will auf dem Liepnitzsee rudern. Er war ja ein aktiver Sportler. Rudern war eine seiner Leidenschaften. Sportler hatten ihm zu einem Geburtstag ein Ruderboot geschenkt. Ruderte er allein? Manchmal fuhr seine Frau als Steuerfrau mit. War sie nur beim Rudern Steuermann? Ich denke schon. Dann ist es also nur ein Gerücht, dass sie das Regiment zu Hause führte? So ist es. Sie waren beide ein eingespieltes Team, das natürlich auch stritt. Wenn er in der Arbeit viel Ärger hatte, war seine Frau Lotte gelegentlich schon mal so etwas wie ein Blitzableiter. Das spürte ich. Ich habe beide aber als ein Paar erlebt, das sehr liebevoll und nachsichtig miteinander umging: Zwei sehr aufeinander fixierte, miteinander seelisch, aber vor allem politisch verbundene Menschen. Sie waren Partner und sich stets nah. Aber er und Lotte waren auch zwei starke Persönlichkeiten, die sich reiben konnten. Sie haben sich ergänzt. Hast du dafür ein Beispiel parat? Walter Ulbricht bekam beispielsweise alle Neuerscheinungen der DDR Verlage. Die hat er sich angeschaut. Die, die er für wichtig hielt, nahm er mit nach Hause, die anderen kamen in die Bibliothek. In Wandlitz dann, das habe ich gesehen, hat Lotte sehr viel gelesen, hat ihrem Mann die wichtigsten Stellen angestrichen und Annotationen oder Exzerpte gefertigt. So brauchte Walter nicht mehr alles selbst lesen, wozu er ja auch nicht die Zeit gehabt hätte. Er war aber stets über Neuerscheinungen gut informiert. Bei Spaziergängen haben sich beide sehr intensiv darüber ausgetauscht. Sie gingen in Wandlitz regelmäßig spazieren? Nicht nur in Wandlitz. Überall, wo wir waren, ob in Moskau oder in Leipzig, anjedem Ort. Eine halbe Stunde vorm Schlafengehen musste er sich bewegen. Und überall machte er auch seinen Frühsport? Ja. Wenn wir in Oberhof waren, machte er wie gewohnt auf dem Balkon seine Übungen, natürlich zusammen mit seiner Frau. Und nach dem Frühstück ging es zum Skilaufen. Langlauf. Bist du auch Ski gelaufen? Es blieb mir ja nichts anderes übrig, wenn ich ihn »bewachen« sollte. Verstehe. Und Walter Ulbricht hat dich abgehängt? Du warst doch jünger. Er aber versierter. Ich war Anfänger. In den ersten Jahren ging es noch nach Oberwiesenthal, wo wir in einem Gästehaus der NVA einquartiert waren. Dort trainierte ihn Eberhard Riedel, ein zehnfacher DDR-Meister im Alpinen Skisport, drei Mal nahm der auch an Olympischen Spielen teil. Nicht unerwähnt soll sein, dass Walter Ulbricht im Winter auch Schlittschuh lief, entweder in Wandlitz auf einer Spritzeisbahn oder im Sportforum Dynamo, bisweilen drehten sie auch als Paar ihre Pirouetten. War Ulbricht Jäger? Er ging zur Jagd, wenn er Gäste hatte und meinte, es sei politisch notwendig. Aber ein passionierte Jäger war er nicht. Es gibt diese Fotos mit Leonid Breschnew von der Jagd. Ja, er hat den KPdSU-Generalsekretär begleitet. Manchmal hat er dies aber auch Erich Honecker überlassen. Dreimal war ich mit ihm zur Hasenjagd mit dem Diplomatischen Corps. Da interessierten ihn die Gespräche viel mehr als alles andere. Du sprichst ja gut russisch und hast ihn auch auf Reisen in die Sowjetunion begleitet. Wie war sein Verhältnis zu den sowjetischen Genossen? Sehr gut. Es war tatsächlich ein brüderliches Vertrauensverhältnis. Ulbricht vertrat selbstbewusst die nationalen Interessen der DDR. Ob das seinen Partnern immer gefallen hat, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich habe ihn aber bis zuletzt als einen zuverlässigen Freund der Sowjetunion erlebt. Im Übrigen sprach ich auch Polnisch, weshalb ich Ulbricht auch auf allen Reisen nach Polen begleitete. Einmal dolmetschte ich auch ein Gespräch mit Gomulka, weil die Maschine so klein war, dass nicht einmal mehr Platz war für den eigentlichen Dolmetscher. Hast du auch Gespräche gedolmetscht? Nein, das machte meistens Werner Eberlein, und manchmal sprang auch Lotte Ulbricht ein, vor allem, wenn es um sehr diffizile Angelegenheiten ging. Wenn man den heutigen Sicherheitsaufwand bei Staatsbesuchen oder auch beim Schutz der hiesigen Politiker mit entsprechenden Maßnahmen der DDR vergleichst, wie fällt dann dein Urteil aus? Unvergleichbar. Der Aufwand in der DDR war wesentlich geringer. Ich möchte sagen: Er war normaler. Mein Kommando hatte maximal sechs Genossen. Wenn der Staatsratsvorsitzende unterwegs war, begleiteten ihn zwei Fahrzeuge, je eins vorn und eins hinten. Im Urlaub fuhr er manchmal sogar nur mit einem Pkw. Wenn er außerhalb spazieren ging, war ich in seiner unmittelbaren Nähe, ein zweiter Mann ging voraus und ein dritter folgte uns. Frau Merkel glaubt sich zu erinnern, sie sei als Kind oder Jugendliche in den Ferien in Dierhagen gewesen und habe sich über den abgesperrten Strand am Regierungsgästehaus geärgert. Unsinn. Der Strand vor dem Erholungsheim des Ministerrates war frei zugänglich. Die Urlauber konnten ungehindert am Wasser flanieren. In Richtung Neuhaus gab es sogar einen FKK-Strand. Wenn wir am Strand wanderten, sind die Ulbrichts auch daran vorbeigegangen. Mit der Nacktheit hatten sie keine Probleme. Sie waren doch nicht verklemmt. Sie kamen aus der Arbeiterbewegung. Ich war drei oder vier Mal mit Familie Ulbricht in Dierhagen. Dort war immer alles ziemlich normal. Hat Walter Ulbricht dort auch Leute angesprochen? Selbstverständlich. Ohne Scheu, ja. Wie steht’s, wie geht’s, wo kommt ihr her, wo seid ihr untergebracht, seid ihr zufrieden? Ist die Versorgung gut? Etc. Er nutzte solchen vordergründig unpolitischen Smalltalk, um etwas über die Stimmung im Land zu erfahren, ungefiltert und ungeschönt. Daran war ihm immer sehr gelegen. Und das geschah auch nicht mit landesväterlicher Herablassung, etwa: Ich bin der Ulbricht und ihr seid meine Untertanen, nun erzählt mir doch mal, wie glücklich und zufrieden ihr seid. Ihn interessierte nicht der Schuh, sondern die Stelle, wo er drückte. Und das spürten die Leute auch. Ulbricht war wahrlich kein sehr geselliger Mensch, aber er war sehr kommunikativ. Wie waren so seine Ansprüche? Bescheiden. Sein persönliches – nicht das politische – Leben organisierte vor allem seine Frau Lotte. Bis hin zum Speisenplan. Und vor allem: Sie hat stets alles bezahlt. Die beiden ließen sich nichts schenken. Alles wurde korrekt abgerechnet. Zum Mittagessen gab es oft ein Glas Beaujolais. Wenn wir in der Sowjetunion waren, kaufte ich dort Chwantschkara, einen georgischen Rotwein. Auch darum hat sich seine Frau gekümmert. So etwas beschäftigte ihn nicht. Unterschied sich der Tagesablauf im Urlaub von der übrigen Zeit des Jahres? Nicht unbedingt. Früh machte er Sport. Dann ging man spazieren bis zum Mittagessen. Danach hat er geruht und sehr viel gelesen. Wenn er im Ausland zum Urlaub war – in der Sowjetunion oder Polen – brachten wir ihm einmal pro Woche die wichtigste Post, er hat sie schnell durchgesehen. Ich übernachtete an Urlaubsort. Er gab mir dann die Antworten mit. Als Kuriere flogen wir Linie, es gab keinen Regierungsflieger, der täglich die Kurierpost brachte. Wo machte er Urlaub? Meist in Oberhof und Dierhagen. Im Ausland waren wir in Pizunda und Sotschi. In Barwycha bei Moskau kurten sie. Es gibt Veröffentlichungen, in denen behauptet wird, vor dem Rücktritt Walter Ulbrichts von seiner Funktion als Erster Sekretär sei ein bewaffnetes Sicherheitskommando nach Dölln gefahren, habe ihn unter Hausarrest gestellt und zum Rücktritt gezwungen. Du warst sein Sicherheitsbegleiter und weißt besser Bescheid als die Gerüchtemacher. Die ganze Sache ist ausgesprochener Quatsch! Leider hat auch Markus Wolff solchen Unsinn verbreitet. Was ihn dabei geritten hat, weiß ich nicht. Wenn man so viel mit einem Menschen zusammmen ist, wie ich mit Ulbricht war, dann spürt man gelegentlich auch, was in ihm innerlich vorgeht. Dass es möglicherweise um den Rücktritt meines Chefs ging, vermutete ich schon lange. Seit mindestens einem Jahr gab es mehrere Gespräche zwischen ihm und Breshnew. Eine solche Frage wie die Veränderung an der Spitze der Partei, wurde nicht über Nacht entschieden und schon gar nicht mit Waffengewalt. Das war ein langer Prozess. Im Übrigen: Ohne Breshnew wäre ein Rücktritt Ulbrichts gar nicht möglich gewesen. Ich kannte Breshnew gut. Wir hatten beide am gleichen Tag Geburtstag und er hat mit mir bei jedem Zusammentreffen auch gesprochen. Wir haben manche Zigarette zusammen geraucht. Es mag ja sein, dass er Vorbehalte gegenüber Walter Ulbricht hatte. Das kann ich nicht beurteilen. Aber er ist ihm immer mit großer Achtung und Höflichkeit begegnet. Selbst wenn Erich Mielke auf die Idee gekommen wäre, ein Sicherheitskommando zu schicken, das Ulbricht bedrängen sollte, hätte das weder Breshnew noch Honecker zugelassen. So etwas gab es meines Wissens in der DDR nicht. Lass uns noch einmal zum Anfang zurückkehren. Wie bist du Walter Ulbrichts Sicherheitsbegleiter geworden? Das war Zufall. Ich kam aus dem Hochzeitsurlaub zurück und wurde informiert, dass die Stelle bei Ulbricht vakant sei. In den letzten Monaten hatten drei Genossen die Probe nicht bestanden. Franz Gold hielt mir eine lange Rede und fragte mich, ob ich die Aufgabe übernehme würde, worauf ich antwortete: Würde ich jetzt nach Ihren Ausführungen »Nein« sagen, müssten Sie mich entlassen, Genosse General. Also, eine große Wahl habe ich ja nicht. Am nächsten Tag fuhr ich nach Bad Liebenstein, um mich vorzustellen. Dort weilten die Ulbrichts gerade zur Kur. Aber ich meine, dass meine Sprachkenntnisse wahrscheinlich ausschlaggebend waren, dass ich diese Aufgabe 1961 übertragen bekam. Denn die Zuneigung zum MfS wird es nicht gewesen sein. Sein Verhältnis zu uns als Sicherheitsorgan und auch zu den sowjetischen Tschekisten war nach meiner Beobachtung eher distanziert. Ich will nicht ausschließen, dass dort die Erfahrungen aus der Sowjetunion in den 30er und 40er Jahren mit hineinspielten. Warst du noch in Dölln, als er starb? Nein, ich war bereits abgezogen, um ausländische Gäste zu betreuen, die zu den Weltfestspielen gekommen und im Palasthotel in Berlin untergebracht worden waren. Genossin Lotte rief mich an und sagte, Walter sei in Ruhe und Würde eingeschlafen. Mich hat sein Tod tief getroffen.
Siegfried Anders: Ich machte das Protokollbild, den Ausschnitt bestimmten andere
Siegfried Anders, Jahrgang 1933, geboren in Breslau und aufgewachsen in Thüringen, ab 1948 im Kalibergbau untertage tätig. 1954 nach Berlin zum Wachregiment und noch im selben Jahr zum Personenschutz. Ausbildung zum Fotografen und Fotografenmeister. Cheffotograf des Personenschutzes. Einsatz bei Staatsjagden, bei Protokollterminen im Staatsrat, im ZK und bei Auslandsreisen sowie nichtöffentlichen Veranstaltungen von DDR-Spitzenpolitikern. Er gehörte nicht zu jenem Zehntel der rund 500 Personenschützer, die von der neuen Macht übernommen wurden. Seit wann fotografierst du? Seit meinem 14. Lebensjahr. Meine erste Kamera war eine Zeiß Ikon, so eine mit Balg zum Ausziehen. Und mein erster Auftrag war eine Hochzeit. Das sprach sich herum. Wer kam darauf, dich in Berlin als Fotograf einzusetzen? Das war Franz Gold, unser Chef. Er sagte, wir haben eine Veranstaltung, da solltest du fotografieren. Dann kamen sukzessive Protokolltermine hinzu, bei denen keine Presse zugelassen war. Ich fotografierte und sah dann anderentags meine Fotos in der Zeitung mit der Quelle: ADN/Zentralbild. Warst du sauer, weil dein Name nicht dabeistand? Nein, überhaupt nicht. Ich war stolz. Später kam dann doch der Name hinzu: ZB/Anders. Das war die Verabredung: Ich bekam von der Agentur kein Honorar, da ich ja beim Personenschutz angestellt war, aber sie gaben mich namentlich als den Urheber des Bildes an. So bekam ich dann wiederholt gezielt Aufträge der Nachrichtenagentur, von Zeitungsredaktionen oder von DDR Institutionen, wenn bestimmte Motive gebraucht wurden. Das lief aber natürlich alles über den großen Dienstweg. Wann hast du das erste Mal Walter Ulbricht fotografiert? Am 1. Mai 1958 auf der Tribüne in Berlin. Und zum ersten Mal auf einer Auslandsreise war das im September 1965 in Moskau. Der Besuch erfolgte anlässlich des 10. Jahrestages der Unterzeichnung des Staatsvertrages mit der UdSSR. Auch Ministerpräsident Willi Stoph, zwei seiner Stellvertreter, zwei Minister, ein Vizeminister und ein Staatssekretär waren mitgereist, insgesamt zählte die Delegation an die hundert Personen. Ich war wie üblich in die Pressegruppe integriert. Man bestellte mich in den Kreml, irgendeine Protokollveranstaltung zu fotografieren, aber der Termin fand nicht statt, der Wirtschaftsvertrag wurde, wie offenkundig von DDR-Seite geplant, nicht unterzeichnet. Ich hatte mit meinen Kollegen umsonst im Flur gewartet. Aber ich hatte dann noch genügend andere Fototermine, während wir durchs Land reisten. Hast du ihn auch privat fotografiert? Ja, als Lotte und Walter Ulbricht beispielsweise ihre Tochter Beate zum Zug brachten, mit dem diese in die Sowjetunion zum Studium fuhr. Lotte verabschiedete sie am Ostbahnhof mit Küsschen, er war wie immer, also ein wenig zurückhaltender. Wenn die beiden unterwegs waren und, wie man heute sagt, »in der Menge badeten«, gingen sie auf die Leute zu, sprach meist die Frauen an, während Walter die Männer bevorzugte. Das war, wenn man die beiden beobachtete, eine gut funktionierende Arbeitsteilung. Sie war kommunikationsfreudig, er abwartend und überlegt, aber dann engagiert. Mit die schönsten Motive gab es alljährlich am 30. Juni, wenn Pioniere bei ihm in Wandlitz am Geburtstag zum Gratulieren kamen. Du hast 1971 jenes bekannte Foto von Ulbricht gemacht, als er im Morgenmantel und Pantoffeln das Politbüro empfängt, das damals, als es im Neuen Deutschland erschien, und noch heute bei jenen, die sich daran erinnern, helle Empörung auslöst, weil es den Staatsmann Walter Ulbricht desavouierte. Wie kam diese Aufnahme überhaupt zustande? Der Protollchef des Zentralkomitees rief mich am Morgen des 30. Juni an. Das Politbüro fahre nach Wandlitz zum Gratulieren, sagte er. Wir brauchen ein Bild für die Zeitung. Ich wusste weder, wie groß die Delegation sein würde, noch in welchem Raum das stattfinden sollte und schnappte meine Hasselblad. Es war anderthalb Wochen nach dem VIII. Parteitag, an dem Ulbricht nicht hatte teilnehmen können, weil er krank geworden war und die Ärzte von einer Teilnahme abrieten. Dort war der Wachwechsel vollzogen worden. Die Delegierten wählten das Zentralkomitee, und dieses bestätigte Honecker in seiner Funktion, die er bereits am 3. Mai 1971, auf dem ZK-Plenum, von Ulbricht übernommen hatte. Eine Stunde vor dem genannten Termin war ich in Ulbrichts Haus. Er liege noch im Bett, sagte Lotte Ulbricht. »Genosse Anders, es dauert noch eine Weile, dann wird er kommen.« Dann erschien Walter Ulbricht und begrüßte mich. Aber er konnte schlecht stehen, war merklich geschwächt, also setzte er sich und wartete. Auch er schien nicht zu wissen, wer und wie viele Personen kommen würden. Er saß dort also auf dem Stuhlsessel und harrte aus. Dann erschienen plötzlich Honecker und das ganze Politbüro, der Raum war gefüllt. Ich trat bis an die Wand zurück, um alle aufs Bild zu bekommen, doch trotz Weitwinkelobjektiv gelang das nicht. Darum machte ich ein zweiteiliges Panoramabild. Der Film ging so zu ADN und ist dort entwickelt worden. Du hast also die Abzüge nicht selbst gezogen, nicht die Ausschnitte festgelegt und die Bilder auch nicht gesehen, bevor sie herausgegeben wurden? Nein. Ich war nur der Fotograf. Wer gab die beiden Bilder frei? Das weiß ich nicht. Ich vermute mal, dass das im ZK geschah. Wie hast du das Foto, das am nächsten Tag im ND erschien, gefunden? Als nicht gut. Man hätte zumindest den unteren Teil mit den Pantoffeln abschneiden müssen. Meine Kollegen, die wussten, dass das namentlich nicht gezeichnete Bild von mir stammte, haben mich dafür scharf kritisiert. Westagenturen, die ursprünglich das Bild hatten haben wollen, zogen es nicht grundlos vor, die Aufnahme mit der ND Seite zu faksimilieren, damit auch der letzte die damit unterstellte Botschaft verstand. Nicht das Foto an sich war der Skandal, sondern die Veröffentlichung dieses Ausschnitts und die Platzierung im Zentralorgan der Partei. Aber möglicherweise waren Wahrnehmung und Interpretation von jenen, die mein Foto in die Zeitung rückten, weder so gewollt noch bedacht worden. Vielleicht sollte die Botschaft lediglich lauten: Walter Ulbricht ist tatsächlich krank. Schließlich war er nicht auf dem Parteitag gewesen, was natürlich Fragen aufgeworfen hatte. Es gab innerhalb und außerhalb der Partei Diskussionen und Spekulationen über die Meldung, Ulbricht fehle »aus gesundheitlichen Gründen«. Und nun sollte das Bild den Beweis liefern, dass es ihm wirklich nicht gut gehe. Viele meiner Kollegen und Bekannten haben mir gleich gesagt: Siegfried, das Bild ist nicht gut. Sie haben recht. Ich glaube nicht, dass es erst durch die spätere Interpretation schlecht wurde. Es zeigte einen hinfälligen Greis in einer wenig vorteilhaften Lage. Weißt du, ich will das nicht rechtfertigen, nur mir zu erklären versuchen, was dahinter gesteckt haben könnte. Du kennst doch das Gedicht von Peter Hacks »Der Fluch«, das er damals zu diesem Foto gemacht hat. Darin kommst auch du vor, als namenloser »Photokünstler«. Nein, kenne ich nicht. *** Peter Hacks: Der Fluch Als das Pack mal wieder nach ihm langte, Schlug er zu wie immer. Doch die Klaue, Plötzlich, riss nicht mehr. Er wars, der wankte. Und der Schlag verlief ins Ungenaue. Fast belustigt da ward der Erkrankte Seiner Ohnmacht inne, hob die Braue, Und indem versagte sein vergreistes Hirn die Gegenwart des mächtigen Geistes. Und da hatten sie ihn denn. Ihr schlechter Stil empfahl, dass man Humor benütze. Kein Geschrei sein sollt er, ein Gelächter, Clown, nicht Opfer. Eine Zipfelmütze Ward ihm angetan, ein maßgerechter Schlafrock, der die Taperglieder schütze, Und so war er in die sanfte Kuhle Eingepasst von einem Sorgenstuhle. Wie er endlich saß, so hergerichtet, Wagten sie sich kühn in seine Nähe. Auch ein Photokünstler war verpflichtet, Dass sein Zeugnis an die Presse gehe Und die Menge, kenntlich abgelichtet, Wie sie ihn besichtigten, besähe. Doch der Oberste der Dilettanten Machte sich zum Festtagsgratulanten. Und er sah das Glück in ihren Mienen. Schafsgesichter sah er, siegessatte, Und er sah sie in die Linse grienen, (Denn sie wollten alle auf die Platte), Und er kannte jedes doch von ihnen, Weil er jedes oft gedroschen hatte. Aus dem Ekel da vor dem Besuche Formte heimlich sichs in ihm zum Fluche.– Oh, mein Bau steht fest, hat Dach und Wände. Kein bestauntes oder schnelles Ende Hab ich deiner Wut vorherzusagen. Selbst ein Narr braucht Zeit, den abzutragen. Zehn, zwölf Jahre geb ich dir, ein langes Dauerleiden deines Niederganges. Gönner, der du bist, von Sklavenseelen. Kein Begriff erhelle Deine Welten, Keine Gutschrift soll, kein Eid soll gelten Und berichtet sein in ungelesnen Zeitungen von Dingen, nie gewesnen. Keine Straße soll dein Land verbinden, Keine Post soll den Empfänger finden, Und nichts soll in deinen Telephonen Als ein Brausen und ein Grausen wohnen. Rost wird ganze Industrieanlagen, weil ein Zahnrad mangelt, niedernagen, Während ab die Blätter, die entfärbten, Von den Bäumen gehn, den schmutzverderbten. Grässlich hören in den Meiereien Wird das Volk das Vieh nach Futter schreien Oder, unterm Dung verborgen, kleine Ferkel finden, kleine tote Schweine. Also zwischen Abfällen und Müllen Soll sich deine Jammerzeit erfüllen. Aber dann, am Rande der Vernichtung, Folgt des Vaterlandes Neuerrichtung Ruhmumglänzt auf meinen unzertrennten Unerschütterbaren Fundamenten. Keine Silbe sprach er. Doch verstanden Alle sie den Inhalt seines Schweigens. Und sie wünschten dringend sich abhanden Aus dem Gruppenbilde, das sie eigens Angeordnet hatten, und verschwanden Rasch und äußerst müde des Sichzeigens. Doch in ihren Herzen blieb ein Beben. Denn ein Fachmann flucht nicht leicht daneben.
Rainer Fuckel: Er war ein disziplinierter Patient und zu keinem Moment senil
Rainer Fuckel, Jahrgang 1937, geboren und aufgewachsen in der Nähe von Bad Liebenstein. Nach Schulbesuch 1951 Beginn einer Schlosserlehre, 1953 Eintritt in die SED, Geselle in einem SDAG-Betrieb, Besuch der Arbeiter und-Bauern-Fakultät in Jena 1954/55. Statt der geplanten Ingenieurausbildung Studium der Medizin, um, wie es hieß, die Position der Arbeiterklasse in der Ärzteschaft zu stärken. Ausbildung zum Internisten in der Kurklinik Bad Liebenstein. Oberarzt im Volksheilbad, 1968 Chefarzt im Regierungssanatorium »Heinrich Mann«. Von 1971 bis 1973 Ulbrichts »betreuender Arzt«. Danach, bis 1991, wieder in Bad Liebenstein. Seitdem niedergelassener Arzt (gemeinsam mit seiner Frau), in Ruhla. Du bist als Schlosserlehrling mit 16 Jahren in die SED eingetreten. Warum? Das war ein Reflex auf den Putsch vom 17. Juni. Kamst du aus politischem Hause? Nein, meine Eltern waren apolitisch. Es war eine jugendliche Trotzreaktion. Hast du das später bereut? Nein, wieso? Die Parteimitgliedschaft hat mir weder besonders geschadet noch sonderlich genützt. Von Vorteil war es nicht, stets nach dem Grundsatz leben und handeln zu müssen: Wo ein Genosse ist, da ist die Partei! Ich bedauere das nicht, im Gegenteil. In einer Gesellschaft der organisierten Verantwortungslosigkeit macht sich das Fehlen eines solchen politisch moralischen Auftrages, der damals Millionen Menschen motivierte, nachhaltig bemerkbar. Wie wurden Sie Chefarzt im Regierungskrankenhaus. Hat Ihnen nicht doch das Parteibuch genützt? Es half der Genosse Zufall. Ich arbeitete im Volksheilbad und hatte gelegentlich Bereitschaftsdienst im Sanatorium. Da ist ein Staatssekretär auf mich aufmerksam geworden, der mich Prof. Helga Wittbrodt[Anmerkung 204] empfahl, der Chefin des Regierungskrankenhauses in Berlin, zu dem auch das Heinrich-Mann Sanatorium gehörte. Die Chefarztstelle war vakant, und so wurde ich berufen. Prof. Wittbrodt stellte mich der Belegschaft kurz vor und fuhr wieder ab. Im Nachgang muss ich sagen: Es ist schon erstaunlich, welch grenzenloses Vertrauen damals in junge Leute gesetzt wurde. Das aber entsprach dem Geist jener Jahre. Ich war gerade mal 30 und wurde Chef von einer so wichtigen Einrichtung, ohne dass sie mich persönlich kannte. Wie war sie so als Chefin? Es gibt kaum Nachrichten über sie. Prof. Wittbrodt war eine gute Chefin, ihre souveräne Gelassenheit imponierte mir. Sie ließ mich an der langen Leine laufen, wie man so sagt. Nur wenn sie häufig anrief, wusste ich: Es ist was im Busch. Allerdings klärte sie Probleme nie am Telefon, sie ließ mich nach Berlin kommen. Das war ihre Taktik. So auch im Sommer 1971. Sie rief mich an: »Genosse Fuckel, ich würde dich gern einmal sprechen, komm mal bitte her.« Wie gewohnt überprüfte ich mich selbstkritisch: Was hast du falsch gemacht, welches Problem gibt es, wo hast du was Falsches gesagt? Entgegen meiner Befürchtung gab es jedoch nichts dergleichen. Der Genosse Ulbricht ist krank, eröffnete sie mir, er liegt zu Hause in Wandlitz, wir brauchen einen betreuenden Arzt. Einen Leibarzt. Diesen Begriff benutze ich bewusst nicht. Er ist auch keiner, der zur DDR passt. Du hast zugesagt? Erstens wurde gerade das Sanatorium in Bad Liebenstein rekonstruiert, und zweitens fühlt ich mich durch eine solche Offerte natürlich auch geschmeichelt. Warum gerade du? Prof. Wittbrodt sagte, Walter Ulbricht möchte einen Arzt haben, der von der Pike auf gedient hat, »Wissenschaftler« habe er genug um sich. Am liebsten wäre ihm ein Armeearzt – warum, das könne sie mir auch nicht sagen, aber den habe sie nicht. Und: er müsse auch spritzen können, habe Ulbricht gesagt. Offenkundig hatte er diesbezüglich schon schlechte Erfahrungen gemacht. Hattest du vorher jemals etwas mit ihm zu tun gehabt? Überhaupt nicht. Und dann bist du mit Prof. Wittbrodt nach Wandlitz gefahren? Ja, sie musste mich, nachdem ich zugesagt hatte, ihm ja vorstellen. Und Prof. Baumann, Konsulararzt und Kardiologe, war auch noch dabei. Wir trafen Ulbricht im Bett liegend in seinem Haus. Er musterte mich aufmerksam, wobei mir klar war, dass er schon informiert worden war, wer da an seinem Bett stand, er verschaffte sich nur einen persönlichen Eindruck per Augenschein. Er stellte mir einige Fragen, natürlich auch die wichtigste, ob ich diese Aufgabe übernehmen wolle. Das sei ein 24-Stunden-Dienst und mit ihm als Patienten gewiss nicht einfach. Du musstest von Thüringen nach Wandlitz ziehen? Nein, ich pendelte. Wir waren zwei Kollegen und wechselten uns ab: Ich machte vierzehn Tage Dienst und dann zwei Wochen frei, in dieser Zeit war Dr. Mühlberg vor Ort. Im Medizinischen Stützpunkt in Wandlitz gab es noch einen Pfleger. Ich wurde immer mit einem Pkw von Bad Liebenstein abgeholt und nach Wandlitz und wieder retour gebracht. Was konkret war deine Aufgabe? Ihn täglich zu untersuchen, im Bedarfsfall medizinische Indikationen vorzunehmen und ihn zu begleiten, wenn er unterwegs war, etwa in den Staatsrat, ins ZK oder an den Döllnsee fuhr. Woran litt er? Ich halte mich auch im Falle Ulbrichts an meine ärztliche Schweigepflicht.[Anmerkung 205] Nur soviel: Er war ein Mann, der auf die 80 zuging, Schweres durchgemacht hatte und insbesondere in den letzten 25 Jahren sehr hart arbeitete, was – trotz gesunder Lebensweise: er trank nicht, er rauchte nicht und trieb zeitlebens Sport merkliche Spuren bei ihm hinterlassen hatte. Wie war das Verhältnis zu ihm? Erstaunlich gut. Zwischen Arzt und Patient gibt es naturgemäß eine Distanz, und hier, so fürchtete ich zunächst, würde sie besonders groß sein, womit ich schief lag. Warum nahmst du das an? Wir waren altersmäßig fast ein halbes Jahrhundert auseinander, er war der erste Mann im Staat und verkörperte Geschichte, hatte die Welt gesehen und manchen Strauß ausgefochten, während ich, mit Verlaub, ein unbedeutender Kurarzt aus der Provinz war, der noch nie den Thüringer Wald verlassen hatte. Minderwertigkeitskomplexe? Keineswegs. Aber so war nun mal die Relation. Dennoch ließ Ulbricht diese Distanz nicht spüren. Ja, stimmt, er redete wenig, wirkte verschlossen, aber dennoch nicht unnahbar. Obgleich er mich nie mit dem unter Genossen üblichen »Du« ansprach. Er hat mich immer gesiezt. Ich hätte es auch nicht fertiggebracht, ihn mit »Du« anzusprechen. Bei Prof. Wittbrodt ging es mir ähnlich. Viele sagten »Helga« zu ihr. Ich konnte das nicht. Mein Respekt war zu groß. Woran hast du gemerkt, dass es so etwas wie seelische Nähe gab? Üblicherweise fuhr ich im Begleitfahrzeug des Staatsratsvorsitzenden mit. Doch hin und wieder sagte er: »Genosse Fuckel, steigen Sie bei mir ein.« Und dann setzte ich mich neben ihn in den Tschaika. Ich wusste doch, unter welchem Druck er stand, spürte aus Details diese großen politischen Spannungen, denen er ausgesetzt war, und mich erstaunte, wie er das scheinbar ungerührt alles wegsteckte. Nur manchmal brach es aus ihm heraus, kein Mensch kann alles folgenlos in sich reinfressen. Ich habe mich manchmal gefragt: Wieso kommt keiner aus der Nachbarschaft und schaut mal nach ihm? Nicht einer kam vorbei, nicht einer. Da fängt man selbst als Außenstehender an zu grübeln. Und später erlebte ich zwangsläufig, wie er abgeschoben und kaltgestellt wurde. Einmal war Breshnew mit Honecker in der Schorfheide zum Jagen. Ulbricht zog sich seine Jägerkluft an, obwohl er kein Jäger war wie die anderen, und wir fuhren zum Schloss Hubertusstock, wo doppelt Aufregung herrschte: Erstens war Breshnews Fahrzeug aufgrund eines Kurzschlosses ausgebrannt, und zweitens weil Ulbricht auf der Bildfläche erschien. Solche offensichtlichen Zurückweisungen erlebte ich mehrere Male. Auch als Castro 1972 im Hotel »Neptun« abgestiegen war und er Lotte und Walter Ulbricht, wir waren in Dierhagen, zu sich einlud, nachdem sie mit der Staatsjacht am Vortag auf See waren. Hotelchef Wenzel musste die beiden Ulbrichts auf Weisung von Lamberz im Foyer abwimmeln. In Dierhagen war er, glaube ich, vier Wochen. Er hat sich dort in seine Sandburg gelegt oder schwamm draußen. Er war ein guter Schwimmer. Wie reagierte er auf solche offensichtlichen Zurückweisungen? Also, er hat sich nie über konkrete Personen geäußert, schon gar nicht abfällig. Seinen Unmut merkte man an seinem Blutdruck. Ich entsinne mich der Politbürositzung am 26. Oktober 1971. Er kam mit hochrotem Kopf aus dem Raum, sein Blutdruck war derart hoch, dass mit dem Schlimmsten zu rechnen war. Offenkundig musste es eine harte Auseinandersetzung gegeben haben, die ihn derart aufgebracht hatte. Später fragte ich ihn, und ich räume ein, dass ich mich da etwas unzulässig vorwagte: »Genosse Ulbricht, ich dachte, zwischen Ihnen und dem Genossen Honecker bestünde so etwas wie ein Vater-Sohn Verhältnis?« Darauf antwortete er nur kurz: »Das habe ich auch gedacht.« Damit war das Gespräch beendet. Nur einmal reagierte er sichtlich verärgert in der Öffentlichkeit: Wir waren zur agra[Anmerkung 206] in Markkleeberg. Der Genosse, der den Rundgang anführte und alles mit uns machte und erklärte, nahm fortgesetzt Bezug zu einem Plenum, das kurz zuvor stattgefunden hatte, und zitierte nun wiederholt den Ersten Sekretär, als habe dieser das Fahrrad neu erfunden. Irgendwann brach es aus Ulbricht heraus: »Hören Sie auf, es gab auch schon früher ZK-Tagungen!« Das war das einzige Mal, dass ich ihn richtig laut erlebte. Du bist auch mit ihm spazieren gegangen? Ja, sicher. Nach jenen vier Wochen, in denen er das Bett hüten musste wegen der Herzschwäche, war er wieder mobil. Wir schlenderten durch Wandlitz und machten dann mitunter Pause auf einer Bank. Er erzählte von seiner Wanderschaft als Tischlergeselle und wie er sich damals die Füße mit Hirschfett eingerieben habe, um sich nicht Blasen zu laufen. Wir teilten uns einen Apfel und plauderten über Persönliches. Politische Themen waren die Ausnahme. Ich entsinne mich, wahrscheinlich weil Arzt bin, daran, wie er sich maßlos aufregte, dass im RGW entschieden worden war, bestimmte Arzneimittelproduktion aus der DDR an Ungarn und die Tschechoslowakei abzugeben. Wir verlören dadurch Millionen an Valuta Erlösen, sagte er kopfschüttelnd. War er ein wehleidiger Patient? Überhaupt nicht. Es gab kein Murren. Als Arzt war man sein Chef, er tat, was man ihm sagte, er war sehr diszipliniert. Aber als er danieder lag, wäre die wirksamste Medizin gewesen, wenn jemand aus dem Politbüro einmal zu Besuch gekommen wäre. Es gab nicht einmal einen Anruf. Es war, als wäre er bereits gestorben. Das war bitter. Und er schwieg dazu tapfer.[Anmerkung 207] Aber: Selbst als er im Krankenbett lag, hat er sich immer beschäftigt, meist las er. Ich habe nie erlebt, dass er untätig herumsaß oder Zeit ungenutzt verstreichen ließ. Um es deutlich zu sagen: Er war zu keinem Zeitpunkt senil. Es hieß doch, dass er störrisch und eigenwillig gewesen sei, er habe Anflüge von Altersstarrsinn gegeben. Er war körperlich und geistig besser beieinander als die beiden letzten Päpste in ihren letzten Dienstjahren und durchaus noch in der Lage, die Staatsgeschäfte zu führen. Dass er sich ins Abseits gestellt fühlte, dass ihm gezeigt wurde, dass man ihn nicht mehr brauchte, hat, wie ich meine, seinen Alterungsprozess beschleunigt. Er hat das bewusst realisiert und zwangsläufig gefragt: Was soll ich jetzt noch hier? Du warst auch beim Essen dabei. Er war auch hier, wie bei allen Ausgaben, sparsam. Ein Teller Kartoffelsuppe in der Betriebskantine für fünfzig Pfennig genügte ihm völlig. Wenn der Pfleger und ich mal im Restaurant in Wandlitz allein aßen, war der Koch froh, wenn er mal zeigen konnte, was er so draufhatte. Schulden zu machen, privat wie gesellschaftlich, war bei ihm verpönt. Ich entsinne mich, wie wir einmal mit Nikolai Tomski, der das Lenindenkmal geschaffen hatte, auf dem Fernsehturm war. Der Bildhauer wollte ein paar Ansichtskarten haben die hat Walter Ulbricht dort im Laden für ihn gekauft und bezahlt. Wenn du ihn zu offiziellen und öffentlichen Begegnungen begleitetest, hieltst du dich mit dem Arztköfferchen dezent im Hintergrund … Dezent schon, aber ohne Koffer. Den wollte er nicht sehen. Er wollte nicht, dass bekannt wurde, dass dort zwei Menschen stünden, die darauf achteten, dass er nicht umfiele. Zwei? Manchmal war noch Frau Dr. Banaschak dabei, eine sehr kultivierte, gebildete Anästhesistin, die uns gelegentlich begleitete. Aber es trat nie ein Notfall ein, jene Politbürositzung, die ich schon erwähnte, einmal ausgenommen. Das war in den zweieinhalb Jahren, als ich an seiner Seite war, die kritischste Situation. An den Sitzungen drin nahmen wir nicht teil. Wir saßen im Büro von Gisela Glende und tranken unseren Kaffee. Wann bis du nach Bad Liebenstein zurückgekehrt? Im Sommer 1973, kurz vor seinem Tod. Die Renovierung des Sanatoriums war abgeschlossen, und ich musste mich entscheiden, zu bleiben oder zu gehen. Ich habe ihm das vorgetragen. Was hat Walter Ulbricht gesagt? »Genosse Fuckel, gehen Sie zurück. Meine Tage sind gezählt, und was dann aus Ihnen wird, weiß ich nicht …« Er wusste aber aus der Vergangenheit, was in solchen Fällen zu passieren pflegte. Alle Personen aus dem Umfeld verloren nicht nur den »Chef«, sondern wurden »umgesetzt«. Das ging bis zum Kraftfahrer. Als wären sie alle infiziert und hätten den Aussatz des Abgetretenen. Ulbricht schenkte mir zum Abschied einen Bildband mit persönlicher Widmung und eine Spiegelreflexkamera Exakta. Die besitze ich noch. Wenige Tage später starb er dann. Und Lotte Ulbricht? Ach, sie war manchmal ein wenig ruppig, sie hatte ihren eigenen Kopf, aber ich kam gut mit ihr klar. Sie war nach seinem Tod noch einige Male zur Kur in Bad Liebenstein. Jene hochgestellten Kurgäste, die bis vor Kurzem noch um sie herumscharwenzelt waren, wollten nun möglichst nicht mehr in ihrer Nähe sitzen. Meine Frau und ich haben uns um sie gekümmert, wenn sie bei uns war, wir haben Ausflüge unternommen, tranken zusammen Kaffee … In der Wendezeit, als auch hier im Volksheilbad alles drunter und drüber ging und wir von den angeblichen »Revolutionären« beschimpft, denunziert und vertrieben wurden, brachte ich ihr gegenüber meine Enttäuschung und meine Wut zum Ausdruck: »Und für solches Pack haben wir uns nun jahrzehntelang krumm gemacht!« Ich hoffte, sie würde mir zustimmen, doch sie entgegnete verblüffend: »Genosse Fuckel, wir haben wahrscheinlich zuviel in der kurzen Zeit von den Menschen verlangt.« Sie nahm die Leute, die uns in den Rücken fielen, sogar noch in Schutz. Sie war in ihrem Urteil objektiver und gerechter als ich. Und ich bin noch immer nicht mit mir im Reinen, dass ich ihr damals nicht angeboten habe, zu uns zu ziehen, um aus Berlin wegzukommen. Die Solidarität der Genossen untereinander, deren Abwesenheit Sie damals in Wandlitz, als Ulbricht 1971 allein in seinem Krankenbett lag, schmerzlich registrierten, wiederholte sich doch Ende 1989. Ja. Wie wir auseinander liefen – das betraf doch nicht nur die Parteiführung war doch jämmerlich und unwürdig. Dafür schäme ich mich noch heute. Um die Honeckers hat sich auch niemand gekümmert. Ohne die Hilfe der Kirche wären sie obdachlos gewesen. Wir waren einmal 2,3 Millionen SED Mitglieder. Wenn sie und deren Familienangehörigen am 18. März 1990 anders gewählt hätten, wäre etwas anderes herausgekommen. Nicht einmal in der Anonymität der Wahlkabine bekannten sie sich zur sozialistischen Idee. Nun ja, die PDS bekam damals knapp 1,9 Millionen Stimmen, das waren 16,4 Prozent. Ich bleibe bei meiner These.
Fußnoten
- ↑ Rosa Luxemburg 1915 in ihrer Arbeit »Die Krise der Sozialdemokratie« (»Junius Broschüre«): »Friedrich Engels sagt einmal: Die bürgerliche Gesellschaft steht vor einem Dilemma, entweder Übergang zum Sozialismus oder Rückfall in die Barbarei. Was bedeutet ein ›Rückfall in die Barbarei‹ auf unserer Höhe der europäischen Zivilisation? Wir haben wohl alle die Worte bis jetzt gedankenlos gelesen und wiederholt, ohne ihren furchtbaren Ernst zu ahnen. Ein Blick um uns in diesem Augenblick zeigt, was ein Rückfall der bürgerlichen Gesellschaft in die Barbarei bedeutet. Dieser Weltkrieg – das ist ein Rückfall in die Barbarei. Der Triumph des Imperialismus führt zur Vernichtung der Kultur – sporadisch während der Dauer eines modernen Krieges und endgültig, wenn die nun begonnene Periode der Weltkriege ungehemmt bis zur letzten Konsequenz ihren Fortgang nehmen sollte. Wir stehen also heute, genau wie Friedrich Engels vor einem Menschenalter, vor vierzig Jahren, voraussagte, vor der Wahl: entweder Triumph des Imperialismus und Untergang jeglicher Kultur, wie im alten Rom, Entvölkerung, Verödung, Degeneration, ein großer Friedhof; oder Sieg des Sozialismus, d. h. der bewussten Kampfaktion des internationalen Proletariats gegen den Imperialismus und seine Methode: den Krieg. Dies ist ein Dilemma der Weltgeschichte, ein Entweder - Oder, dessen Waagschalen zitternd schwanken vor dem Entschluss des klassenbewussten Proletariats.«
- ↑ Franz Josef Strauß (1915-1988), CSU Politiker, der zu den schärfsten Kritikern von Brandts Ostpolitik gehörte. Strauß war in den Adenauer-Regierungen Bundesminister für besondere Aufgaben (1953-1955), Bundesminister für Atomfragen (1955-1956) und Bundesminister der Verteidigung (1956 1962). In der Großen Koalition unter Regierungschef Kurt Georg Kiesinger (1966 1969) war er Bundesfinanzminister. Als bayerischer Ministerpräsident (1978-1988) unterlag er als Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl 1980 gegen Helmut Schmidt (SPD).
- ↑ Adolf von Thadden (1921-1996), Mitbegründer der NPD. Er scheiterte mit seiner neofaschistischen Partei 1969 nur knapp am Einzug in den Deutschen Bundestag.
- ↑ Bericht der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages »Überwindung der Folgen der SED-Diktatur im Prozess der deutschen Einheit« mit 15.000 Blatt Anlagen.
- ↑ Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 24. Oktober 1996, Seite 57.
- ↑ Geheimanlage vom 27. Mai 1919, Institut für deutsche Militärgeschichte, Abt. Archiv, Akten Nr. R 837, S. 64.
- ↑ Flugblatt von Ulbricht, Weinert und Bredel von der Stalingrader Front, Anfang Januar 1943. Es diente als Passierschein zum Übergang auf die Seite der Roten Armee. Aus: »Walter Ulbricht, ein Leben für Deutschland«, Leipzig 1968, Seite 67.
- ↑ Revolutionäre deutsche Parteiprogramme. Berlin 1964, Seite 196.
- ↑ Das Zitat wie auch die folgenden von Breshnew stammen aus einer Notiz des Gespräches zwischen Breshnew und Honecker am 28. Juli 1970. Die Wiedergabe des Gesprächs erfolgte in einem Dokumentenband, den Erich Honecker Anfang 1989 allen Mitgliedern und Kandidaten des Politbüros des ZK der SED zur Information übergab.
- ↑ Memorandum der Bundesregierung vom 2. September 1956, veröffentlicht im Bulletin des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung vom 8. September 1956, Nr. 169, S. 1630.
- ↑ »Alles auf den Kopf«, in: Der Spiegel 29/1953 vom 15. Juni 1953. In dem Beitrag wird über mehrere Gespräche Semjonows mit Kastner berichtet, bei denen es um die Veränderung der Politik und der Zusammensetzung der Regierung der DDR ging. Darin wird auch behauptet, Semjonow habe arrangiert, dass Kastner im Sommer 1952 auf der Krim einen »ungezwungenen Drei Tage-Treff mit Stalin« wahrnahm.
- ↑ Karl Schirdewan: Aufstand gegen Ulbricht, Berlin 1994. Karl Schirdewan (1907-1998), 1925 KPD, 1931 Verlagschef der »Jungen Garde«, 1934 zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt, danach KZ Sachsenhausen und Flossenbürg bis 1945. Nach dem Krieg Tätigkeit im Parteivorstand, 1949 Leiter der Westkommission, 1953 Mitglied des Politbüros, von 1955 bis 1958 ZK-Sekretär, verantwortlich für Kaderfragen und Mitglied der Sicherheitskommission (1954-1957). Im Februar 1958 zusammen mit MfS-Minister Ernst Wollweber wegen fraktioneller Tätigkeit aus dem Politbüro und dem Zentralkomitee der SED ausgeschlossen. Von 1958 bis 1965 Leiter der Staatlichen Archivverwaltung Potsdam. Schirdewan wurde als stalinistisch Verfolgter 1990 von der PDS rehabilitiert und in den Ältestenrat der Partei aufgenommen.
- ↑ Zum Realitätsbezug von Behauptungen in Schirdewans Schrift »Aufstand gegen Ulbricht« siehe: Herbert Graf: Mein Leben. Mein Chef Ulbricht. Meine Sicht der Dinge, Berlin 2008, S. 329-335
- ↑ Kurt Hager (1912-1998), Journalist, 1930 KPD, 1932 RFB, von 1937 bis 1939 in Spanien. Exil in Großbritannien, 1949 Professor für Philosophie an der Humboldt-Universität, 1952 Leiter der Abteilung Wissenschaften im ZK der SED. 1959 Kandidat und 1963 Mitglied des Politbüros des ZK der SED und Leiter der Ideologischen Kommission des Politbüros. Abgeordneter der Volkskammer von 1958 bis 1989, seit 1976 Mitglied des Staatsrates, seit 1979 des Nationalen Verteidigungsrates. Rückritt von allen Funktionen Ende 1989, Ausschluss aus der SED-PDS im Januar 1990. 1995 Eintritt in die DKP
- ↑ Alfred Neumann (1909-2001), Tischler, Mitglied der KPD 1929 und seit 1919 des Arbeitersportvereins »Fichte«, 1934 Emigration in die Sowjetunion,1938 dort ausgewiesen, Teilnehmer des Spanienkrieges, 1942 vom Volksgerichtshof zu acht Jahren Haft verurteilt, Flucht aus dem SS-Strafbataillon Dirlewanger, nach sowjetischer Kriegsgefangschaft 1947 Rückkehr nach Berlin. Von 1951 bis 1953 Stellvertretender Oberbürgermeister von Berlin, von 1953 bis 1957 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung, Mitglied der Volkskammer von 1949 bis 1989, seit 1954 ZK-Mitglied, von 1957 bis 1961 Sekretär des ZK der SED, von 1961 bis 1965 Vorsitzender des Volkswirtschaftsrates und von 1965 bis 1968 Minister für Materialwirtschaft. Seit 1962 Mitglied des Präsidiums des Ministerrates, seit 1968 einer der beiden ersten Stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates. Ende 1989 Rücktritt von allen Funktionen, im Januar 1990 Ausschluss aus der SED-PDS.
- ↑ Legationsrat Tömmler war ein Vertreter der deutschen Botschaft in St. Petersburg vor dem Ersten Weltkrieg und engagierte sich auch später für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Deutschland und Sowjetrussland, wofür ihm Lenin persönlich dankte. In Nachkriegsdeutschland führte er für die Sowjetische Militäradministration ein Dolmetscherbüro, woraus später ein Unternehmen wurde, das er schließlich aus Altersgründen an die VOB Union verkaufte. Tömmler war mit Otto Nuschke eng befreundet.
- ↑ Andreas Hermes (1878-1964), promovierter Landwirt, von 1930 bis 1933 Präsident des Reichsverbandes der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften Raiffeisen sowie von 1928 bis 1933 Präsident der Vereinigung der deutschen Bauernvereine, 1931 umbenannt in Vereinigung der deutschen christlichen Bauernvereine. Nach dem Ermächtigungsgesetz der Nazis trat er von seinen Ämtern und seinem Reichstagsmandat zurück. Hermes wurde 1920 Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft, vom Oktober 1921 bis August 1923 leitete er das Reichsministerium der Finanzen. Von 1924 bis 1928 war er Mitglied des Preußischen Landtages, 1928 bis 1933 auch Mitglied des Reichstages. Nach Haft Emigration 1936 nach Südamerika, 1939 Rückkehr, Verhaftung nach dem 20. Juli 1944 (er war als Landwirtschaftsminister in einer Regierung Goerdeler vorgesehen) und am 11. Januar 1945 zum Tode verurteilt. Gründete nach der Befreiung die CDU in der Sowjetischen Besatzungszone, trat wegen der Bodenreform im Dezember 1945 als Parteivorsitzender zurück, ging nach Bonn. Von 1948 bis 1955 war er Präsident des Deutschen Bauernverbandes und bis 1961 auch des Deutschen Raiffeisen Verbandes der Westzonen sowie im Anschluss in der Bundesrepublik Deutschland. Da Hermes sich gegen die Integration der Bundesrepublik Deutschland in den Westen stellte, geriet er politisch mehr und mehr ins Abseits.
- ↑ Sergej I. Tulpanow (1901-1984), Berufsoffizier, 1927 KPdSU. Von 1941 bis 1945 war er Leiter der Politischen Abteilung an verschiedenen Frontabschnitten. Von Oktober 1945 bis September 1949 leitete er im Range eines Obersten die Propaganda- und Informations-Abteilung der SMAD. In dieser Funktion hatte er viele Kontakte zu den Politikern der KPD, SPD und (ab 1946) SED, namentlich zu Walter Ulbricht. Danach unterrichtete er als Generalmajor an der Leningrader Marineakademie, nach 1957 als ziviler Hochschullehrer an der Universität in Leningrad.
- ↑ Otto Nuschke (1883-1957), gelernter Buchdrucker, seit 1902 journalistische Tätigkeit, 1918 Mitbegründer der Deutschen Demokratischen Partei (DDP), in den 20er Jahren Stellvertretender Reichsvorsitzender, Mitbegründer des republiktreuen Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold, seit 1931 Generalsekretär der in Deutsche Staatspartei umbenannten DDP. In der Regierung Goerdeler nach dem erfolgreichen Attentat auf Hitler war er als Leiter des Rundfunks vorgesehen, Illegalität seit dem 20. Juli 1944. 1945 Mitbegründer der CDU in der SBZ. Auf dem III. Parteitag 1948 zum Parteivorsitzenden gewählt. Im März 1948 wurde er gemeinsam mit Wilhelm Pieck (SED) und Wilhelm Külz (LDPD) Vorsitzender des Deutschen Volksrates, der die Verfassung der DDR ausarbeitete. Im Jahre 1949 wurde er zunächst Mitglied der Provisorischen Volkskammer der DDR. Er gehörte anschließend bis zu seinem Tode der Volkskammer an. Von 1949 bis 1957 Stellvertretender Ministerpräsident der DDR.
- ↑ Wladimir S. Semjonow (1911-1992), Diplomat, 1940 Botschaftsrat in Berlin, 1944/45 mit der Nachkriegsplanung für Deutschland betraut, von 1946 bis 1953 Politischer Berater der Sowjetischen Militäradministration unter Wassili Sokolowski und Wassili Tschuikow. Im Juni 1953 wurde er, nach Auflösung der Sowjetischen Kontrollkommission, Chef der Hohen Kommission der UdSSR in Deutschland. Im September des gleichen Jahres erfolgte seine Ernennung zum sowjetischen Botschafter in der DDR. 1978 wurde Semjonow, als Nachfolger von Valentin Falin, zum sowjetischen Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland in Bonn berufen. 1986 trat er in den Ruhestand, sein Nachfolger wurde Julij Kwizinskij.
- ↑ Siehe dazu: »Einstimmung: Die Lage in der DDR 1961«, in: Heinz Keßler/Fritz Streletz, Ohne die Mauer hätte es Krieg gegeben, Berlin 2011, S. 9-38. Das Gespräch zwischen Ulbricht und Chruschtschow dolmetschte Werner Eberlein, die handschriftlichen Aufzeichnungen Ulbrichts befinden sich in dessen Nachlass im Bundesarchiv in Berlin-Zehlendorf, und in Moskau liegen die sowjetischen Protokolle vor. Eberlein reflektiert am 12. Dezember 2001 dieses Gespräch und die Weiterungen: »Niemand dachte daran, dass eine Mauer gebaut wird. Es sollte mit ein paar Rollen Stacheldraht abgesperrt werden, ein paar Durchlässe würden gemacht und jeder anständige Deutsche würde zur Volkspolizei gehen, sich ein Visum ausstellen lassen und damit die Grenze passieren. Wenn Ulbricht kurz vor dem Mauerbau in einem Pressegespräch gesagt hat: Wir haben keine Absicht, eine Mauer zu bauen, unsere Bauarbeiter sind für andere Dinge da, unterstellt man ihm heute, dass er das gesagt hat, um abzulenken. Ich glaube, er war überzeugt von dem, was er da gesagt hat, das war seine ehrliche Meinung, denn das war in Moskau verhandelt worden.« (vgl. »Berlin Moskau-Berlin. Werner Eberlein im Gespräch mit Joachim Heise und Marianne Regensburger«, in: Leben und Berlin – mit und ohne Mauer. Gespräche und Betrachtungen, verlag am park, Berlin 2003, S. 125)
- ↑ Genex war auf Regierungsanordnung am 20. Dezember 1956 als »Geschenkdienst- und Kleinexporte GmbH« gegründet worden. Dort konnten gegen Devisen Waren, die zum größten Teil aus DDR-Produktion stammten, erworben und verschenkt werden. Das Angebot richtete sich vor allem an BRD-Bürger, die ihren Verwandten eine Freunde machen wollten, aber auch an DDR-Bürger, die im Ausland – auch im sozialistischen – tätig waren. Vor allem wurden hochwertige Konsumgüter angeboten.
- ↑ Nichtsozialistisches Währungs-, auch Wirtschaftsgebiet
- ↑ Rudolf Lindau (1888-1977), in der Sowjetunion Paul Graetz, 1916 Spartakusbund, Gründungsmitglied der KPD, Redakteur verschiedener KPD-Organe, Abgeordneter der Hamburger Bürgerschaft und des Reichstages, Emigration in die Sowjetunion 1934, dort tätig als Historiker und Lehrer an Partei- und Antifa Schulen, 1945 Rückkehr nach Deutschland, von 1947 bis 1950 paritätischer Direktor der Parteihochschule »Karl Marx«, danach Mitarbeiter des Instituts für Marxismus Leninismus beim ZK der SED. Kontroverse mit Ulbricht, der im Unterschied zu Lindau die Novemberrevolution nicht als sozialistische, sondern als bürgerlich-demokratische Revolution bewertete.
- ↑ Franz Gold (1913-1977), gelernter Fleischer, KJV 1927, KPTsch 1932. Dienst in der tschechischen Armee, Verhaftung durch die Gestapo nach der Besetzung des Sudetenlandes. Bei Kriegsbeginn in die Naziwehrmacht gepresst, 1941 zur Roten Armee übergelaufen, Mitbegründer des NKFD. Beim slowakischen Nationalaufstand 1944 kommandierte er eine Partisaneneinheit. 1946 Übersiedlung in die sowjetisch besetzte Zone, Eintritt in die SED, Direktor des Deutschen Instituts für sozialökonomische Probleme 1947/48, danach Personaldirektor des Berliner Rundfunks in der Westberliner Masurenallee. 1950 Eintritt in das MfS und Leiter der Hauptabteilung Personenschutz (HA PS), in dieser Funktion bis 1974 tätig. Letzter Dienstgrad Generalleutnant.
- ↑ Heinz Hoffmann (1910-1985), Motorenschlosser, 1926 KJVD, 1930 KPD, 1935 Emigration in die Schweiz, Besuch der Leninschule in Moskau, 1936/37 der Offiziersschule in Rjasan, von 1937 bis 1938 Politkommissar des Beimler-Bataillons, Parteiname »Heinz Roth«. In Frankreich interniert, 1939 in die Sowjetunion, 1941 Besuch eines Sonderlehrgangs der Komintern in Puschkino bei Moskau. Von 1942 bis 1944 Lehrer an der Antifa-Schule in Krasnogorsk. Rückkehr nach Berlin 1946, zunächst persönlicher Mitarbeiter Piecks, später Walter Ulbrichts, von 1950 bis 1985 ZK-Mitglied und Volkskammerabgeordneter, von 1973 bis 1985 Politbüromitglied. Bewaffnete Organe seit 1950, von 1955 bis 1957 Studium an der Generalstabsakademie der UdSSR. Danach (bis 1960) Stellvertreter des Ministers für Nationale Verteidigung und Chef des Hauptstabes, in der Nachfolge Willi Stophs Verteidigungsminister.
- ↑ Herbert Grünstein (1912-1992), 1930 KJVD, 1931 KPD, 1933 Emigration nach Luxemburg, 1935 Palästina, von 1936 bis 1938 Internationale Brigaden in Spanien, Internierung in Frankreich von 1939 bis 1943, danach in die Sowjetunion. Im Mai 1945 wurde er Lehrer an der Antifaschule im Objekt 165, der späteren Zentralschule 2041 in Talizi.1948 Rückkehr nach Berlin, 1949 Eintritt in die Deutsche Volkspolizei, von 1957 bis 1973 1. Stellvertreter des Innenministers und Staatssekretär im MdI. Von 1974 bis 1984 war er stellvertretender Generalsekretär der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft (DSF), 1976 bis 1989 Vorsitzender des Bezirkskomitees Berlin der Antifaschistischen Widerstandskämpfer der DDR und Mitglied der SED-Bezirksleitung Berlin.
- ↑ Arthur Pieck (1899-1970), Sohn Wilhelm Piecks, 1916 Spartakusbund, Gründungsmitglied der KPD, 1922/23 Mitarbeiter der sowjetischen Handelsvertretung in Berlin. Seit 1927 Leiter des Arbeiter-Theater-Bunds Deutschland (ATBD), 1929 Mitbegründer des Internationalen Arbeiter-Theaterbunds (IATB), seit 1932 Internationaler Revolutionärer Theaterbund (IRTB). Er war mit Piscator und Gustav von Wangenheim eng befreundet und auch mit Hanns Eisler, Alfred Kurella, John Heartfield, Erwin Geschonneck und anderen Schriftstellern und Schauspielern gut bekannt. Ab 1938 arbeitete Pieck in der Moskauer Presseabteilung der Kommunistischen Internationale, seit 1941 Offizier in der Politischen Hauptverwaltung der Roten Armee. Dolmetscher des 1. Stadtkommandanten Berlins, Bersarin, 1946 im Berliner Magistrat, dann Personaldirekor bei der Deutschen Wirtschaftskommission und ab 1949 Leiter des Hauptamtes für Personalwesen und Schulung bei der Regierung. 1955 Direktor der DDR Lufthansa, später Interflug.
- ↑ Hans Mahle (1911-1999), 1926 KJVD, von 1932 bis 1935 Mitglied des ZK des KJVD, seit 1936 Emigration in die Sowjetunion, tätig bei der Kommunistischen Jugendinternationale, zwischen 1938 und 1941 Jugendredakteur beim Moskauer Rundfunk. Seit Dezember 1941 Antifa-Arbeit im Kriegsgefangenenlager »Spaski Sawod« in Karaganda. Im Ergebnis der positiven Auswertung seiner Tätigkeit in Karaganda wurde Mahle nach einer Tagung der Komintern in Ufa beauftragt, die Leitung des Jugendsenders »Sturmadler« zu übernehmen. Dieser Sender richtete sich direkt an die Hitlerjugend und junge Soldaten und war die Jugendsendung des »Deutschen Volkssenders«. Ab Frühjahr 1943 wirkte Mahle durch Besuche in Kriegsgefangenenlagern aktiv an der Vorbereitung des NKFD mit. Er nahm an der Gründungskonferenz des NKFD in Krasnogorsk am 12. und 13. Juni 1943 teil und wurde Vorsitzender der Jugendkommission des NKFD. Ab August technischer Leiter des Senders »Freies Deutschland«. Im Rahmen seiner Tätigkeit kam er dabei im November 1943 an der Front bei Kiew zum Einsatz. Mahle wurde 1937 die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, später wurde er sogar für seine antifaschistische Tätigkeit vom Reichskriegsgericht in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Rückkehr mit der Gruppe Ulbricht nach Deutschland. Von Juni 1945 bis September 1947 war Mahle Mitglied des ZK der KPD bzw. des Vorstandes der SED, von August 1945 bis Mai 1947 Mitglied des Präsidialrates des Kulturbundes. Ab 1946 leitete er das Rundfunkreferat und die Abteilung für kulturelle Aufklärung der Zentralverwaltung für Volksbildung, ab 1949 Generalintendant des »Deutschen Demokratischen Rundfunks«. 1951 mit Spionagevorwurf als Generalintendant abgesetzt und zur Bewährung nach Schwerin geschickt. 1956 rehabilitiert, Chefredakteur der Schweriner Volkszeitung, 1959 der Westberliner Wahrheit. 1962 Mitglied des Parteivorstandes der SED-Westberlin bzw. SEW, ab Mai 1970 Mitglied des Büros des PV der SEW.
- ↑ Erich Weinert (1890-1953), gelernter Lokomobilbauer, Kunststudium in Berlin, Offizier im Ersten Weltkrieg, danach Lehrer an der Magdeburger Kunstgewerbeschule, seit 1921 schriftstellerisch tätig. Mitbegründer des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller, 1929 KPD, Mitarbeiter der Roten Fahne. Zusammenarbeit mit Hanns Eisler und Ernst Busch seit 1930. 1933 Exil in der Schweiz, Frankreich, danach Sowjetunion, von 1937 bis 1939 in Spanien als Frontberichterstatter, Internierung in Frankreich, dann wieder Sowjetunion. 1943 Präsident des Nationalkomitees »Freies Deutschland«, 1946 Rückkehr nach Deutschland. Obgleich schwer lungenkrank arbeitete er als Vizepräsident der Zentralverwaltung für Volksbildung in der sowjetischen Besatzungszone.
- ↑ Hans Gossens (1921-1972), Gründungsmitglied des NKFD und Frontbevollmächtiger an der Brjansker Front, 1944/45 an der 1. Ukrainischen Front. 1945 KPD, 1946 SED, von 1946 bis 1955 Mitglied des FDJ-Zentralrats, 1948/49 Leiter der Jugendhochschule der FDJ am Bogensee, von 1951 bis 1955 Staatssekretariat für Hoch- und Fachschulwesen, 1956 Eintritt in die Bewaffneten Organe, zunächst Grenzpolizei, ab 1960 Oberst der NVA. Von 1963 bis 1972 Stellvertretender Leiter der Politischen Hauptverwaltung der NVA.
- ↑ Wjatscheslaw M. Molotow (1890-1986) gehörte seit 1926 dem Politbüro des ZK der KPdSU an. Er war von 1930 bis 1941 Vorsitzender des Rates der Volkskommissare, also Regierungschef der Sowjetunion. Von 1939 bis 1949 war er Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten und von 1953 bis 1956 sowjetischer Außenminister. Nach dem XX. Parteitag wurde er aus dem ZK ausgeschlossen und von 1957 bis 1960 Botschafter in der Mongolei. Von 1960 bis 1962 vertrat er die UdSSR bei der Internationalen Atomenergieorganisation. 1962 wurde Molotow aus der KPdSU ausgeschlossen.
- ↑ Anastas I. Mikojan (1895-1978), seit 1920 Mitglied des Politbüros des ZK der KP von Aserbaidschan, seit 1923 Mitglied des ZK der KPdSU, von 1935 bis 1966 des Politbüros. Von 1926 bis 1946 war er Volkskommissar für Binnen- und Außenhandel, für Versorgung, für die Nahrungsmittelindustrie und für Außenhandel der UdSSR. Von 1937 bis 1946 war er Stellvertretender Vorsitzender des Rates der Volkskommissare, danach Stellvertretender Vorsitzender des Ministerrats. Von 1955 bis 1964 Erster Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrats. Mikojan gilt als ein Hauptakteur beim Sturz Chruschtschows 1964 und war von 1964 bis 1965 Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets und damit Staatsoberhaupt der Sowjetunion.
- ↑ Georgi M. Malenkow (1902-1988), war seit 1938 Stalins Persönlicher Sekretär und wurde 1946 gemeinsam mit Berija Politbüromitglied. Nach dem Tode Stalins bestimmte das Politbüro Malenkow im März 1953 zum Ersten Sekretär des ZK der KPdSU und Vorsitzenden des Ministerrates der UdSSR. Wenig später musste er jedoch den Parteivorsitz an Nikita S. Chruschtschow abgeben, 1955 wurde er auch als Ministerpräsident abgelöst. Sein Nachfolger in diesem Amt, Nikolai Bulganin, machte ihn zum Minister für Kraftwerke und Elektroindustrie. Am 29. Juli 1957 wurde Malenkow nach einem Putschversuch gegen Chruschtschow zusammen mit Molotow, Kaganowitsch und Schepilow aus dem Politbüro ausgeschlossen, aller Staats- und Parteiämter enthoben und zum Leiter eines Kraftwerkes in Kasachstan degradiert. 1961 wurde er aus der KPdSU ausgeschlossen.
- ↑ Nikolai A. Bulganin (1895-1975), von 1931 bis 1940 Bürgermeister von Moskau, seit 1934 Mitglied des ZK der KPdSU, 1946 Kandidat des Politbüros, 1947 Marschall der Sowjetunion. Von 1947 bis 1949 und erneut von 1953 bis 1955 Verteidigungsminister , von 1955 bis 1958 Ministerpräsident der UdSSR. 1958 Ausschluss aus dem ZK und Präsident der Staatsbank, zum Generaloberst degradiert.
- ↑ Semjon M. Budjonny (1883-1973) kämpfte an der Spitze der 1. Roten Reiterarmee gegen Denikin und im Polnisch-Sowjetischen Krieg 1920. Im Zweiten Weltkrieg war er Oberfehlshaber der Südwestfront und der Kaukasusfront.
- ↑ Wassilij D. Sokolowski (1897-1968), erst Stabschef unter Shukow, dann Oberbefehlshaber der 1. Ukrainischen Front, von 1946 bis 1949 Oberkommandierender der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland, von 1953 bis 1960 stellvertretender Verteidigungsminister der Sowjetunion.
- ↑ Bereits am 15. Mai 1955 war in Wien von den vier Mächten ein »Staatsvertrag betreffend die Wiederherstellung eines unabhängigen und demokratischen Österreich« unterzeichnet worden, was zum Rückzug der Besatzungstruppen führte.
- ↑ Das Parlament der FDJ war das höchste Organ des Jugendverbandes. Es trat alle vier bis fünf Jahre zusammen und wählte die Führungsgremien.
- ↑ Ilko-Sascha Kowalczuk: Die Niederschlagung der Opposition an der veterinärmedizinischen Fakultät der Humboldt Universität zu Berlin in der Krise 1956/57. Schriftenreihe des Landesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit der DDR, Berlin 1997, Heft 6.
- ↑ Die Parteizentrale der SPD. Die Partei hatte 1951 ein barackenähnliches Gebäude in Bonn erworben und wollten damit das Provisorische unterstreichen, für die SPD war Berlin Hauptstadt und damit der einzig zulässige Sitz der Parteiführung. Das Haus wurde 1974 abgerissen, die SPD-Zentrale zog in einen Neubau, das Erich-Ollenhauer-Haus, der Name »Bonner Baracke« blieb dennoch Synonym für die SPD-Führung, 1999 erfolgte der Umzug nach Berlin.
- ↑ In diesem Zusammenhang halte ich einen Hinweis auf die Verwendung der Worte »Sozialismus« und »sozialistisch« für angebracht. Hitler und seine faschistischen Horden heißen im bundesdeutschen Sprachgebrauch Sozialisten (ohne Anführungszeichen). Walter Ulbricht, der den Namen »Sozialist« verdiente, nennen sie hingegen einen »Stalinisten«. Das politische System des Nazireiches nennen sie mit dem von den Faschisten selbst gewählten Eigennamen »Nationalsozialismus«. Und sie schämen sich nicht, und ignorieren, dass sie die Einzigen in der Welt sind, die den deutschen Faschismus »Nationalsozialismus« nennen. Dem politischen System der DDR und der anderen sozialistischen Staaten wurde der von ihnen gewählte Eigenname nicht zugebilligt. Nicht »Sozialismus« und »sozialistisch« werden sie genannt, sondern »Stalinismus« und »stalinistisch«. Der für die Periode nach dem XX. Parteitag der KPdSU 1956 übliche Begriff »Entstalinisierung« – was nicht nur Umbenennung von Ortschaften und Straßen bedeutete – ist hierzulande unüblich. Über die sozialistischen Länder soll der Schatten der Stalinschen Verbrechen gebreitet werden. In der DDR habe es Schlechtes und Gutes gegeben, »aber strukturell« sei sie stalinistisch gewesen. Die Absage an den Stalinismus gehörte zum Grundkonsens der PDS, ist immer wieder zu hören. Wenn schon das Gesellschaftssystem des untergegangenen europäischen Sozialismus mit dem Namen einer Person definiert werden soll – ohnehin ein singulärer Fall in der Historiografie –, warum dann gerade der Name Stalins? Und nicht der von Marx? Weil dann nämlich »Stalinismus« als antisozialistischer Kampfbegriff verloren ginge.
- ↑ Günter Mittag (1926-1994), Eintritt in die KPD 1945, seit 1947 im Parteiapparat tätig. 1958 Sekretär der Wirtschaftskommission beim Politbüro, 1962 ZK-Mitglied, 1963 Leiter des Büros für Industrie- und Bauwesen des ZK. Gemeinsam mit Erich Apel konzipiert er das auf dem VI. Parteitag beschlossene Neue Ökonomische System der Planung und Leitung. 1966 Mitglied des Politbüros, von 1962 bis 1973 und wieder ab 1976 ZK-Sekretär für Wirtschaft. Mitglied der Volkskammer von 1963 bis 1989, des Staatsrates (von 1979 bis 1989), von 1982 bis 1989 des Nationalen Verteidigungsrates. Im Oktober 1989 Entbindung von allen Funktionen und am 23. November 1989 Ausschluss aus der SED. Nach kurzer Untersuchungshaft Entlassung aus gesundheitlichen Gründen. Aus den gleichen Gründen wurde eine Klage wegen Veruntreuung 1992 eingestellt.
- ↑ Nikita S. Chruschtschow (1894-1971), Maschinenschlosser, 1918 Eintritt in die Kommunistische Partei und in die Rote Armee. Parteifunktionär seit 1925, erste Begegnung mit Stalin auf dem XIV. Parteitag 1925. 1933 Parteichef von Moskau, Mitglied des ZK von 1934 bis 1966, Mitglied des Politbüros von 1939 bis 1964. Erster Sekretär des ZK der KP der Ukraine von 1938 bis 1949, danach, bis 1953, Sekretär des ZK der KPdSU. Von 1953 bis 1964 Erster Sekretär, seit 1958 auch Ministerpräsident der UdSSR. Am 14. Oktober 1964 als Staats- und Regierungschef abgelöst.
- ↑ Leonid I. Breshnew (1906-1982), Eintritt in die KPdSU 1931, 1939 Sekretär des Gebietskomitees von Dnepropetrowsk, Politkommissar im Großen Vaterländischen Krieg, von 1950 bis 1952 Erster Sekretär des ZK der KPdSU der Moldauischen Sowjetrepublik. Seit 1956 ZK-Sekretär und Mitglied des Politbüros. Von 1960 bis 1964 Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets und damit Staatsoberhaupt der Sowjetunion. Ab 1964 Erster, seit 1966 Generalsekretär des ZK der KPdSU. Ende 1974 stellten die Ärzte bei Breschnew eine beginnende Hirngefäßverkalkung fest. In seinen letzten Lebensjahren erlitt Breschnew mehrere Schlaganfälle und Herzinfarkte, die seine intellektuelle Aufnahmefähigkeit stark herabsetzten. Er wurde trotzdem als Generalsekretär immer wiedergewählt.
- ↑ Wolfgang Berger (1921-1994), Lehre als kaufmännischer Angestellter in Leipzig, nach amerikanischer Kriegsgefangenschaft Eintritt in die KPD, Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Leipzig, Promotion, Referent in der Hauptabteilung Finanzen der Deutschen Wirtschaftskommission und anschließend wirtschaftspolitischer Mitarbeiter in der Regierungskanzlei der DDR. Von 1951 bis 1953 Leiter der Abteilung Planung und Finanzen des ZK der SED und anschließend (bis 1971) persönlicher Referent Walter Ulbrichts, danach Abteilungsleiter in der Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik der DDR.
- ↑ Die Beziehungen zwischen den Familien Fenske und Ulbricht sind älteren Datums. Walter Ulbricht kannte Elsa Fenske, die Mutter von Kurt Fenske, aus der gemeinsamen Parteiarbeit vor 1933. Elsa Fenske schloss sich nach ihrer Befreiung aus dem Zuchthaus Jauer durch die Rote Armee der in Dresden tätigen »Gruppe Ackermann« an und wurde drei Wochen nach Kriegsende Stadtrat für Sozialwesen in Dresden, später – als Ministerialdirektor – Leiterin des Sozialwesens im Land Sachsen. Ende 1946 wollte Elsa Fenske, wie viele andere ehemalige Widerstandskämpfer auch, ein Waisenkind adoptieren. Sie suchte auch in verschiedenen Waisenhäusern nach einem Mädchen, stellte aber diesen Wunsch dann zurück, weil sie wegen der enormen Arbeitsbelastung nicht die erforderliche Zeit für das Kind hätte aufbringen können. In jener Zeit hatte sich Walter Ulbricht mit dem gleichen Wunsch an Elsa Fenske gewandt, und diese vermittelte die im Mai 1944 in Leipzig geborene Tochter einer sowjetischen Zwangsarbeiterin namens Maria Pestunowa, die sie ursprünglich selbst adoptieren wollte. Von Seiten des zuständigen sächsischen Sozialamtes bestanden keine Einwände: Walter Ulbricht lebte mit Lotte Kühn in einer Ehegemeinschaft, und zur Familie gehörten zudem die Mutter und die Schwester von Lotte Kühn, die mit im Hause lebten. Nur die sowjetischen Behörden waren ein wenig zögerlich: Obgleich »Beate« bereits geraume Zeit in der Familie Ulbricht lebte, erteilte Moskau erst im Sommer 1950 der Adoption die Zustimmung. Erstmals im März 1947 hatte Lotte Ulbricht pflichtgemäß dem Dresdner Jugendamt Bericht über die Entwicklung der kleinen Beate gegeben. Sie sei ein außerordentlich liebenswertes Kind, immer freundlich, dabei temperamentvoll und energisch, fantasiebegabt und sehr intelligent. Der Bericht, so Fenskes Mutter, habe deutlich gemacht, wie sehr sich die Pflegeeltern Ulbricht um ihre Tochter gekümmert hätten.
- ↑ Der transferable Rubel, am 22. Oktober 1963 beschlossen, war eine »Währung« zur Verrechnung von Verbindlichkeiten, zur internationalen Warenwertbestimmung und als Einheit in bilateralen Handelsverträgen zwischen den staatlichen Planungsbehörden und Regierungen, die dem RGW angehörten. Der festgelegte Kurs betrug 1 Transferrubel = 4,67 Mark der DDR.
- ↑ Der 1949 gegründete Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW) war eine Antwort auf die Intergration der westeuropäischen Staaten. Gründungsmitglieder waren neben der Sowjetunion Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn und die Tschechoslowakei. Am 23. Februar 1949 trat Albanien dem Bündnis bei (dessen Mitgliedschaft später ruhte), am 29. September 1950 folgte die DDR (bis 1990). Die Mongolei (6. Juli 1962), Kuba (1972) und Vietnam (1978) wurden später ebenfalls Mitglieder. Am 17. September 1964 trat Jugoslawien einigen Organen des RGW bei. China (bis 1961) und Nordkorea hatten Beobachterstatus. Im November 1986 nahmen Delegierte aus der Demokratischen Republik Afghanistan, Angola, Äthiopien, der Volksdemokratischen Republik Jemen (Südjemen), Laos, Mosambik und Nicaragua als Beobachter an einem Treffen teil. Am 16. Mai 1973 unterzeichnete Finnland ein Kooperationsabkommen mit dem RGW, 1975 folgten dann der Irak und Mexiko, Nicaragua 1984, Mosambik 1985. Angola, Äthiopien und die Volksdemokratische Republik Jemen folgten 1986 und Afghanistan 1987. Mit dem Ende der Sowjetunion löste sich auch der RGW am 28. Juni 1991 auf.
- ↑ Mit dieser Viermächte-Vereinbarung vom 4. Mai 1949, unterzeichnet für die USA von Philip Jessup und von Jakow A. Malik, daher Jessup Malik-Abkommen, wurden alle Beschränkungen gegeneinander aufgehoben, womit die »Blockade« endete. Das schloss die Wirtschaftssanktionen gegen die Ostzone ein.
- ↑ Das »Berliner Abkommen« war am 20. September 1951 von Unterhändlern der BRD und der DDR unterzeichnet worden, es regelte den sogenannten Interzonenhandel. Diese Vereinbarung floss in den Grundlagenvertrag von 1972 ein, in dem es hieß: »Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik wird auf der Grundlage der bestehenden Abkommen entwickelt. Die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik werden langfristige Vereinbarungen mit dem Ziel abschließen, eine kontinuierliche Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen zu fördern.«
- ↑ Swing bezeichnete einen vereinbarten Überziehungskredit im bilateralen Außenhandel. Beim gegenseitigen Warenaustausch war eine Summe beziffert, mit der man in Rückstand geraten konnte. Bei Überschreiten dieses Betrages waren entweder Zahlungen und Devisen fällig oder weitere Lieferungen wurden gestoppt. Die im ersten Jahr 1962 eingeräumte Kreditlinie betrug 200 Millionen, von denen in den ersten drei Jahren weit weniger als die Hälfte ausgeschöpft wurde. 1970 wurde erstmals die inzwischen eingeräumte Kreditlinie von knapp 400 Millionen Verrechnungseinheiten von der DDR überschritten.
- ↑ Gosplan war das Komitee für die Wirtschaftsplanung der Sowjetunion, vergleichbar mit der Staatlichen Plankommission in der DDR. Es war per Dekret des Rates der Volkskommissare der RSFSR am 22. Februar 1921 gegründet worden.
- ↑ Lieselotte Thoms (1920-1992), Journalistin, Chefreporterin des Neuen Deutschland und von 1968 bis 1981 Chefredakteurin der Frauenzeitschrift für dich. Von 1963 bis 1990 Volkskammerabgeordnete für den DFD. 1968 Mitglied der Frauenkommission beim Politbüro des ZK der SED.
- ↑ Max Volmer (1885-1965), Chemiker mit dem Schwerpunkt Physikalische Chemie (Reaktionskinetik), der im August 1945 mit einer Spezialistengruppe um Gustav Hertz nach Agudzera bei Suchumi kam. Dort wirkte er im Rahmen des sowjetischen Atombombenprojektes an der Einrichtung einer Anlage zur Herstellung von Schwerem Wasser mit. Zusammen mit Gustav Richter gelang ihm der Aufbau eines entsprechenden Ammoniak Destillationsturmes in Norilsk. 1955 kehrte in die DDR zurück, übernahm eine Professur an der Humboldt-Universität zu Berlin und wurde Mitglied des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie beim Ministerrat der DDR. Von 1955 bis 1958 war er Präsident, bis 1963 Vizepräsident der Deutschen Akademie der Wissenschaften, 1957 Gründungsmitglied des Forschungsrates der DDR.
- ↑ Gustav Hertz (1887-1975), Nobelpreis für Physik 1925, die Nazis entzogen ihm das Lehramt wegen seiner jüdischen Abstammung. Im August 1945 mit Max Steenbeck und anderen Atomwissenschaftlern nach Suchumi. 1951 Stalinpreis.1954 Rückkehr in die DDR, 1955 Leiter des Wissenschaftlichen Rates für die friedliche Anwendung der Atomenergie beim Ministerrat der DDR. Direktor des physikalischen Instituts an der Karl-Marx Universität in Leipzig, Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR und 1957 Gründungsmitglied des Forschungsrates der DDR sowie Nationalpreisträger. Er war der einzige Nobelpreisträger der DDR, korrekter: der einzige Wissenschaftler, der nach der Preisverleihung in der DDR arbeitete.
- ↑ Peter Adolf Thiessen (1899-1990), Chemiker, von 1935 bis 1945 Direktor des Kaiser-Wilhelm-Instituts für physikalische Chemie und Elektrochemie in Berlin-Dahlem. Zusammen mit Gustav Hertz, Max Volmer und Manfred von Ardenne seit 1945 tätig am sowjetischen Atombombenprojekt. Stalinpreis 1951 1956 Rückkehr in die DDR, danach, bis 1964, Direktor des Instituts für physikalische Chemie der Akademie der Wissenschaften der DDR. Das Präsidium der Deutschen Akademie der Wissenschaften der DDR hob die 1945 getroffene Entscheidung über seinen Ausschluss aus der Akademie 1955 wieder auf. Von August 1957 bis 1965 war er Vorsitzender, darauf Ehrenvorsitzender des Forschungsrates der DDR. Von September 1960 bis November 1963 gehörte Thiessen als Parteiloser dem Staatsrat der DDR an. Er erhielt den Staatspreis der UdSSR, den Lenin-Orden und den Rotbannerorden und gehörte auch der sowjetischen Akademie der Wissenschaften an.
- ↑ Manfred von Ardenne (1907-1997), Forscher in der angewandten Physik mit rund 600 Erfindungen und Patenten in der Funk- und Fernsehtechnik, Elektronenmikroskopie, Nuklear-, Plasma- und Medizintechnik. Ihm gelang 1930 die weltweit erste vollelektronische Fernsehübertragung mit Kathodenstrahlröhre. Seit 1945 arbeitete er in der Sowjetunion. Rückkehr in die DDR, wo er in Dresden auf dem Weißen Hirsch sein nach ihm benanntes Forschungsinstitut gründete, mit 500 Mitarbeitern war es das größte privat geführte Unternehmen dieser Art in den sozialistischen Staaten. Volkskammerabgeordneter bis 1990. 1947 Stalinpreis, zweimal Nationalpreis der DDR, 1989 Ehrenbürger der Stadt Dresden.
- ↑ Friedrich Paulus (1890-1957), deutscher Militär, Befehlshaber der 6. Armee, die 1943 im Kessel von Stalingrad unterging. Noch im Kessel ernannte ihn Hitler zum Generalfeldmarschall. Zeuge im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess 1946. 1953 Entlassung aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft. Er wandte sich gegen die Bonner Politik der Spaltung und gegen deren Westintegration.
- ↑ Klaus Fuchs (1911-1988), Kernphysiker, der als Kommunist 1933 nach Großbritannien uns Exil ging, wo er seit 1941 am britischen Atomprogramm arbeitete. 1943 Übersiedlung in die USA und Fortsetzung der Arbeiten. Er war maßgeblich an der Entwicklung der Plutoniumbombe »Fat Man« beteiligt, die am 9. August 1945 gegen Nagasaki eingesetzt wurde. Seit 1942 arbeitete er für die sowjetische Militäraufklärung, sein Kurier war Ruth Werner. 1950 wegen Spionage zu 14 Jahren Haft verurteilt. 1959 begnadigt und in die DDR ausgereist, obwohl man ihm im Westen einige gut dotierte Posten anbot. Mitglied der SED seit 1967, seit 1972 des Präsidiums der Akademie der Wissenschaften der DDR, die ihm 1974 bis 1978 die Leitung des Forschungsbereiches Physik, Kern- und Werkstoffwissenschaften übertrug. Ab 1984 Leiter der Wissenschaftlichen Räte für energetische Grundlagenforschung und für Grundlagen der Mikroelektronik. Nationalpreisträger 1975. 1983 Mitglied des Komitees für wissenschaftliche Fragen der Sicherung des Friedens und der Abrüstung sowie Ehrenmitglied des Forschungsrats der DDR.
- ↑ Max Steenbeck (1904-1981), Physiker, von 1927 bis 1945 Leiter der Wissenschaftlichen Abteilung der Siemens-Schuckert-Werke, danach von 1945 bis 1956 Arbeit am sowjetischen Atomprogramm, in Jena leitete er von 1956 bis 1960 das Institut für magnetische Werkstoffe, bis 1969 Direktor des daraus hervorgegangenen Instituts für Magnetohydrodynamik. Seit 1957 war er Mitglied des Forschungsrates der DDR, seit 1965 dessen Vorsitzender und ab 1978 bis zu seinem Tode Ehrenvorsitzender. Seit 1956 Ordentliches Mitglied der Akademie der Wissenschaften der DDR, von 1962 bis 1966 deren Vizepräsident. Seit 1966 Auswärtiges Mitglied der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften. von 1970 Präsident des DDR Komitees für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und nahm in dieser Eigenschaft an den Konferenzen in Helsinki teil. Er war Mitglied des Präsidiums des Friedensrates der DDR. Nationalpreis der DDR 1959 und 1971, 1977 Alfried-Krupp-von-Bohlen-und-Halbach Preis für Energieforschung. seit 1969 Ehrenbürger der Stadt Jena.
- ↑ Hermann Klare (1909-2003), Chemiker, nach dem Krieg Betriebsleiter in chemischen Fabriken in Premnitz und Schwarza. Von 1947 bis 1949 wirkte er in der Stadt Klin in der Sowjetunion beim Aufbau einer Kunstseiden Produktionsanlage mit, die als Reparationsleistung aus Landsberg an der Warthe in die UdSSR gebracht worden war. 1949 Betriebsleiter, ab 1951 Direktor des VEB Kunstfaserwerk Schwarza. 1953 Institut für Faserstoff-Forschung der Deutschen Akademie der Wissenschaften, von 1961 bis 1969 Institutsdirektor. Von 1954 bis 1961 auch Professor an der Technischen Hochschule für Chemie Leuna-Merseburg und von 1962 bis 1964 an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seit 1961 Vorsitzender der Forschungsgemeinschaft der naturwissenschaftlichen, technischen und medizinischen Institute der Deutschen Akademie der Wissenschaften. Von 1963 bis 1968 Vizepräsident der AdW, von 1968 bis 1979 Präsident, von 1979 bis 1984 erneut Vizepräsident. Zudem von 1980 bis 1988 Vorsitzender der AdW-Klasse Chemie. Nationalpreis der DDR 1951 und 1963.
- ↑ Kurt Schwabe (1905-1983), Chemiker, Pionier der elektrochemischen Sensorik. 1945 gründete er das »Forschungsinstitut für chemische Technologie« (heute: Kurt Schwabe-Institut) in Meinsberg, 1949 Professor an der TU Dresden. Von 1959 bis 1969 Direktor des »Institut für Radiochemie« im Zentralinstitut für Kernforschung in Rossendorf und von 1961 bis 1965 Rektor der Technischen Universität Dresden. Von 1965 bis 1980 Präsident der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, 1971 Vizepräsident der Akademie der Wissenschaften der DDR, von 1980 bis zu seinem Tode auch Vizepräsident der »International Society of Electrochemistry«. 1961 Nationalpreis der DDR, 1982 Ehrenbürger der Stadt Reichenbach im Vogtland. Die Sächsische Akademie der Wissenschaften vergibt seit 1983 den Kurt Schwabe-Preis »zur Würdigung hervorragender wissenschaftlicher oder technischer Leistungen und hoher Verdienste zur Erhaltung der Natur und ihrer Ressourcen«.
- ↑ Kaiser-Wilhelm-Institut, Bezeichnung einer Reihe wissenschaftlicher Institute in Deutschland vor dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945 Max-Planck-Institut. Am Berliner Kaiser-Wilhelm-Institut für Physik entdeckten Otto Hahn und Fritz Straßmann 1938 die Kernspaltung. Thiessen leitete das 1911 in Berlin-Dahlem gegründete Kaiser-Wilhelm Institut für physikalische Chemie und Elektrochemie.
- ↑ Robert Rompe (1905-1993), Physiker, KPD 1932, seit 1935 Mitarbeiter der sowjetischen Militäraufklärung GRU. Von 1933 bis 1936 gehörte der illegalen Gruppe von Hermann Ulfert an, später hatte er auch Kontakte zu anderen Widerstandsgruppen. Von 1935 bis 1945 wiederholt inhaftiert und verhört. Von 1939 bis 1945 Biophysiker am Kaiser Wilhelm-Institut für Genetik in Berlin-Buch. Von 1945 bis 1949 Leiter der Hauptabteilung für Hochschulen und wissenschaftliche Institutionen in der Zentralverwaltung für Volksbildung, von 1946 bis 1949 Mitglied des Parteivorstandes der SED. Von 1949 bis 1970 Leiter des Physikalisch-Technischen Instituts der AdW. Rompe verlor im Zusammenhang mit der Noel-Field-Affäre alle politischen Ämter, wurde jedoch nach Stalins Tod vollständig rehabilitiert. Mitglied des ZK der SED seit 1958. Von 1957 bis 1990 Mitglied des Forschungsrates. Von 1963 bis 1968 stellvertretender und amtierender Generalsekretär der AdW. Nationalpreis 1951.
- ↑ Die Volkskongressbewegung war einerseits die Antwort auf die Spaltungstendenzen der Westmächte und ihrer politischen Verbündeten in den westlichen Besatzungszonen und andererseits der notwendige wie legitime Versuch, auf den Trümmern des Nazireiches eine antifaschistisch-demokratische Ordnung in einem gemeinsamen Deutschland zu schaffen. Im Dezember 1947 kamen Delegierte aus allen Besatzungszonen in Berlin zum 1. Volkskongress zusammen. Die Initiative ging wie schon bei der landesweiten Diskussion eines im November 1946 vorgelegten Entwurfs einer »Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik« – von der SED aus
- ↑ Bernard Koenen (1889-1964), SPD seit 1907, KPD seit 1920. Während der Novemberrevolution war er stellvertretender Vorsitzender des Arbeiterrates der Leuna Werke und aktiv an den bewaffneten Kämpfen in Mitteldeutschland beteiligt. Seit 1923 gehörte er der KPD-Zentrale in Berlin an. Die Nazis schlugen ihn während des »Eislebener Blutsonntags« am 12. Februar 1933 zusammen, dabei verlor er ein Auge. Emigration und 1937 Opfer der »Parteisäuberungen« in der Sowjetunion, ab 1941 tätig beim Deutschen Volkssender in Moskau, Mitbegründer der SED, bis 1964 ZK-Mitglied, von 1946 bis 1952 Fraktionschef im Landtag von Sachsen-Anhalt, danach Botschafter in der Tschechoslowakei, von 1958 bis zu seinem Tod 1. Sekretär der Bezirksleitung der SED Halle. Mitglied des Staatsrates seit 1960.
- ↑ Rudolf Agsten (1926-2008) kam 1946 aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft, wo er bereits der Liberaldemokratischen Partei beigetreten war. Von 1948 bis 1953 Chefredakteur, später Sekretär des Zentralvorstandes der LDPD. Fraktionschef in der Volkskammer von 1954 bis 1989. Im Oktober 1989 schied Agsten aufgrund eines Herzinfarktes aus allen gesellschaftlichen Funktionen aus.
- ↑ Gerald Götting, Jahrgang 1923, gehörte seit Januar 1946 der CDU in Halle an. Er studierte von 1947 bis 1949 an der Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg Philologie, Germanistik und Geschichte. Von 1949 bis 1966 war er als Nachfolger von Georg Dertinger Generalsekretär und bis 1989 als Nachfolger von August Bach Vorsitzender der CDU. Von 1960 bis 1989 war er zudem Stellvertretender Staatsratsvorsitzender. Präsident der Volkskammer von 1969 bis 1976. Am 2. November 1989 trat Götting als CDU Vorsitzender zurück, wurde am 7. November aus dem Staatsrat abberufen . Im Februar 1991 trat er aus der CDU aus.
- ↑ Hans-Dietrich Genscher, Jahrgang 1927, studierte nach dem Krieg Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft in Halle (Saale) und Leipzig und arbeitete danach als Referendar im Oberlandesgerichtsbezirk Halle. 1952 ging er in die BRD. Genscher trat 1944 – angeblich ohne sein Wissen – in die NSDAP ein, 1946 in die LDP. Über mehrere Stationen wurde er 1968 zum stellvertretenden, 1974 zum Bundesvorsitzenden der Liberalen (bis 1985) gewählt. Von 1974 bis 1992 Bundesaußenminister und Vizekanzler.
- ↑ Kurt Schumacher (1895-1952), Kriegsfreiwilliger am 2. August 1914, vier Monate später verlor er den rechten Arm. Jurastudium in Halle, Leipzig und Berlin, Eintritt in die SPD 1918. Landtagsabgeordneter 1923-1931, Vorsitzender der SPD in Stuttgart 1930 und 1930 Reichstagsabgeordneter, von 1933 bis 1945 KZ-Aufenthalte mit wenigen Unterbrechungen. In der britischen Zone begann er unmittelbar nach seiner Befreiung mit dem Wideraufbau der SPD, im Oktober 1945 wurde er auf der erste zentralen Zusammenkunft von Sozialdemokraten aus den drei Westzonen in Wennigsen bei Hannover mit dem Aufbau der SPD in den Westzonen beauftragt. Otto Grotewohl vom Berliner Zentralausschuss der SPD durfte dort erst nach Protest reden. Grotewohl und die Sozialdemokraten, welche eine vereinigte Arbeiterpartei wollten, sowie die Kommunisten nannte Schumacher »Interessenvertreter einer auswärtigen Macht«. Vier Wochen nach der Vereinigung von SPD und KPD zur SED wurde Schumacher mit 244 von 245 Stimmen zum Parteivorsitzenden der SPD in den drei westlichen Besatzungszonen gewählt. Im ersten Bundestag wurde der bekennende Antikommunist Oppositionsführer. 1949 kandidierte Schumacher bei den Wahlen zum Amt des Bundespräsidenten, unterlag aber dem FDP-Kandidaten Theodor Heuss.
- ↑ Wilhelm Pieck (1876-1960), Tischler, SPD 1895, Gründungsmitglied der KPD 1918, 1921 Mitglied des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale, ab 1931 Präsidiumsmitglied, Exil 1933 bis 1945, erst Frankreich, dann Sowjetunion. 1935 wurde er auf der Brüsseler Konferenz der KPD zum Parteivorsitzenden für die Dauer der Inhaftierung Thälmanns gewählt. Ko Vorsitzender (mit Grotewohl) der SED seit ihrer Gründung. Von 1949 bis zu seinem Tod erster (und einziger) Präsident der DDR.
- ↑ Friedensvertrag mit Deutschland: Krieg und Faschismus endeten mit der bedingungslosen Kapitulation des Hitlerstaates am 8. Mai 1945. Das Potsdamer Abkommen regelte den Besatzungsstatus der vier Hauptsiegermächte. Alle späteren Versuche unter den Bedingungen der deutschen Zweistaatlichkeit, zu einem gemeinsamen Friedensvertrag zu kommen, scheiterten an der destruktiven Politik der Westmächte. Faktisch stellte der sogenannte 4+2-Vertrag vom September 1990 diesen Friedensvertrag dar: Er stellte die Souveränität der beiden deutschen Staaten her, legte die Grenzen endgültig fest und klärte alle offenen Fragen. Erst mit diesem Votum der Siegermächte war die völkerrechtliche Herstellung der staatlichen Einheit Deutschlands möglich.
- ↑ Die 2. Parteikonferenz der SED im Sommer 1952 beschloss den Aufbau der Grundlagen des Sozialismus in der DDR, was nicht nur politische Konsequenzen, sondern auch administrative Folgen hatte. So wurde die föderale Struktur mit der Auflösung der fünf ostdeutschen Länder beendet, an ihre Stelle traten 15 Bezirke.
- ↑ Beate Ulbricht (1944-1991), Tochter einer ukrainischen Zwangsarbeiterin und eines unbekannten Leipzigers, war im Januar 1946 von den Ulbrichts aus einem Waisenheim adoptiert worden. Beate besuchte seit 1954 eine Russisch-Spezialschule in Berlin-Pankow, 1959 ging sie nach Leningrad, wo sie das Abitur machte. Dort begann sie auch Geschichte und Russisch zu studieren. Nach zwei kurzen ehelichen Verbindungen, der Geburt einer Tochter und eines Sohnes, Studienunterbrechungen und wechselnden Lebensorten und Tätigkeiten, dem Entzug des Sorgerechts für die Kinder in den späten 70er Jahren verlor sich ihr Leben in Alkohol und Asozialität. Sie wurde Ende 1991 in ihrer Wohnung in Berlin-Lichtenberg erschlagen, der Mord ist bis heute nicht aufgeklärt.
- ↑ Lawrenti P. Berija (1899-1953), seit 1938 Volkskommissar für Inneres (NKWD), bildete nach dem Überfall Hitlerdeutschlands 1941 zusammen mit Stalin, Molotow, Woroschilow und Malenkow das Staatliche Verteidigungskomitee, das während des Großen Vaterländischen Krieges die Regierung ersetzte. Nach dem Krieg war Marschall Berija u. a. für das sowjetische Atombombenprogramm verantwortlich. Nach Stalins Tod am 5. März 1953 wurde er Erster Stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister unter Georgi Malenkow.
- ↑ August von Mackensen (1849-1945), Sohn eines sächsischen Gutsverwalters, Besuch des Staatlichen Gymnasiums in Torgau, das – bevor es zur Erweiterten Oberschule »Ernst Schneller« wurde – Mackensen-Gymnasium hieß. Nach Feldzügen in Polen und auf dem Balkan (»Serbenschlächter«) war er von 1916 bis 1918 Militärgouverneur in Rumänien. Als Vertreter der Dolchstoßlegende und Feind der Republik von Weimar wurde er von den Faschisten umworben. Noch im November 1944 richtete von Mackensen als bereits 95 Jähriger einen Aufruf an die Jugend, um sie zu »Opferbereitschaft und Fanatismus« zu ermahnen.
- ↑ Margot Honecker, seit 1963 Ministerin für Volksbildung, meldete sich bei dem Autor 2013 aus Chile, nachdem sie dessen 2009 verlegte autobiografische Erinnerungen »Geteilte Bilanz. Erstrebtes, Zerstörtes, Bewahrtes« gelesen hatte. Darin hatte er auch ausführlich über diesen Kongress berichtet.
- ↑ Demokratischer Frauenbund Deutschlands
- ↑ Die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) war im Herbst 1945 mit den Kommissionen für Bodenreform gegründet worden. Daraus wurde im November 1950 die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe/Bäuerliche Handelsgenossenschaften (VdgB/BHG). Sie war für die Abnahme von Landwirtschaftserzeugnissen und die Zuteilung von Saatgut, Dünge- und Futtermitteln verantwortlich und unterstützte die Landwirtschaft wie insgesamt die Entwicklung auf dem Lande politisch. In der Volkskammer stellte sie von 1950 bis 1963 und von 1986 bis 1990 eine eigene Fraktion, in den Kommunalparlamenten war sie immer als Interessenvertreter der LPG vertreten. Letzter VdgB-Chef, von 1982 bis 1990, war Fritz Dallmann, der unweit von Margarete Müllers Kotelow, in Priborn, eine LPG leitete und mit ihr seit 1964 im ZK saß
- ↑ Tausend Traktoren aus der Sowjetunion: Zur Hilfe für die darniederliegende Landwirtschaft in ihrer Zone lieferte die Sowjetunion im Laufe des Jahres 1949 etwa tausend verschiedene Traktoren vom Typ Kirowezed 35, Universal 2 und STS, letztere wurden von den Stalingrader Traktorenwerken geliefert, die nach dem Krieg wieder aufgebaut worden waren.
- ↑ Agronom, eine in der DDR übliche Bezeichnung für einen in Landwirttschaftlichen Produktionsgenossenschaften tätigen Agraringenieur.
- ↑ Max Steffen (1909-1988), gelernter Maurer, dann Metallarbeiter, 1927 KPD, antifaschistischer Widerstandskämpfer, KZ Sachsenhausen, nach sowjetischer Kriegsgefangenschaft 1948 Rückkehr nach Deutschland. 1948 SED, nach Besuch der Parteihochschule von 1953 bis 1960 in Neubrandenburg 1. Sekretär der SED Bezirksleitung, ZK-Mitglied von 1958 bis 1963, danach – bis 1981 – Sekretär der SED Betriebsparteiorganisation im VEB Kraftwerk Lübbenau, später Direktor für Kader und Berufsausbildung der VVB Kraftwerke.
- ↑ Georg Ewald (1926-1973), Landarbeiter, 1946 SED, nach Besuch der Parteihochschule 1. Sekretär der SED-Kreisleitung Bad Doberan, dann Rügen. Von 1960 bis 1963 in Neubrandenburg 1. Sekretär der Bezirksleitung. ZK-Mitglied, seit 1963 Kandidat des Politbüros und Volkskammerabgeordneter. Vorsitzender des Landwirtschaftsrates bzw. des Rates für landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft beim Ministerrat und von 1971 bis 1973 Minister für Land-, Forst und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR. 1973 bei einem Autounfall tödlich verunglückt.
- ↑ Otto Grotewohl (1894-1964), Buchdrucker, SPD 1912, von 1920 bis 1930 Braunschweiger Landtagsabgeordneter, 1921 Volksbildungsminister, 1932 Minister für Inneres und Justiz, 1925 bis 1933 Reichstagsabgeordneter. Im Juni 1945 rief er erneut die SPD ins Leben und engagierte sich für die Vereinigung mit der KPD. Gemeinsam mit Wilhelm Pieck Vorsitzender der SED. Von 1949 bis 1964 Ministerpräsident der DDR
- ↑ Hermann Axen (1916-1992), KJVD 1932, 1938 Emigration nach Frankreich, 1942 an Gestapo ausgeliefert, bis 1945 KZ Auschwitz, dann Buchenwald, 1946 SED und Mitbegründer der FDJ, ab 1949 ZK-Mitglied, von 1954 bis 1989 Volkskammerabgeordneter, von 1958 bis 1966 Chefredakteur des Neuen Deutschland, 1963 Kandidat, 1970 Mitglied des Politbüros, seit 1979 Mitglied des Präsidiums des Komitees der Antifaschistischen Widerstandskämpfer und seit 1982 des Generalrates der Fédération Internationale des Résistants sowie von 1982 bis 1989 Mitglied des Präsidiums des DDR-Friedensrates.
- ↑ Karl-Heinz Bartsch (1923-2004), nach Lehre als Landwirtschaftsgehilfe mit 18 freiwillig zur SS, Ausbildung in der 3. SS-Panzerdivision »Totenkopf«, Kriegseinsätze in Frankreich, später an der Ost-, dann an der Westfront. Nach amerikanischer Kriegsgefangenschaft Ende 1945 Rückkehr nach Deutschland, Studium an der Martin-Luther-Universität und 1949 Abschluss als Diplomlandwirt, 1949 SED, Promotion 1951, Habilitation 1961. 1952 Leiter des VEG Clausberg, von 1954 bis 1960 Mitglied der SED-Bezirksleitung Erfurt. Von 1961 bis Anfang 1963 Direktor des Instituts für Tierzüchtung und Haustiergenetik der Landwirtschaftlichen Fakultät der Humboldt Universität Berlin, von 1962 bis Anfang 1963 stellvertretender Minister für Landwirtschaft, Erfassung und Forstwirtschaft der DDR, Anfang 1963 Professor. Am 21. Januar 1963 ZK Mitglied und Kandidat des Politbüros. Am 9. Februar 1963 Ausschluss aus dem ZK, am 28. März 1963 aus der SED. Von April 1963 bis Februar 1965 Tätigkeit im VEG Großvielen im Kreis Waren und von 1965 bis 1981 Direktor des VEG für Tierzucht in Woldegk und Leiter des dortigen Stützpunktes des Forschungszentrums für Tierproduktion. Am 3. Dezember 1972 stellte Bartsch ein Ersuchen um Wiederaufnahme in die SED, das am 2. März 1973 von der ZPKK abgelehnt wurde. Von 1981 bis zur Rente 1988 war Bartsch LPG Vorsitzender eines Färsenaufzuchtbetriebs. Von 1988 bis 1990 arbeitete er als Lehrer an der Agrar-Ingenieurschule Neubrandenburg.
- ↑ Frieda Sternberg (1920-2009), 1946 SPD, dann SED, gründete im August 1953 mit sechs Landarbeitern die LPG »Ernst Thälmann« in Bennewitz bei Wurzen. Sie war die erste Frau in der DDR, die eine LPG leitete. Von 1954 bis 1958 und von 1963 bis 1989 Kandidat des ZK der SED. Sie lieferte die Vorlage für Figuren in Helmut Sakowskis »Wege übers Land« und »Daniel Druskat«.
- ↑ Bernhardt Quandt (1903-1999), Eisendreher, 1920 SPD, 1923 KPD, 1932 Abgeordneter des Landtages Mecklenburg Schwerin. Nach 1933 wiederholt inhaftiert, von 1939 bis 1945 KZ Sachsenhausen und Dachau. Nach dem Krieg Landrat in Güstrow, seit 1948 Landwirtschaftsminister von Mecklenburg, 1951/52 Ministerpräsident. Von 1952 bis 1974 1. Sekretär der Bezirksleitung Schwerin der SED. Mitglied des ZK von 1958 bis 1989 und seit 1960 des Staatsrates.
- ↑ In Wien waren Chruschtschow und der neue US-Präsident Kennedy erstmals zusammengetroffen. Der nachmalige österreichische Kanzler Bruno Kreisky schrieb 1988 in seinen Memoiren »Im Strom der Politik«: »Die Begegnung Chruschtschows mit Kennedy in Wien am 3./4. Juni 1961 schien vielen Leuten eine sinnlose Konferenz gewesen zu sein. Wenn man sie in ihrem großen Zusammenhang sieht, so hat Kennedy Chruschtschow damals zu verstehen gegeben, dass er in diesem gefährlichen Spiel, bis an den Rand des Abgrunds zu gehen, durchaus mithalten werde. So erreichte er auch ein Jahr später, während der Raketenkrise um Kuba, dass die Russen einige ihrer Raketenstellungen, die eine allzu große Provokation für Amerika darstellten, liquidiert haben. Niemals zuvor war die Welt so nahe am Ausbruch eines neuen Krieges gewesen. Und man soll sich nicht täuschen: Dieser Krieg wäre in Europa ausgebrochen und auch in Europa ausgetragen worden, etwa um Berlin herum, denn wenn die Amerikaner in Kuba etwas unternommen hätten, wäre es sicher sofort zu Vergeltungsaktionen in Europa gekommen. Die scheinbar sinnlose Begegnung in Wien hatte beide davon überzeugt, dass der jeweils andere bis zum Äußersten entschlossen war, und diese Erkenntnis hat dazu geführt, dass letztlich das Ärgste verhindert wurde.« Auf dem Rückflug nach Moskau hatte Chruschtschow in Berlin Station gemacht und Ulbricht unterrichtet. Auch vor diesem Hintergrund ist Ulbrichts Pressekonferenz zu sehen.
- ↑ Intervision hieß der 1960 gegründete Verbund der Fernsehanstalten der europäischen sozialistischen Staaten sowie des österreichischen ORF und der finnischen YLE.
- ↑ Nach westlicher Lesart begann die zweite »Berlin-Krise« – die erste war demnach die Einführung der D-Mark in Westberlin 1948 mit nachfolgender Blockade und Luftbrücke – im Jahr 1958. Anlass sei die Note Moskaus an die drei westlichen Besatzungsmächte gewesen, mit der ultimativ binnen eines halben Jahres eine Übereinkunft gefordert wurde, Westberlin in eine »selbständige politische Einheit«, in eine »Freie Stadt« zu verwandeln. Auf die Ablehnung reagierte Moskau mit dem Vorschlag, einen separaten Friedensvertrag mit der DDR schließen zu wollen, dabei würden alle Kontrollrechte, die bislang die Sowjetunion in und um Berlin ausgeübt habe, auf die DDR übertragen werden. In Wien hatte Chruschtschow diese Forderung gegenüber Kennedy erneuert. Der »Mauerbau« klärte die Fronten und beendete die »Krise«.
- ↑ Annamarie Doherr (1909-1974) studierte Rechtswissenschaften und Völkerrecht, beendete das Studium in Hamburg 1933 ohne Abschluss und arbeitete, seit 1942 in Berlin lebend, für die Nazipresse. Von August 1945 bis 1949 arbeitete sie für den Berliner Rundfunk, danach wurde sie (West-)Berlin Korrespondentin der SPD-nahen Frankfurter Rundschau bis 1969. Sie starb im Alter von 65 Jahren in Westberlin und wurde an der Seite ihrer Lebensgefährtin, der Künstlerin Lizzie Hosäus (1910–1998), auf dem St.-Annen Kirchhof bestattet.
- ↑ Mike Mansfield (1903-2001), Senator von 1953 bis 1977, seit 1961 auch Fraktionschef der Demokraten im Senat. Diese Funktion übte er länger aus als alle seine Vorgänger und Nachfolger. Präsident Carter schickte ihn als Botschafter nach Japan, was er bis 1988 blieb. Er war gegen die Rassentrennung und den Krieg der USA in Vietnam.
- ↑ Nach sowjetischem und DDR-Verständnis lag Berlin (und das meint die ganze Stadt) auf dem Territorium der sowjetischen Besatzungszone bzw. der DDR. In einem internen Informationsmaterial zum Recht der Volkskammerabgeordneten der Hauptstadt der DDR auf gleichberechtigte Teilnahme an der Arbeit der Volkskammer und zur rechtswidrigen Forderung nach Stimmrecht für Westberliner im westdeutschen Bundestag vom 24. November 1969 heißt es: »Ganz Berlin … gehörte nach den Vereinbarungen der Antihitlerkoalition rechtens zur Sowjetischen Besatzungszone. Die Teilnahme von Streitkräften der drei Westmächte an der Besetzung und Verwaltung Berlins, dem Sitz des Alliierten Kontrollrates, änderte an dieser Rechtslage nichts. Der Alliierte Kontrollrat bestätigte im Februar 1947, dass Berlin die ›Hauptstadt der Sowjetischen Besatzungszone‹ ist.« (zitiert in Klaus Emmerich, Grenzen. Rechtliche und zeitgeschichtliche Aspekte, Berlin 2009, S. 170). Emmerich weiter: Während eines Gespräches zwischen Bahr und Falin am 5./7. August 1970 wurde vom sowjetischen Vertreter darauf verwiesen, »dass es zwei Kontrollratsbeschlüsse aus dem Jahre 1946 und 1947 gebe, in denen Berlin, und zwar ganz Berlin, als Hauptstadt Brandenburgs bzw. der SBZ bezeichnet wird. Insofern sei die Regierung in Ost-Berlin legal, während man West-Berlin, ohne dass ihm irgend jemand bisher hätte eine Rechtsgrundlage sagen können, losgerissen und zu etwas Eigenem gemacht (habe).« Als einzige realistische Grundlage müsse gelten: Es gibt die Hauptstadt der DDR und das besondere Gebilde Westberlin. Es gab keine Besatzungsrechte in Bezug auf die Hauptstadt der DDR. Wenn es Gespräche gibt, dann werden diese nur hinsichtlich Westberlins geführt.
- ↑ Das Alliierte Reisebüro war 1950 in Westberlin eingerichtet worden, da DDR Reisepässe in westlichen Staaten, insbesondere NATO-Staaten, auf Wunsch Bonns nicht akzeptiert wurden. DDR-Bürger mussten dort eine Reisegenehmigung beantragen, die nach oft mehrwöchiger Prüfung erteilt oder verweigert wurde. So besaßen die Westmächte einerseits Kenntnis und Kontrolle über die Reisetätigkeit von DDR-Kadern (und vor allem über deren Zweck), und sie konnten diese Reisen durch Verweigerung verhindern. Davon wurde rege Gebrauch gemacht. Erst 1970 stellte das Travel Board Office seine diskriminierende Tätigkeit ein.
- ↑ Bernard Montgomery (1887-1976), ein britischer Berufsoffizier, der die britisch kanadischen Streitkräfte nach Errichtung der 2. Front in Westeuropa bis zum Ende des Krieges befehligte. Bis 1946 Oberbefehlshaber der britischen Besatzungstruppen in Deutschland und Mitglied des Alliierten Kontrollrats. Von 1951 bis 1958 war er stellvertretender Oberbefehlshaber der NATO.
- ↑ Lord Beaverbrook (1879-1964), eigentlich Max Aitken, kanadisch-britischer Verleger und konservativer Politiker, während des Zweiten Weltkriegs zunächst Minister für Flugzeugproduktion, dann für Nachschub.
- ↑ Eine Funktion des Zweiten Sekretärs des ZK der SED hat es offiziell nie gegeben. Diese Bezeichnung wurde allenfalls intern geführt, weil Honecker unter Ulbricht die Tätigkeit des Sekretariats leitete.
- ↑ Hans-Dieter Mäde (1930-2009), Theaterregisseur und seit 1977 Generaldirektor des DEFA-Studios für Spielfilme, langjähriger Generalintendant der Theater von Karl-Marx-Stadt und Dresden.
- ↑ Hans Rodenberg (1895-1978), Theaterregisseur, der Reinhardts Schauspielschule des Deutschen Theaters absolviert hatte. Von 1932 bis 1948 im sowjetischen Exil, gründete das Theater der Freundschaft in Berlin, war von 1960 bis 1963 stellvertretender Kulturminister, Mitglied des Staatsrates und von 1969 bis 1978 Vizepräsident der Akademie der Künste.
- ↑ Maxim Vallentin (1904-1987), Theaterregisseur und Schauspieler, 1935 bis 1945 Exil in der Sowjetunion, seit 1952 Leiter des Maxim-Gorki-Theaters in Berlin. Er war einer der Hauptvertreter des »Stanislawski Systems« und damit Gegner der von Brecht geprägten Schule. Brecht vertrat die Ansicht, der Schauspieler müsse eine kritische Distanz zum Dargestellten halten und seinem Spiel gezielt die Illusion nehmen, damit die sozialkritische Aussage im Vordergrund stehe (V-Effekt), während Konstantin Stanislawski (1863-1938) von den Schauspielern forderte, parallele Situationen aus dem eigenen Erleben zu kopieren, um das nicht Erlebte (des Theaterstücks) glaubwürdig verkörpern zu können.
- ↑ Helene Weigel (1900-1971), österreichisch deutsche Schauspielerin und seit 1949 Intendantin des Berliner Ensembles, seit 1923 mit Brecht zusammen. 1950 Gründungsmitglied der Akademie der Künste der DDR.
- ↑ Hermann Henselmann (1905-1995), Architekt, der in den 50er und 60er Jahren den Städebau der DDR geprägt hat. 1946 Direktor an der Hochschule für Bauwesen in Weimar, ab 1949 am Institut für Bauwesen der Deutschen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Von ihm sind u. a. die Karl-Marx-Allee, das Haus des Lehrers und die Kongresshalle am Berliner Alexanderplatz.
- ↑ Wladimir S. Semjonow (1911-1992), Sowjetdiplomat seit 1939. Von 1946 bis 1953 Politischer Berater der Sowjetischen Militäradministration unter Wassili Sokolowski und Wassili Tschuikow. Im Juni 1953 wurde er, nach Auflösung der Sowjetischen Kontrollkommission, Chef der Hohen Kommission der UdSSR in Deutschland. Im September des gleichen Jahres erfolgte seine Ernennung zum sowjetischen Botschafter in der DDR. Von 1978 bis 1986 in der Nachfolge Valentin Falins Botschafter der UdSSR in der BRD. Seine Rolle in der DDR, insbesondere 1953 ist zwielichtig. So wollte er nach dem 17. Juni an die Stelle von Ulbricht den LDPD Vorsitzenden Hermann Kastner (1886-1957) als Vizepremier haben, der allerdings ein Agent westlicher Geheimdienste war. Der BND-Spion floh er 1956 in die BRD.
- ↑ Otto Grotewohl (1894-1964), in den 20er Jahren Reichstagsabgeordneter der SPD, 1945 Vorsitzender des Zentralausschusses der SPD und Befürworter der Vereinigung von SPD und KPD, ab 1946 mit Wilhelm Pieck Ko Vorsitzender der SED, von 1949 bis 1964 Ministerpräsident.
- ↑ Der Brief Brechts vom 17. Juni 1953 ist im Nachlass von Walter Ulbricht im Bundesarchiv (SAPMO-BArch NY 4182/1387) einzusehen und hat folgenden Wortlaut: »Werter Genosse Ulbricht, die Geschichte wird der revolutionären Ungeduld der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ihren Respekt zollen. Die große Aussprache mit den Massen über das Tempo des sozialistischen Aufbaus wird zu einer Sichtung und zu einer Sicherung der sozialistischen Errungenschaften führen. Es ist mir ein Bedürfnis, Ihnen in diesem Augenblick meine Verbundenheit mit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auszudrücken. Ihr Bertolt Brecht«.
- ↑ Käthe Rülicke (1922-1992), Dramaturgin und Film- und Fernsehwissenschaftlerin, im BE seit 1950, von 1951 bis 1956 Regie Asisstentin und Dramaturgin, danach Chefdramaturgin der Hauptabteilung Dramatische Kunst beim Deutschen Fernsehfunk, von 1967 bis 1982 arbeitete sie an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam, ab 1971 Professorin.
- ↑ Peter Palitzsch (1918-2004), Theaterregisseur, am BE von 1949 bis 1961, ab 1966 Schauspieldirektor am Staatstheater Stuttgart, später am Schauspiel Frankfurt, 1992 Rückkehr zum BE. Bis 1995 gemeinsame Intendanz mit Peter Zadek, Fritz Marquardt, Matthias Langhoff und Heiner Müller.
- ↑ Auf der 2. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 war der planmäßige Aufbau der Grundlagen des Sozialismus beschlossen worden, damit endete die Phase der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung im Osten Deutschlands.
- ↑ Als Reaktion auf die separate Währungsreform und den Wegfall der Preisbindung legten fast zehn Millionen Werktätige in den Westzonen in einem eintägigen Generalstreik die Arbeit nieder. Es war der erste und größte Streik der westdeutschen Geschichte. In Stuttgart – darum »Stuttgarter Vorfälle« – ließ die US Besatzungsmacht Panzer auffahren.
- ↑ Erwin Geschonneck (1906-2008), Schauspieler, KPD-Mitglied seit 1929, 1938 von der Sowjetunion zum Verlassen des Landes gezwungen, KZ von 1939 bis 1945, von 1946 bis 1948 an den Hamburger Kammerspielen, seit 1949 am BE. Er wurde unweit der Gräber von Brecht und Weigel auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof beigesetzt.
- ↑ Günter Mittag (1926-1994), von 1966 bis 1989 Mitglied des Politbüros. Als ZK-Sekretär für Wirtschaftsfragen war er beteiligt an der Ausarbeitung des Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung, das auf dem VI. Parteitag der SED 1963 als Reformkonzept beschlossen wurde. Die Väter waren Walter Ulbricht und Erich Apel, aktiv konzeptionell wirkten daran vor allem mit: Wolfgang Berger, Herbert Wolf, Walter Halbritter und Heinz Koziolek. Ab den 70er Jahren verantwortete Mittag die Wirtschaftspolitik der DDR nahezu allein und sorgte maßgeblich für den Niedergang des Landes.
- ↑ Peter Hacks (1928-2003), Dramatiker, Lyriker, Erzähler und Essayist. Er begründete in den 60er Jahren die »sozialistische Klassik« und war vermutlich der bedeutendste Dramatiker der DDR. Er fiel im Westen in Ungnade, als er 1976 die Ausbürgerung Biermanns in einem Beitrag in der Weltbühne explizit begrüßte.
- ↑ Wolfgang Langhoff (1901-1966), Schauspieler und Regisseur. Wegen seines Engagements in der KPD inhaftierten ihn die Nazis. Flucht in die Schweiz, 1946 Intendant des Deutschen Theaters (bis 1963, dann Rücktritt wegen einer Inszenierung des Hacks Stückes »Die Sorgen und die Macht«), 1956 Präsident des DDR-Zentrums des Internationalen Theaterinstituts der UNESCO.
- ↑ Ernst Busch (1900-1980), Sänger, Schauspieler und Regisseur, Emigration seit 1933, Auftritte vor den Internationalen Brigaden in Spanien, interniert in Frankreich, Auslieferung an die Gestapo und Haft bis Kriegsende im Zuchthaus Brandenburg, Eintritt in die KPD, am BE seit 1949. 1961 Rückzug von der Bühne.
- ↑ Volker Braun (Jahrgang 1939), Philosophiestudium an der Leipziger Karl Marx-Universität, SED seit 1960, von 1965 bis 1967 auf Einladung Helene Weigels Dramaturg am BE, seit 1972 am Deutschen Theater. 1988 Nationalpreis der DDR.
- ↑ Valentin M. Falin (Jahrgang 1926), 1950/51 gehörte er zum Stab der Sowjetischen Kontrollkommission in Deutschland. Seit 1961 gehörte er dem Beraterstab Chruschtschows an, ab 1965 Chef der Beratergruppe des sowjetischen Außenministers Andrej A.Gromyko. Von 1971 bis 1978 Botschafter der UdSSR in der BRD, 1990/91 ZK-Sekretär, von 1992 bis 2000 Mitarbeiter von Egon Bahrs Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik in Hamburg.
- ↑ Andrej A. Shdanow (1896-1948), von 1934 bis 1944 in der Nachfolge Kirows Gebiets- und Stadtsekretär der Parteiorganisation Leningrads, als enger Mitarbeiter Stalins insbesondere für Kultur zuständig. Die nach ihm benannte repressive Kulturpolitik (Schdanowschtschina) richtete sich gegen Schriftsteller wie Achmatowa, Pasternak und Soschtschenko, Regisseure wie Eisenstein und Komponisten wie Prokofjew und Schostakowitsch.
- ↑ Paul Dessau (1894-1979), Komponist und Dirigent, seit Anfang der 30er Jahre einer der führenden Filmkomponisten, 1933 Emigration, erst Frankreich, dann USA, Bekanntschaft und Beginn der Zusammenarbeit mit Brecht und Busch, Rückkehr nach Berlin 1948. Mitglied der Akademie der Künste seit 1952, von 1957 bis 1962 deren Vizepräsident. Dreimal Nationalpreis der DDR.
- ↑ Gisela May (Jahrgang 1924), Schauspielerin und Diseuse, die sich vor allem als Brecht Interpretin einen Namen gemacht hat. Seit 1951 am Deutschen Theater, seit 1962 am BE. Dort spielte sie von 1978 bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Ensemble 1992 die Mutter Courage. Dreimal Nationalpreis der DDR, einmal Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.
- ↑ Helmut Baierl (1926-2005), Schriftsteller und Vizepräsident der Akademie der Künste der DDR. Von 1959 bis 1967 Dramaturg und Autor am BE, von 1961 bis 1967 dort Parteisekretär. Zweimal Nationalpreis der DDR.
- ↑ Anna Seghers (1900-1983), in Mainz als Anna Reiling geboren, Studium der Geschichte, Kunstgechichte und Sinologie. Erste Veröffentlichtungen in den 20er Jahren, 1928 KPD, Gründungsmitglied des Bundes proletarisch-revolutionärer Schriftsteller. Nach 1933 kurzzeitig Haft, ihre Bücher wurden verboten und verbrannt. Exil in Frankreich, dann Mexiko. 1942 erschien ihr berühmtestes Buch »Das siebte Kreuz«. 1947 Rückkehr nach Deutschland, Eintritt in die SED, 1951 Nationalpreis, von 1952 bis 1978 Präsidentin des Schriftstellerverbandes der DDR.
- ↑ Konrad Wolf (1925-1982), Sohn des Schriftstellers Friedrich Wolf, Exil in der Sowjetunion seit 1933, Eintritt in die Rote Armee mit 17, war an der Befreiung Berlins mit 19 beteiligt. Von 1949 bis 1954 studierte er an der 1919 gegründeten Moskauer Filmhochschule Gerassimow-Institut für Kinematographie, dann Filmregisseur bei der DEFA, von 1965 bis 1982 war er Präsident der Akademie der Künste der DDR.
- ↑ Fritz Cremer (1906-1993), 1929 KPD, Bekanntschaft im Exil mit Brecht und Weigel, nach Kriegsgefangenschaft 1946 Rückkehr nach Wien, dann Berlin, 1946 SED, tätig als Bildhauer, Grafiker und Zeichner, Vizepräsident der Akademie der Künste der DDR. Nationalpreis 1952, 1958 (für Buchenwalddenkmal), 1972.
- ↑ Paul Wiens (1922-1982), Philosophiestudium, 1943 verhaftet wegen Wehrkraftzersetzung. 1947 Rückkehr nach Berlin, Lektor im Aubauverlag bis 1950, danach freischaffend als Schriftsteller, Drehbuchautor und Dichter, Übersetzer von Pablo Neruda, Wladimir Majakowskij, Nazim Hikmet. Chefredakteur von Sinn und Form. Vizepräsident des Kulturbunds der DDR und von 1961 bis 1969 Vorsitzender des Bezirksverbands Berlin des Schriftstellerverbandes der DDR. 1959 Nationalpreis.
- ↑ Horst Sindermann (1915-1990), 1929 Kommunistischer Jugendverband, 1933 erste Haft, 1935 wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu sechs Jahren verurteilt, KZ bis 1945. Von 1950 bis 1953 Chefredakteur der Freiheit in Halle, danach, bis 1963, Leiter der Abteilung Agitation im ZK der SED. Von 1963 bis 1971 in Halle 1. Sekretär der SED Bezirksleitung. Von 1971 bis 1973 Stellvertretender, bis 1975 Ministerpräsident. Von 1976 bis 1989 Präsident der Volkskammer.
- ↑ Piophiliden sind sogenannte Käsefliegen, der Forschungsgegenstand des Helden Achim Steinhauer.
- ↑ Neue Deutsche Literatur (NDL), seit 1952 monatlich erscheinende und vom Schriftstellerverband der DDR herausgegebene Literaturzeitschrift mit einer Auflage zwischen 8.000 und 10.000 Exemplaren, neben Sinn und Form ein wichtiges Verständigungs- und Publikationsorgan der Kulturschaffenden der DDR.
- ↑ Belegt werden kann das mit der von Konstantin Simonow angefertigten Mitschrift der zweistündigen Rede Stalins auf der ersten KPdSU-Plenartagung nach dem XIX. Parteitag der KPdSU, die erst 1989 veröffentlicht wurde. Vgl. Konstantin Simonow: Mit den Augen eines Menschen meiner Generation. Nachdenken über Stalin, in: Sowjetliteratur, Moskau 1989, H.6, S. 56
- ↑ Auf dem XXII. Parteitag trat Mikojan mit folgender Beschuldigung auf: Molotow habe in einer Rede 1956 »offen daran gezweifelt, dass die sozialistische Gesellschaft in der UdSSR aufgebaut ist«. Er habe gesagt, dass in der Sowjetunion »die Grundlagen der sozialistischen Gesellschaft errichtet sind«. Mikojan dazu: »Sie werden selbst begreifen, dass man auf der Grundlage solcher Thesen an einen Plan zum Aufbau des Kommunismus nicht einmal denken kann.« (Die Presse der Sowjetunion, Nr. 129/1961, S. 2804)
- ↑ Das FDGB-Urlauberschiff »Völkerfreundschaft« war 1946 in Schweden gebaut worden und verkehrte zunächst als MS Stockholm auf der Atlantiklinie. Es hatte 12.644 BRT und beförderte knapp 700 Passagiere. Bei einem Zusammenstoß mit der italienischen »Andrea Doria« sank der größere Liner, die »Stockholm« wurde repariert, umgebaut und an die DDR verkauft, wo das Schiff am 3. Januar 1960 als Urlauberschiff des FDGB unter dem Namen »Völkerfreundschaft« in Dienst gestellt wurde. Die »Völkerfreundschaft« fuhr bis 1985, dann trat die MS »Arkona« an ihre Stelle. Das Schiff wurde verkauft, 1986 in »Fritjof Nansen« umbenannt und in Oslo als Unterkunft für Asylbewerber genutzt. 1989 kaufte es ein italienischer Reeder, der es zu einem modernen Kreuzfahrtschiff umbauen ließ. Seit 2007 fährt die »schöne Italienerin« für einen deutschen Veranstalter.
- ↑ Die Baumwollspinnerei in Schibin el Kum, 80 Kilometer von Kairo entfernt, war mit 100.000 Spindeln aus der DDR bestückt worden. Der Spiegel, der in seiner Ausgabe vom 3. März 1975 über den Besuch berichtete, machte allein in seiner Diktion deutlich, wie sehr Bonn getroffen war: »Die von schweren Lidern halbverdeckten Augen des Zonen-Vogts, die sonst so listig funkeln, wurden dort vor Stolz und Rührung feucht. Die Begeisterung übertraf alles, was der Kommunist auf seinen Staatsvisiten in Ländern des Ostblocks an eingeplantem Jubel-Soll erlebt hatte. Einzelne Arbeiter ließen sich von der Polizei prügeln, um nicht aus seiner Nähe verdrängt zu werden eine Verhaltensweise, die Ulbricht von den Arbeitern seiner Heimat nicht gewohnt ist. […] ›Meinetwegen hätte es noch viel länger dauern können‹, sagte Ulbricht mit aufrichtigem Bedauern, als er die Spinnerei nach Ablauf einer Stunde wieder verlassen musste.«
- ↑ Der neue Assuan-Staudamm wurde von 1960 bis 1971 mit sowjetischer Hilfe errichtet, nachdem die USA und die Weltbank ihre Finanzierungszusagen 1956 zurückgezogen hatten, weil Ägypten die Volksrepublik China anerkannt hatte. An dem Projekt, das umgerechnet etwa 2,2 Milliarden Euro kostete, arbeiteten 2.000 sowjetische Ingenieure und 30.000 Arbeiter. Der Stausee ist der drittgrößte der Erde.
- ↑ Über die Ägyptenreise 1965 veröffentlichte u. a. Lotte Ulbricht »Eine unvergessliche Reise«, Walter Ulbricht gab noch im gleichen Jahr den Bildband »Freundschaft. Vereinigte Arabische Republik – freies Land am Nil« heraus, dessen Redaktion Heinz Eichler besorgte.
- ↑ Julij Kwizinskij (1936-2010), begann als Chefdolmetscher 1959 im diplomatischen Dienst, war in den 60er Jahren Kulturattaché in Berlin, war in die Verhandlungen zum Vierseitigen Abkommen über Berlin 1879/71 involviert, ab 1978 Gesandter in Bonn, in den 80er Jahren gehörte er der sowjetischen Delegation bei den Abrüstungsgesprächen mit den USA in Genf an. Von 1986 bis 1991 Botschafter in Bonn, danach 1. Stellvertreter des sowjetischen Außenministers. Von 1997 bis 2003 russischer Borschafter in Norwegen. Danach Abgeordneter der Duma für die KP.
- ↑ Frol Koslow (1908-1965), von 1952 bis 1953 2. Sekretär und von 1953 bis 1957 1. Sekretär des Leningrader Gebietskomitees. 1952 wurde er – 44 Jahre alt – Mitglied im Zentralkomitee der KPdSU. 1957 Mitglied des Politbüros, 1960 ZK-Sekretär für Kader oder Organisationsfragen. Er galt als potentieller Nachfolger Chruschtschows, erlitt aber 1963 einen Schlaganfall, von dem er sich nicht wieder erholte.
- ↑ Bruno Leuschner (1910-1965) saß bis 1945 im KZ, baute 1945 die Wirtschaftsabteilung der KPD auf, dann die Deutsche Wirtschaftskommission. Er gehörte dem ZK seit 1950 an und war, in der Nachfolge Heinrich Raus, von 1952 bis 1961 Vorsitzender der Staatlichen Plankommission, danach Minister für die Koordination volkswirtschaftlicher Grundaufgaben beim Präsidium des Ministerrates und ab Juni 1962 ständiger Vertreter der DDR im Exekutivkomitee des RGW.
- ↑ Rudolf Slánsky (1901-1952), 1921 KPTsch, 1929 ZK-Mitglied, 1938 Moskauer Exil, 1944 Tilnehmer des Slowakischen Nationalaufstandes, 1945 Generalsekretär der KTsch. 1951 im Rahmen der Noel-Field-Affäre verhaftet, in einem Schauprozess als angeblicher »Leiter eines staatsfeindlichen Verschwörungszentrums« zum Tode verurteilt und am 3. Dezember 1952 zusammen mit zehn weiteren Mitangeklagten durch Erhängen hingerichtet. 1963 juristisch, 1968 politisch rehabiliert.
- ↑ Wladyslaw Gomulka 1905-1982), Schlosser, 1926 Mitglied der Kommunistischen Partei Polens, Generalsekretär der 1942 im Untergrund gegründeten Polnischen Arbeiterpartei (ab 1948 Polnische Vereinigte Arbeiterpartei). 1948 wegen angeblicher rechtsnationalistischer Abweichungen abgelöst, 1951 verhaftet und aus der Partei ausgeschlossen. 1954 aus der Haft entlassen, im Herbst 1956 als Vorsitzender der PVAP gewählt. Ende 1970 als Parteichef abgelöst.
- ↑ Gründungsaufruf der KPD vom 11. Juni 1945
- ↑ »Operation Unthinkable« (»Operation Undenkbar«) war der Name eines im Mai 1945 vom britischen Premierminister Winston Churchill in Auftrag gegebenen Kriegsplans, der die militärische Unterwerfung der Sowjetunion durch Großbritannien und die USA zum Ziel hatte. Zwei Wochen nach dem Sieg der Antihitlerkoalition über Nazideutschland wurde ihm dieser Plan, den der britische Premier in Auftrag gegeben hatte, übergeben und zweimal ergänzt. Als Termin für den Angriff auf die Sowjetunion wurde der 1. Juli 1945 festgelegt. Aufgrund der hohen zahlenmäßigen Überlegenheit der Roten Armee beabsichtigte man die Wiederbewaffnung von ca. 100.000 Soldaten der Wehrmacht. Weil der Plan als militärisch und auch politisch nicht durchführbar eingestuft wurde, ließ man ihn fallen. Der als streng geheim eingestufte Plan wurde erst 1998 der Öffentlichkeit bekannt.
- ↑ »Generalplan Ost« (GPO) war die Zusammenfassung aller Überlegungen und Pläne Hitlerdeutschlands zur Unterwerfung Osteuropas einschließlich der Sowjeteunion. »Operation Drophshot« war der Codename für einen Plan der USA, der 1949 ausgearbeitet wurde und einen atomaren und konventionellen Präventivschlag auf die Sowjetunion vorsah. Dabei sollten 300 Atombomben und 29.000 hochexplosive Bomben auf 200 Ziele in 100 Städten abgeworfen werden, um 85 % der industriellen Kapazität der Sowjetunion in einem einzigen Schlag zu vernichten. Zwischen 75 und 100 der 300 Kernwaffen sollten ferner zur Vernichtung sowjetischer Kampfflugzeuge am Boden eingesetzt werden.
- ↑ Gemeint ist die Moskauer Hochschule für internationale Beziehungen, an der Falin von 1945 bis 1949 studierte. Er entschied sich für die Hauptfächer Deutsch und Deutschlandkunde sowie Völkerrecht und schloss mit dem Prädikat »Magna cum laude« ab.
- ↑ Gustav Heinemann (1899-1976), promovierter Jurist, gehörte 1945 zu den Mitbegründern der CDU. Die Briten setzten ihn als Oberbürgermeister von Essen ein, was er bis 1949 war. 1947/48 war er Justizminister in Nordrhein-Westfalen, am 20. September 1949 berief ihn Adenauer unter Druck zum Bundesinnenminister: Er war von der eigenen Fraktion gerügt worden, dass zu viele Katholiken im Kabinett säßen: Heinemann war evangelisch. Am 9. Oktober 1950 trat Heinemann aber zurück, nachdem publik geworden war, dass der Kanzler hinter dem Rücken der Bundesregierung mit den USA Geheimverhandlungen über eine Remilitarisierung der BRD geführt hatte. 1952 trat er wegen der Wiederbewaffnung aus der CDU aus und 1957 in die SPD ein. Am 1. Dezember 1966 wurde Heinemann auf Vorschlag Willy Brandts zum Bundesminister der Justiz in der von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger geführten Großen Koalition ernannt. Von 1969 bis 1974 war er Bundespräsident.
- ↑ Der unwürdige Streit um die Zahl der Dresdner Opfer flammte nach dem Ende der DDR wieder auf. Die DDR hatte etwa 35.000 Tote ermittelt. Eine Dresdner Historikerkommission erklärte 2008: »Im Ergebnis der Untersuchungen der Kommission sind bislang 18.000 Dresdner Luftkriegstote nachgewiesen worden, die den Luftangriffen zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 zuzuordnen sind. Die Kommission geht von maximal 25.000 Menschen aus, die während der Februar-Luftangriffe in Dresden ums Leben gekommen sind.«
- ↑ Nachdem Adenauer 1950 die ersten Berufsverbote gegen Mitglieder der KPD und der FDJ erlassen und mit den Westmächten über die Remilitarisierung verhandelte, forderte Ulbricht den Sturz der Adenauer-Regierung als Voraussetzung zur Herstellung der deutschen Einheit.
- ↑ Douglas MacArthur (1880-1964), US Brigadegeneral im Ersten und Feldmarschall im Zweiten Weltkrieg, befehligte im Korea-Krieg (1950-1953) die UNO-Truppen. Dort drängte er auf Ausweitung des Krieges auf die VR China. Truman entließ ihn angeblich aus diesem Grunde 1951. In Wahrheit schickte er den 1948 gescheiterten Präsidentschaftskandidaten in die politische Wüste, um den gefeierten »Kriegshelden« als politischen Konkurrenten auszuschalten.
- ↑ Li Sing-Man (auch Rhee Syng-man, 1875 1965) war von 1948 bis 1960 erster Präsident Südkoreas. Rhee setzte sich für eine gewaltsame Vereinigung des Landes ein. Im Koreakrieg von 1950 bis 1953 konnte Rhees Regierung nur durch das Eingreifen von UN Truppen unter US-Führung vor der frühen Niederlage bewahrt werden. Kim Il-sung (1912-1994) führte die 1948 proklamierte Demokratische Volksrepublik Korea als Partei und Regierungschef.
- ↑ Auf der Grundlage von Archivmaterialien, vor allem in Moskau, kam das Institut für Wirtschaftsgeschichte der Humboldt Universität zu Berlin 1993 auf eine Gesamtsumme von mindestens 54 Milliarden Reichsmark bzw. Deutsche Mark (Ost) zu laufenden Preisen bzw. auf mindestens 14 Milliarden US-Dollar zu Preisen des Jahres 1938. Als die Reparationen 1953 für beendet erklärt wurden, hatte die SBZ/DDR die höchsten im 20. Jahrhundert bekanntgewordenen Reparationsleistungen erbracht. Die Reparationen der DDR betrugen insgesamt 99,1 Milliarden DM (zu Preisen von 1953) – die der BRD demgegenüber 2,1 Milliarden DM (zu Preisen von 1953). Die DDR/SBZ trug damit 97 bis 98 Prozent der Reparationslast Gesamtdeutschlands – jeder Ostdeutsche also das 130fache eines Westdeutschen.
- ↑ Wassili I. Tschuikow (1900-1982), sowjetischer Militärführer, zweifacher »Held der Sowjetunion«, war von 1946 bis 1949 Vize Chef der SMAD, dann deren Vorsitzender bis zu deren Auflösung. Danach, von 1949 bis 1953, leitete er die Sowjetische Kontrollkommission (SKK) und war Oberkommandierender der Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland (GSSD).
- ↑ Der Christdemokrat Georg Dertinger (1902-1968) war in der ersten DDR-Regierung Außenminister und am 15. Januar 1953 verhaftet worden. Das Oberste Gericht der DDR verurteilte ihn 1954 zu 15 Jahren Haft wegen »Spionage und Verschwörung«. Sein persönlicher Mitarbeiter Gerold Rummler hatte sich 1952 in den Westen abgesetzt, wodurch auch Dertinger in den Fokus des MfS geriet. 1964 wurde Dertinger begnadigt und arbeitete danach für den St. Benno-Verlag in Leipzig.
- ↑ Areopag ist ein Felsen in Athen unweit der Akropolis, auf dem in der Antike der Oberste Rat tagte, weshalb er auch diesen Namen trug. Falin benutzt diese Bezeichnung als Metapher für die oberste Führung im Kreml.
- ↑ Francis Bacon (1561-1626), englischer Philosoph, Staatsmann und Wissenschaftler
- ↑ Gary Powers (1929-1977) wurde bei einem US-Spionageflug über sowjetisches Territorium bei Swerdlowsk mit einer neuartigen Flugabwehrrakete am 1. Mai 1960 in großer Höhe abgeschossen. Durch Vermittlung von DDR-Rechtsanwalt Wolfgang Vogel wurde Powers am 10. Februar 1962 auf der Glienicker Brücke gegen den KGB-Oberst Rudolf Abel ausgetauscht.
- ↑ Luc de Clapiers, Marquis de Vauvenargues (1715-1747) war ein französischer Philosoph, Moralist und Schriftsteller.
- ↑ Am 17. April 1961 war in der Schweinebucht eine Invasion von Exilkubanern, die massiv von den USA darauf vorbereitet worden waren, erfolgt. Die CIA-Operation, für die Kennedy später die volle Verantwortung übernommen hatte, wurde erfolgreich von Kuba abgewehrt.
- ↑ Fritz Schäffer (1888-1967) war der erste Ministerpräsident Bayerns nach dem Krieg und von 1949 bis 1957 Bundesfinanzminister, von 1957 bis 1961 Bundesjustizminister. Der CSU Politiker weilte 1955 und 1956 in geheimer Mission in Berlin und führte als BRD Vizekanzler informelle Gespräche mit dem sowjetischen Botschafter Puschkin und dem Stellvertretenden Verteidigungsminister der DDR, Vincenz Müller.
- ↑ Reinhold Maier (1889-1971) war der erste Ministerpräsident von Baden-Württemberg und der einzige Ministerpräsident, den die FDP jemals stellte. Maier hatte als Reichstagsabgeordner der Deutschen Staatspartei am 23. März 1933 zusammen mit den anderen vier liberalen Reichstagsabgeordneten Hermann Dietrich, Theodor Heuss, Heinrich Landahl und Ernst Lemmer dem Ermächtigungsgesetz der Nazis zugestimmt.
- ↑ John Foster Dulles (1888-1959) war von 1953 bis 1959 US-Außenminister.
- ↑ Otto John (1909-1997) war der erste Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (von 1950 bis 1954) kam Ende Juli 1954 in die DDR, wobei bis heute unklar ist, ob er diesen Schritt freiwillig tat oder vom KGB gekidnappt worden war. Er wurde vier Monate lang in Moskau vernommen, kehrte dann in die DDR-Hauptstadt zurück, wo er in Vorträgen und Publikationen die Remilitarisierung der BRD, Adenauers Spalterpolitik und die Einbindung von Altnazis wie Theodor Oberländer, Hans Globke und Reinhard Gehlen kritisierte. Nach Jahresfirst, im Dezember 1955, setzte er sich nach Westberlin ab. Am 22. Dezember 1956 wurde er wegen Landesverrats zu vier Jahren Zuchthaus verurteilt, 1958 durch Bundespräsident Heuss begnadigt. Bis zu seinem Tode hielt er an seiner Darstellung fest, er sei entführt worden. Der Politwissenschaftler Helmut Jäckel urteilte in der Zeit 28/2004: »Gewichtige Indizien besagen: Der Geheimnisträger Otto John hat sich am 20. Juli 1954 freiwillig zu Gesprächen nach Ost-Berlin begeben. Innerlich bewegt von einem naiv-patriotischen Impetus, der deutschen Einheit auf eigene Faust voranzuhelfen, hat er nicht damit gerechnet, dass ihm die Rückkehr in den Westteil Berlins verlegt werden könnte. Als ihm dies bewusst wurde, mag er geglaubt haben, einen groben Fehler durch einen noch gröberen korrigieren zu können.« Der Historiker Erik Gieseking teilte 2005 diese Zweifel: »Über die Bewertung der Fakten kann man zu verschiedener Auffassung gelangen. Bislang gibt es keinen zugänglichen schlüssigen Beweis dafür, dass John freiwillig nach Ost-Berlin gegangen ist und dass er dort zum Verräter geworden ist. Alle dahingehenden Aussagen beruhen auf Indizien oder Zeugenaussagen.« Der Zeitungsverleger Axel Cäser Springer (1912-1985) verordnete allen Mitarbeitern vier Grundsätze, nach denen in den Redaktionen zu arbeiten war: »1. Das unbedingte Eintreten für die friedliche Wiederherstellung der Deutschen Einheit in Freiheit. 2. Das Herbeiführen einer Aussöhnung zwischen Juden und Deutschen, hierzu gehört auch die Unterstützung der Lebensrechte des israelischen Volkes. 3. Die Ablehnung jeglicher Art von politischem Totalitarismus. 4. Die Verteidigung der freien sozialen Marktwirtschaft.« Um im patriotischen Sinne eine Wiedervereinigung Deutschlands zu erreichen, traf sich Springer 1958 mit Nikita Chruschtschow. Bis auf ein ausführliches Interview für die Welt blieb das Treffen allerdings ergebnislos. In der gleichen Zeitung behauptete am 6. Juni 2009 der Zeitgeschichtler und »Stasi-Aufklärer« Jochen Staadt: 1958 »hatte der Verleger den etwas naiven Versuch unternommen, im Gespräch mit Chruschtschow eine Lösung der deutschen Frage zustande zu bringen. Das beobachtete die SED-Führung mit äußerstem Misstrauen, denn jedes Einvernehmen zwischen Moskau und der Bundesrepublik hätte womöglich der DDR geschadet. Axel Springer suchte damals, wenn man will, den Wandel durch Annäherung. Es ist schon komisch: Nicht, weil er ein kalter Krieger war, sondern, weil er den friedlichen Ausgleich mit der Sowjetunion suchte, kam sein Verlag SED und Stasi in die Quere.« Zwischenfrage der Zeitung: »Verstehen wir richtig, Ulbricht fürchtete, vom Springer Verlag könnte so etwas wie Entspannungspolitik ausgehen?« Darauf der zweite Interviewpartner, der Historiker Stefan Wolle: »Genau. Springer hatte damals die Politik Adenauers sehr scharf kritisiert. Und er wollte im direkten Gespräch mit Moskau versuchen, die DDR aus dem Einflussbereich der Sowjetunion zu lösen. Erst als dieser Versuch gescheitert war, nahm Springer eine Kehrtwendung vor und setzte sich scharf mit der DDR auseinander. Von da an versuchte die Stasi, den Verlag zu infiltrieren.«
- ↑ Niederschrift einer Unterredung zwischen L. I. Breschnew und Erich Honecker am 28. Juli 1970, in »Dokumente«, die Erich Honecker im Februar 1989 den Mitgliedern und Kandidaten des Politbüros des ZK der SED übergab.
- ↑ Max Reimann (1898-1977), Metallarbeiter, seit 1921 hauptamtlicher Funktionär der KPD, Teilnehmer der bewaffneten Ruhrkämpfe 1923, antifaschistischer Widerstand, 1940 Verurteilung wegen »Vorbereitung zum Hochverrat«, KZ Sachsenhausen bis zur Befreiung. 1948 Vorsitzender der KPD in den Westzonen, von 1949 bis 1953 Fraktionschef der KPD im deutschen Bundestag. Nach Haftbefehl 1954 Flucht in die DDR. Von dort führte er die verbotene KPD. Rückkehr in die BRD 1968. 1971 Eintritt in die DKP und deren Ehrenvorsitzender.
- ↑ Otto Brenner (1907-1972), 1922 Mitglied des Deutschen Metallarbeiterverbandes, 1926 SPD, 1931 SAPD, eine Abspaltung der SPD. Antifaschistischer Widerstand in Hannover, 1933 verhaftet, 1935 zu zwei Jahren verurteilt, 1945 SPD und 1947 Bezirksleiter der Gewerkschaften in Niedersachsen, organisierte dort den ersten Nachkriegsstreik. 1952 wurde er zunächst Zweiter und 1956 schließlich Erster Vorsitzender der IG Metall und 1961 Präsident des Internationalen Metallarbeiterbundes. Die IG Metall beteiligte sich an den Protesten gegen die Wiederbewaffnung, die Aufstellung atomarer Waffen, demonstrierte gegen die Bundesregierung zur Zeit der Spiegel-Affäre und stand schließlich an der Seite der APO zur Zeit der Notstandsgesetzgebung. »Nicht Ruhe, nicht Unterwürfigkeit gegenüber der Obrigkeit ist die erste Bürgerpflicht, sondern Kritik und ständige demokratische Wachsamkeit«, war sein Credo. Brenner war in den 50er und 60er Jahren der »programmatische Kopf« der Gewerkschaften in der BRD. Das Aktionsprogramm von 1956 und das DGB Grundsatzprogramm von 1963 wurden maßgeblich von Brenner geprägt.
- ↑ Die Westberlin-Frage beschäftige die DDR nicht erst seit 1958, als Chruschtschow die Drei-Staaten-Lösung ins Gespräch gebracht hatte. Berlin lag auf dem Territorium der sowjetischen Besatzungszone, unterlag aber dem Viermächte-Statut, d. h. es war in Gänze weder Teil der DDR noch der Bundesrepublik, wenngleich in den drei Westsektoren Westberlin – die gleiche Währung umlief wie in der BRD. Moskau wollte Westberlin als Freie Stadt unter anderem auch deshalb, um das Loch im Zaun zu schließen. Die Sektorengrenzen in Berlin waren offen, über Westberlin flüchteten viele Ostdeutsche in den Westen, und aus dem Westen drangen unbemerkt deren Geheimdienste in den Osten ein. Der DDR war aufgrund dieser ungeklärten Grenzlage großer materieller Schaden entstanden, zudem war auch die Gefahr eines Krieges real. Die DDR sollte nach Adenauers Verständnis »befreit« werden, und da diese für Bonn nicht Ausland war, hätte das jederzeit mit einer Polizeiaktion erfolgen können. Das aber wäre ein Angriff auf den Warschauer Pakt, dem die DDR angehörte, gewesen und würde das Bündnis zum Handeln verpflichten. Bekanntlich begannen die meisten Kriege mit Grenzkonflikten. Daher war Ulbrichts Frage, wie die westdeutsche Arbeiterklasse diese Problem reflektierte, nicht unwichtig.
- ↑ Mao Tse-tung (1893-1976) führte die KP Chinas von 1943 bis zu seinem Tode. Er rief am 1. Oktober 1949 die Volksrepublik China aus und sorgte mit seiner Politik dafür, dass aus dem rückständigen Agrarstaat eine wirtschaftliche, militärische und politische Großmacht wurde. Allerdings führten von ihm initiierte Kampagnen (»Großer Sprung nach vorn«, 1958-1961, und die »Kulturrevolution«, 1966-1976) zu erheblichen Rückschlägen, denen Millionen Menschen zum Opfer fielen. Deng Xiaoping, der spätere Reformpolitiker, stritt seine Mitverantwortung an dem Großen Sprung nicht ab und warnte davor, alle Schuld auf Mao zu schieben. Am 1. April 1980 sagte er dazu: »Maos Hirn ist damals heißgelaufen. Unsere Köpfe aber auch. Keiner hat ihm widersprochen, auch ich nicht.« Vergleichbare Äußerungen von Stalins Mitstreitern hörte man nicht.
- ↑ Boris N. Ponomarjow (1905-1995) war ein studierter Historiker, der in der Komintern auch mit Herbert Wehner zusammengearbeitet hatte. Wehner urteilte über ihn: Ponomarjow »zeichnete sich persönlich durch große Zurückhaltung, ausgeprägte Bescheidenheit im Auftreten und die Fähigkeit, seinem Gegenüber zuhören zu können, aus; er gehörte zu einem speziellen Typ junger russischer Funktionäre, der durch die Schule der persönlichen Umgebung Stalins gegangen war«. Ponomarjow war von 1961 bis 1986 Sekretär des ZK der KPdSU und für die internationalen Beziehungen der Partei und für ideologische Fragen zuständig.
- ↑ Max Spangenberg (1907-1987), Mitarbeiter der Kommunistischen Internationale in Moskau vor 1933, Spanienkämpfer, ab 1951 Chefredakteur der Berliner Zeitung und von 1954 bis zu dessen Auflösung 1971 Leiter des Arbeitsbüros der Westkommission des Politbüros des ZK der SED. Danach Mitarbeiter des Instituts für Marxismus-Leninismus (IML) in Berlin.
- ↑ 1963 war Walter Ulbricht vom Obersten Sowjet der UdSSR der Ehrentitel »Held der Sowjetunion« verliehen worden.
- ↑ In Krasnogorsk, während der Schlacht um Moskau 1941 schwer umkämpft, befand sich das Kriegsgefangenenlager Nr. 27. Dort wurde im Juli 1943 das Nationalkomitee »Freies Deutschland« (NKFD) gegründet, zwei Monate später der »Bund Deutscher Offiziere« (BDO). Daran waren maßgeblich deutsche Emigranten wie Walter Ulbricht, Wilhelm Pieck und andere KP-Funktionäre beteiligt. Im ehemaligen Gebäude der Zentralen antifaschistischen Schule für Kriegsgefangene wurde 1985 in Anwesenheit von Vertretern aus der DDR und der BRD das »Memorialmuseum deutscher Antifaschisten« eröffnet. Heute ist die Einrichtung eine Filiale des Moskauer Zentralmuseums des Großen Vaterländischen Krieges.
- ↑ Die Staatliche Gemäldegalerie Dresden hatte die Kunstwerke aus begründeter Furcht vor der Vernichtung ausgelagert. Diese etwa anderthalbtausend Gemälde galten als vermisst, bis 1955 die Regierung der Sowjetunion 1.240 Gemälde nach erfolgter Restaurierung zurückgab. 1963 informierte die DDR, dass 206 Kunstwerke zerstört worden seien und 507 noch vermisst würden. Heute werden noch immer etwa 450 Gemälde vermisst.
- ↑ Der Begründer der Sowjetunion war am 22. April 1870 als Wladimir Iljitsch Uljanow in Simbirsk zur Welt gekommen, weshalb man das Jahr, in welchem er 100 geworden wäre, zum Leninjahr erklärte und eine Vielzahl von Veranstaltungen und Ehrungen, Wettbewerbe und Konferenzen diesem Anlass widmete.
- ↑ Erich Wendt (1902-1965), gelernter Schriftsetzer, 1925/26 Redakteur im Verlag der Kommunistischen Jugendinternationale in Moskau, danach beim ZK des KJVD in Berlin tätig. 1931 Emigration in die Sowjetunion, 1936 Opfer der Parteisäuberung und Ausschluss aus der KPD, 1937 bis 1939 Verbannnung in Sibirien, 1941 neuerliche Deportation. Von 1942 bis 1947 Mitarbeiter bei Radio Moskau, danach Rückkehr nach Berlin und Leiter des Aufbauverlages. Von 1949 bis 1965 gehörte er dem Präsidialrat des Kulturbundes der DDR an, von 1951 bis 1953 war er dessen 1. Bundessekretär, seit 1958 Vizepräsident. Von 1950 bis 1958 war Erich Wendt Abgeordneter der Volkskammer und Vorsitzender der Kulturbund-Fraktion. Von 1953 bis 1957 leitete er die Lenin-Abteilung im Institut für Marxismus-Leninismus beim Zentralkomitee der SED (IML). Von 1957 bis 1965 war er Stellvertreter, danach Staatssekretär im Ministerium für Kultur der DDR. 1963 war Erich Wendt an den Verhandlungen zum Passierscheinabkommen mit Westberlin maßgeblich beteiligt. Wendt war zunächst Lebensgefährte von Lotte Kühn (verheiratete Ulbricht), dann mit Charlotte Treuber liiert, einer ehemaligen Lebensgefährtin Herbert Wehners
- ↑ Das Museum im einstigen Wehrmacht Kasino wurde zum Jahrestag der Befreiung 2013 nach Rekonstruktion als Deutsch Russisches Museum Berlin-Karlshorst, wie es seit 1995 heißt, nach einjährigem Umbau wiedereröffnet. In einem Ausstellungsbericht hieß es am 25. April 2013 im Berliner Tagesspiegel: »Das wiedereröffnete Deutsch Russische Museum zeichnet eine erschütternde Spur der Verbrechen nach: die gnadenlose Verfolgung politischer Kader, das Aushungern der sowjetischen Zivilbevölkerung und der Kriegsgefangnen, die Politik der verbrannten Erde.« Ein Dokumentarfilm »zeigt den bis zur letzten Sekunde eitlen deutschen Oberkommandierenden Generalfeldmarschall Keitel, der später als einer der Hauptkriegsverbrecher hingerichtet wurde. Sowjetmarschall Shukow schaut angemessen ernst. Ob er, der größte aller sowjetischen Kriegshelden, in diesem Moment an die hunderttausende gefallener Rotarmisten denkt, die seine Siege ebenso säumen wie seine Niederlagen? Von Siegen und Niederlagen ist im Museum kaum noch die Rede. Ein einziger der zehn Themenräume ist der Chronik des Krieges gewidmet. Und selbst die ist kursorisch genug.«
- ↑ Karl Polak (1905-1963), Jurist, promovierte 1933 und emigrierte unmittelbar danach als Jude in die Sowjetunion. 1946 kehrte er in die sowjetisch besetzte Zone zurück. Er trat der SED bei und wurde Leiter der Abteilung Justizfragen beim Parteivorstand. Er war einer der Autoren der vom Verfassungsausschuss des Deutschen Volksrates erarbeiteten gesamtdeutschen Verfassung, die 1949 als DDR-Verfassung angenommen wurde. 1949 übernahm er eine Professur an der Leipziger Universität und beriet Walter Ulbricht in Staats- und Rechtsfragen. Er gehörte zu den 20 Mitgliedern des 1960 gegründeten Staatsrates der DDR
- ↑ In der Lehrpraxis wurden die betreffenden Rechtsfragen als »Staatsrecht II« behandelt; später fand das Rechtsgebiet »Verwaltungsrecht« ganz offiziell – wieder seinen gebührenden Platz im vom Minister für das Hoch- und Fachschulwesen bestätigten Studienplan der Grundstudienrichtung »Rechtswissenschaft«.
- ↑ Siehe Erich Buchholz, Richard Hartmann, John Lekschas: Sozialistische Kriminologie, Staatsverlag der DDR, Berlin 1966
- ↑ 1972 wurde diese Möglichkeit durch einen Federstrich abgeschafft: die halbstaatlichen Betriebe wurden durch Verstaatlichung gegen Entschädigung volkseigen. Der in der Nachfolge von Hilde Benjamin seit 1967 amtierende Justizminister Kurt Wünsche (LDPD) reagierte darauf mit seiner Demission. Soweit die Enteigneten nach 1990 ihre Betriebe von der Treuhandanstalt zurückerhielten, mussten sie die von der DDR gewährte Entschädigung zurückzahlen. Nicht wenige dieser Unternehmen gingen pleite, weil die Treuhand erbarmungslos auf ihren Zahlungsforderungen bestand.
- ↑ Die Aufgaben des Ministerrates wurden im Art. 78 der DDR-Verfassung bestimmt. Er »organisiert im Auftrage der Volkskammer die politischen, ökonomischen, kulturellen und sozialen sowie die ihm übertragenen Verteidigungsaufgaben des sozialistischen Staates.«
- ↑ Dr. Heinrich Hohmann (NDPD) wurde die Leitung einer Arbeitsgruppe übertragen, der der Generalstaatsanwalt der DDR, ein dem Präsidium des Obersten Gerichts der DDR angehörender Oberrichter sowie weitere mit der Rechtspflege befasste Vertreter von Behörden sowie ich als Strafrechtswissenschaftler angehörten. Vgl. Erich Buchholz: »Strafrecht im Osten. Ein Abriss über die Geschichte des Strafrechts in der DDR«, Berlin 2008.
- ↑ Diese fundamentale verfassungsrechtliche Aussage wurde bewusst in Art. 48 fixiert, weil die Weimarer Verfassung in ihrem Art. 48 die weitreichenden Vollmachten des Reichspräsidenten enthielt, die letztlich den Weg zur Ernennung Hitlers zum Reichskanzler durch den Reichspräsidenten von Hindenburg eröffneten.
- ↑ Zur Missachtung dieses Rückwirkungsverbots bei der rechtswidrigen Strafverfolgung von DDR-Bürgern durch die bundesdeutsche Strafjustiz nach 1990 siehe Erich Buchholz: »DDR-Strafrecht unterm Bundesadler«, Berlin 2011
- ↑ Diese Festlegung ist somit nicht nur ein Auftrag an den Gesetzgeber wie der Art. 26 GG.
- ↑ In meinem gemeinsam mit Gerhard Schulze verfassten Aufsatz »Der sozialistische Rechtsstaat und die verfassungsmäßigen Grundlagen der sozialistischen Gesetzlichkeit und Rechtspflege in der DDR« in: Staat und Recht, Heft 6, 1989, S. 476, forderten wir, die Bestimmung durch entsprechende gesetzliche Regelungen zu untersetzen, etwa durch ein Initiativrecht, Prüfungsverfahren und weitere, wesentlich prozessuale Regelungen.
- ↑ Gustav Radbruch (1878-1949), Jurist, Reichstagsabgeordneter (SPD) und Justizmininister von 1921 bis 1923. Er lehrte seit 1926 in Heidelberg. Am 8. Mai 1933 wurde er von den Nazis als erster deutscher Professor aus dem Staatsdienst entlassen. In Heidelberg setzte er 1945 seine Lehrtätigkeit fort, er wurde 1948 gebeten, in der Verfassungskommission des Deutschen Volksrates mitzuarbeiten.
- ↑ Gerhard Kegel (1907-1989), KPD 1931, als Auslandskorrespondent in Warschau 1933 von der sowjetischen Militäraufklärung GRU angeworben. Von 1945 bis 1949 Chefredakteur der Berliner Zeitung, danach Stellvertretender Chefredakteur des Neuen Deutschland. Von 1955 bis 1972 außenpolitischer Berater von Walter Ulbricht. 1959 nahm er als Gesandter an der Genfer Außenministerkonferenz der Großmächte teil. 1967 bis 1971 Kandidat des ZK der SED, von 1973 bis 1976 Botschafter und Leiter der Ständigen Vertretung der DDR bei der UNO in Genf.
- ↑ Wie dies gemeint war, ist in dem 1969 im Staatsverlag erschienenen Band 1 »Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Dokumente. Kommentar«, herausgegeben von Klaus Sorgenicht, Wolfgang Weichelt, Tord Riemann und Hans-Joachim Semler, nachzulesen. Im Kommentar zu Artikel 1 der Verfassung und der Formulierung »sozialistischer Staat deutscher Nation« heißt es dort: »Damit ist verfassungsrechtlich verankert, dass der über ein Jahrhundert währende revolutionäre Kampf der deutschen Arbeiterklasse gegen die imperialistische deutsche Großbourgeoisie und das mit ihr verbündete Junkertum in der DDR zum Siege geführt hat und ein Teil der Nation, befreit von der Unterdrückung und Ausbeutung durch das Kapital, den Weg in die Zukunft der gesamten deutschen Nation bereits erfolgreich beschreitet. Unter Führung ihrer marxistisch leninistischen Partei hat die Arbeiterklasse gemeinsam mit ihren Verbündeten auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik nach der Zerschlagung des Hitlerfaschismus die Wurzeln von Nazismus und Imperialismus ausgerottet und sich ihre eigene Staatsmacht geschaffen.« Da die einzelnen Kommentare namentlich nicht gekennzeichnet sind, müssen alle Personen des aufgeführten Autorenkollektivs angeführt werden: Reiner Arlt, Herbert Edeling, Gerd Egler, Dieter Heinze, Klaus Heuer, Uwe-Jens Heuer, Gerhard Kegel, Helmut Koziolek, Walter Krutzsch, Frithjof Kunz, Lothar Oppermann, Eberhard Poppe, Tord Riemann, Heinz Schmidt, Gerhard Schüßler, Hans Joachim Semler, Klaus Sorgenicht, Hans Voß und Wolfgang Weichelt.
- ↑ In den 2013 von Egon Bahr veröffentlichten Buch »Das musst du erzählen. Erinnerungen an Willy Brandt« heißt es wörtlich: »Mir wurde zunehmend bewusst, dass er (gemeint ist Adenauer – d. Hrsg.) und Walter Ulbricht kongenial waren. Jeder der beiden wollte seinen Landesteil sichern und sein Gewicht im jeweiligen Lager, ob Ost oder West, erhöhen. Und jeder erwies sich als die in seinem Teilstaat stärkste Persönlichkeit, die die politische Szenerie beherrschte.«
- ↑ Lotte und Walter. Die Ulbrichts in Selbstzeugnissen, Briefen und Dokumenten, Berlin 2003. Bei amazon.de kommentierte ein Francius Palladio: »Die political correctness ignorierend, hat Frank Schumann ein wichtiges Buch über ein wichtiges deutsches Politiker Ehepaar veröffentlicht. Ein gutes Buch, eine wahrhaftige Perle und ein weiterer gelungener Versuch, der westlichen Geschichtsfälschung und Hetze Fakten und differenzierte Analysen entgegenzustellen. Lotte und Walter Ulbricht und deren Lebenswerk sollte unserer Nachwelt in guter Erinnerung bleiben.«
- ↑ Beschluss des Politbüros des ZK der SED vom 8. Januar 1952
- ↑ Rudolf Thunig (1899-1983), Kaufmannslehre, 1918 Spartakusbund, dann KJVD und KPD, Leiter des Partei-Verlages »Junge Garde« von 1920 bis 1922. Danach, bis 1935, Mitarbeiter im Westeuropäischen Büro der Kommunistischen Jugendinternationale. 1935 verhaftet und zu zwölf Jahren Zuchthaus verurteilt, die er im Zuchthaus Brandenburg Görden (1937-1939 und 1943-1945), im KZ Börgermoor (1939-1941) und im Zuchthaus Sonnenburg (1941-1943) zubrachte. Ab März 1949 leitete er das Büro des Sekretariats des Parteivorstandes bzw. des Zentralkomitees der SED. Von 1952 bis 1975 war er stellvertretender Abteilungsleiter im Büro des Politbüros.
- ↑ Otto Schön (1905-1968), Versicherungs- und Bankangestellter, dann Funktionär des KJVD, der KPD und seit 1930 der Roten Hilfe. Von 1933 bis 1936 Zuchthaus Bautzen, dann KZ Sachsenburg. Nach Entlassung weiter illegal aktiv. 1945 Sekretär der Kreisleitung Leipzig der KPD, von 1947 bis 1952 2. Sekretär der Landesleitung Sachsen der SED, seit 1950 ZK Mitglied, dann, in der Nachfolge Rudi Thunigs, Leiter des Büros des Politbüros und persönlicher Mitarbeiter Walter Ulbrichts. Mitglied der Volkskammer von 1958 bis 1968.
- ↑ Noel Field (1904-1970), US-Diplomat, Kommunist und Mitarbeiter des sowjetischen Nachrichtendienstes. Als Antifaschist unterstützte er Emigranten in der Schweiz und in Frankreich. 1949 wurde er unter dem Vorwurf der Spionage in Prag verhaftet und in Ungarn verurteilt, auch sein Bruder Hermann, seine Frau und die Adoptivtocher wurden festgenommen. In der Folge fanden inszenierte Schauprozesse statt, in denen namhafte Funktionäre, die mit Field jemals zu tun hatten, zum Tode verurteilt wurden, u. a. Rudolf Slansky, Generalsekretär der KPTsch, Laszló Rajk, Ungarns Außenminister, Ludwig Freund, Berater des tschechoslowakischen Präsidenten und enger Freund Johannes R. Bechers, und Otto Katz (d. h. André Simon), Chef der Presseabteilung des Prager Außenministeriums. Field wurde 1955 aus der Haft entlassen, teilweise rehabilitiert und finanziell entschädigt. Auch seine verhafteten Familienmitglieder wurden entlassen und durften ausreisen. Er selbst lebte bis zu seinem Tod in Ungarn.
- ↑ Edith Baumann (1909-1973), Stenotypistin, Mitglied der Reichsleitung der Jungsozialisten in den 20er Jahren, 1931 Eintritt in die SAPD, im März 1933 Vorstandsmitglied, danach (bis 1936) Haft. 1945 SPD, 1946 FDJ und bis 1949 Stellvertretende Vorsitzende des Jugendverbandes. Von 1949 bis 1953 Mitglied des Sekretariats des ZK der SED, danach, bis 1955, Sekretär der Bezirksleitung Berlin der SED. Von 1958 bis 1963 Kandidat des Politbüros. Edith Baumann war von 1947 bis 1953 mit Erich Honecker verheiratet, aus dieser Verbindung ging eine Tocher (Erika) hervor.
- ↑ Mia Niederkirchner (1911-1982) war die jüngere Schwester von Käthe Niederkirchner, die 1943 über Polen absprang und sich nach Berlin durchschlagen sollte, um dort den antifaschistischen Widerstand zu organisieren. Sie wurde von der Gestapo aufgespürt und schließlich im KZ Ravensbrück inhaftiert. Dort wurde sie im September 1944 von der SS erschossen. Mia Niederkirchner lebte im Moskauer Hotel Lux, wo sie Karl Dienstbach, Emigrant aus Frankfurt am Main, kennenlernte. Aus dieser Beziehung ging Käte (ohne h) Niederkirchner hervor, die am 30. Januar 1944 in Tscheljabinsk zur Welt kam. Käte Niederkirchner wurde 1967 in die Volkskammer (FDJ-Fraktion) gewählt, war dort die jüngste Abgeordnete und seit 1976 als Kinderärztin im Ausschuss für Gesundheitswesen. Nach den Wahlen am 18. März 1990 wurde sie für die PDS Vizepräsidentin der Volkskammer.
- ↑ Wilhelm Zaisser (1893-1958) und Rudolf Herrnstadt (1903-1966) versuchten um den 17. Juni 1953 – mit Rückendeckung Berijas Ulbricht von seiner Funktion zu entfernen. Im Juli 1953 erfolgte ihr Ausschluss aus dem Politbüro und dem ZK, im Januar 1954 aus der SED. Zaissers Frau Elisabeth, seit 1952 in der Nachfolge Paul Wandels Ministerin fürVolksbildung, trat zurück. 1993 wurde Wilhelm Zaisser von der PDS rehabilitiert. Herrnstadt wurde eine Tätigkeit im Zentralarchiv Merseburg zugewiesen.
- ↑ Richard Herber (1911-1986), Buchdrucker, 1929 SPD, 1931 KPD, illegale Arbeit. Nach amerikanischer Kriegsgefangenschaft Neulehrer, Besuch der Parteihochschule »Karl Marx 1948/49, anschließend im ZK-Apparat tätig. Von 1953 bis zu seinem Tod persönlicher Mitarbeiter Ulbrichts, daneben – von 1958 bis 1968 – 1. Sekretär der Parteiorganisation des ZK und Leiter des Büros Ulbricht. Seit 1967 ZK-Mitglied.
- ↑ Der von Bundeskanzler Adenauer und dem EKD-Ratsvorsitzenden Bischof Otto Dibelius, von Verteidigungsminister Franz Josef Strauß und dem Präsidenten der Kirchenkanzlei, Heinz Brunotte, am 22. Februar 1957 unterzeichnete Vertrag regelte die Militärseelsorge in der Bundeswehr. Zwar legte man Wert auf die Unterscheidung zur Militärseelsorge im Kaiser- und im Nazireich, die Militärgeistlichen seien – im Unterschied zu damals – »frei von staatlicher Einflussnahme«, doch Zweifel waren (und sind) berechtigt. Rechtsgrundlage für die Arbeit der katholischen Militärseelsorger in der Bundeswehr ist bis heute das Reichskonkordat von 1933. Bereits im März 1957 lehnte DDR Verteidigungsminister Willi Stoph »Verhandlungen« mit der EKD, einer »NATO Kirche«, über eine kirchliche Tätigkeit in der Nationalen Volksarmee ab. Und auch nach 1990 mochten die Landesleitungen der Kirchen in den sogenannten Neuen Bundesländern diesem Militärseelsorgevertrag nicht folgen, denn die Nähe zum Staat war nicht zu übersehen: Die Militärgeistlichen, die Pfarrer in Uniform, waren schließlich Staatsbeamte. Also stellte man die ostdeutschen Landeskirchen zunächst mit einer Übergangslösung ruhig. Seit Anfang 2004 gilt aber der (westdeutsche) Militärseelsorgevertrag uneingeschränkt auch in Ostdeutschland.
- ↑ Otto Dibelius (1880-1967), evangelischer Theologe, trat 1945 der CDU bei, legte sich selbst den Bischofstitel zu und verstand sich bis 1966 als »Bischof von Berlin Brandenburg«. In dieser Eigenschaft war er von 1949 bis 1961 zugleich Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Dibelius vertrat nach dem Ersten Weltkrieg die »Dolchstoßlegende« von der im Felde unbesiegten Truppe. 1928 bekannte er sich in seinem »Oster-Brief an die Pfarrer« zum Antisemitismus: »Für die letzten Motive, aus denen die völkische Bewegung hervorgegangen ist, werden wir alle […] volle Sympathie haben. Ich habe mich […] immer als Antisemiten gewusst.« Dibelius begrüßte den Machtantritt Adolf Hitlers. Am 21. März 1933 hielt er in seiner Eigenschaft als zuständiger Generalsuperintendent die Festpredigt am »Tag von Potsdam« in der Garnisonkirche. Darin lobte er Hitler und seine Clique für die Maßnahmen nach dem Reichstagsbrand, mit denen Regimegegner verhaftet und staatsbürgerliche Rechte weitgehend außer Kraft gesetzt worden waren. Auch als am 1. April 1933 der Boykott der SA gegen jüdische Geschäfte erfolgte, stellte er sich hinter den Hitlerstaat und erklärte: »Schließlich hat sich die Regierung genötigt gesehen, den Boykott jüdischer Geschäfte zu organisieren – in der richtigen Erkenntnis, dass durch die internationalen Verbindungen des Judentums die Auslandshetze dann am ehesten aufhören wird, wenn sie dem deutschen Judentum wirtschaftlich gefährlich wird. Das Ergebnis dieser ganzen Vorgänge wird ohne Zweifel eine Zurückdämmung des jüdischen Einflusses im öffentlichen Leben Deutschlands sein. Dagegen wird niemand im Ernst etwas einwenden können.« Am 7. September 1949 hielt Dibelius die Festpredigt zur Eröffnung des Deutschen Bundestages in Bonn. Nachdem er 1953 mit dem Großkreuz der Bundesrepublik Deutschland geehrt worden war, wurde Dibelius 1958 auch die (West )Berliner Ehrenbürgerschaft verliehen.
- ↑ Emil Fuchs (1874-1971), Theologe und Pfarrer, seit 1921 SPD. Nach langen politisch motivierten Konflikten mit der evangelischen Kirche Thüringens und seiner Gemeinde wurde er 1931 an die Pädagogische Akademie Kiel berufen. Im April 1933 beurlaubt, wurde Fuchs am 20. September 1933 entlassen und kurzzeitig inhaftiert. Er stand danach unter Überwachung durch die Gestapo. Nach Gründung der DDR übersiedelte er nach Leipzig, wo er – inzwischen 75-jährig Professor für systematische Theologie und Religionssoziologie wurde. Fuchs erwirkte bei der DDR-Regierung die Möglichkeit der Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe (Bausoldaten) und protestierte – bei grundsätzlicher Loyalität zum Staat DDR Anfang der 50er Jahre gegen die Verfolgung der Jungen Gemeinde sowie 1968 gegen den Abriss der Leipziger Universitätskirche. Die CDU der DDR verlieh ihm eine »Ehrenmitgliedschaft«. Nach seiner Emeritierung 1959 trat Fuchs aus der evangelischen Kirche aus. Emil Fuchs verfasste mehrere wichtige religiös-sozialistische Schriften, unter anderem die »Christliche und marxistische Ethik«. Er wurde mit dem Vaterländischen Verdienstorden und dem »Banner der Arbeit« geehrt.
- ↑ Moritz Mitzenheim (1891-1977), Theologiestudium in Leipzig, Berlin, Jena und Heidelberg, Pfarrer. Von 1945 bis 1970 Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Thüringen. Delegierter des Deutschen Volkskongresses, von 1955 bis 1961 Mitglied der EKD. Die DDR ehrte ihn 1961 mit dem Vaterländischen Verdienstorden in Gold.
- ↑ Gerhard Lotz (1911-1981), Studium der Theologie, Philosophie und Jura in Frankfurt am Main, Göttingen, Leipzig und Königsberg, Kirchenjurist, nach Kriegsgefangenschaft 1946 Oberkirchenrat und Leiter der Rechtsabteilung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen, seit 1948 stellvertretender Vorsitzender des Landeskirchenrates und Mitglied der Thüringer Synode bis zum Eintritt in den Ruhestand 1969. Mit Bischof Mitzenheim konzipierte er den »Thüringer Weg«. Mitglied der CDU seit 1945, seit 1956 gehörte er dem Hauptvorstand an, Mitglied des DDR-Friedensrates und des Weltfriedensrates. Von 1967 bis 1976 Volkskammerabgeordneter.
- ↑ Aufgrund der Grenzsicherungsmaßnahmen am 13. August 1961 war es Westberlinern nicht mehr möglich, den Ostteil der Stadt und damit Verwandte, Freunde und Bekannte zu besuchen. Das Problem war weniger die DDR, sondern die BRD und Westberlin. Man verweigerte jeden Kontakt mit Dienststellen der DDR, um den Eindruck nicht aufkommen zu lassen, man würde diesen Staat und seine Institutionen anerkennen und akzeptieren. 1963 riskierte Willy Brandt als Regierender Bürgermeister von Berlin einen Vorstoß, auf welchem der Vizepremier Alexander Abusch am 5. Dezember 1963 mit einem Schreiben positiv reagierte. Zwölf Tage später unterzeichneten DDR-Staatssekretär Erich Wendt und der Senatsrat Horst Korber das erste Passierscheinabkommen, das aus diplomatischen Gründen nur »Passagierscheinprotokoll« heißen durfte. Zwischen dem 19. Dezember 1963 und dem 5. Januar 1964 passierte etwa 700.000 Westberliner die Grenze. Bis 1966 folgten drei weitere Passierscheinabkommen.
- ↑ Helga Wittbrodt (1910-1999), Medizinstudium in Berlin, 1930 SPD, 1936 Promotion, Ober- und Fachärztin am Berliner Krankenhaus Am Urban. Tätig im antifaschistischen Widerstand. 1945 KPD, Chefärztin und Direktorin des Städtischen Krankenhauses in Berlin-Tempelhof, Entlassung 1948 und Übersiedlung in den Ostteil Berlins, Chefärztin an der Charité. 1949 wurde sie zur Chefärztin und Ärztlichen Direktorin des Regierungskrankenhauses der DDR berufen. Diese Einrichtung prägte sie bis 1988. Mitglied der Volkskammer (für den DFD) von 1950 bis 1990
- ↑ Die Krankengeschichte Ulbrichts ist dokumentiert in: »Walter und Lotte. Die Ulbrichts in Selbstzeugnissen, Briefen und Dokumenten.« Herausgegeben von Frank Schumann, Berlin 2003. Ulbricht hatte am 14. Juni 1971 gegen 22.30 Uhr einen Kreislaufkollaps erlitten, nachdem er Stunden zuvor Breshnew, am Vorabend des Parteitages, auf dem Flugplatz begrüßt hatte. Danach hatte er am Empfang für die auswärtigen Parteitagsgäste teilgenommen. Seine vorbereitete Rede trug anderentags Hermann Axen vor. In der Nacht vom 18. auf den 19. Juni erlitt Ulbricht eine weitere Herzattacke. Bis auf altersbedingte Verschleißerscheinungen und Probleme mit dem Blutdruck war Ulbricht bis Ende der 60er Jahre in guter Verfassung gewesen. Die einzige Operation – ein Eingriff an der Gallenblase – war vor langer Zeit im Kreml-Krankenhaus erfolgt. Anfang 1966 und im Sommer hatte es jedoch erstmals Durchblutungsprobleme am Herzen gegeben. Nichts Ernstes, aber Fingerzeige. Im Herbst 1969 jedoch reduzierte ein grippaler Effekt die Leistungsfähigkeit erkennbar, hinzu kam ein stetig steigender Blutdruck. Kuren in Barwycha bei Moskau – die letzte erfolgte im Frühjahr 1971 – besserten nur kurzzeitig das Befinden. Dass ein kausaler Zusammenhang zwischen seiner sich verschlechternden Gesundheit und dem extremen psychischen Druck bestand, dem Ulbricht seit 1968 ausgesetzt war, sahen auch Nichtmediziner. Ulbricht spürte das Schwinden seiner Kräfte und bat seinen Arzt Arno Linke wiederholt zu Jahresbeginn 1971: »Bis Ende Juni muss ich durchhalten, dann machen Sie mit mir, was Sie wollen, Doktor!« In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli, vier Wochen nach dem Parteitag, erlitt Ulbricht einen Herzinfarkt. Erst jetzt stimmte er einem Krankenhausaufenthalt zu. Durch den Infarkt waren Teile des Gehirns ungenügend durchblutet worden. Dadurch traten in der Folge halbseitige Lähmungserscheinungen auf. Hinzu kamen Probleme mit dem Verdauungstrakt. Ulbricht hatte, um für den Parteitag das erforderliche Sitzfleisch zu haben, viel Obst und Gemüse gegessen und Abführmittel genommen. Die Selbstbehandlung begann sich zum Darmverschluss zu entwickeln, der aber ohne operativen Eingriff behoben werden konnte. Gleichwohl hatte Lotte Ulbricht Grund zu Sorge. »Schon bei einem Wetterwechsel können Kreislaufkomplikationen – auch mit tödlichem Ausgang – auftreten«, hatte man ihr vor der Krankenzimmertür gesagt. Ulbricht, langsam genesend, reagierte auf den Vorschlag des Politbüros, eine Meldung über seinen Gesundheitszustand an die Presse zu geben. Er formulierte nach Konsultationen mit den Ärzten selber eine, Lotte Ulbricht tippte sie ab. Handschriftlich fügte Ulbricht hinzu: »Lieber Erich! Vorstehend der Entwurf der Pressemitteilung, die nach Konsultation der Ärzte vorgeschlagen wird. Ich bitte die Genossen des Politbüros um Zustimmung. 9.8.71. Mit freundlichen Grüßen, Walter.« Auf dem ZK-Plenum im September, vier Wochen später, gab Honecker Ulbrichts Krankenakten seit 1966 in Umlauf. Am 26. Oktober 1971 nahm Ulbricht überraschend an der Politbürositzung teil, auf der er scharf seinen Nachfolger wegen der Veröffentlichung seiner Krankengeschichte kritisierte, was einen Verstoß gegen geltendes Recht und gegen die Leninschen Parteinormen darstellte. Eine derartige Niedertracht war in der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung ohne jedes Beispiel. Danach erlitt Ulbricht jenen Kreislaufkollaps, den Rainer Fuckel behandelte. Anschließend legte Honecker fest, dass Ulbricht als Staatsratsvorsitzender täglich nur noch drei bis vier Stunden arbeiten, aber nicht mehr reisen dürfe. Seine Teilnahme an Sitzungen wurde auf zwei Stunden, seine Redezeit auf eine Viertelstunde begrenzt. »Das bedeutet, dass wir keine weiteren Diskussionen führen werden.« Im November 1971 wählte die Volkskammer Ulbricht noch einmal zum Staatsratsvorsitzenden, obgleich Günter Mittag auf der Politbürositzung am 26. Oktober hatte erkennen lassen, dass das nicht gewünscht war: »Ist es überhaupt richtig und zweckmäßig, dass du wieder als Vorsitzender des Staatsrates vorgeschlagen wirst? Dein Verhalten rechtfertigt das nicht.«
- ↑ Die agra in Leipzig-Markkleeberg war die Landwirtschaftsausstellung der DDR auf 190 Hektar. Sie wurde alljährlich seit 1952 abgehalten und war für internationales Fachpublikum und für die Öffentlichkeit geöffnet. Es handelte sich um eine nachgeordnete Einrichtung des Ministeriums für Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR. Es wurden landwirtschaftliche Geräte, Maschinen, Stallanlagen und Verfahrenstechniken sowie Tierleistungsschauen gezeigt. Seit Mitte der 60er Jahre (bis 1990) präsentierte sie sich als Dauerausstellung.
- ↑ Am 19. Juni 1971, am Rande des Parteitages, hatte Breshnew Ulbricht in Wandlitz besucht. Am 20. Juni kam Honecker für eine Stunde, am 25. Juni noch einmal und etwas länger. Am 30. Juni kamen Honecker und das gesamte Politbüro zum Gratulieren, es entstand jenes bloßstellende Foto im Hausmantel und mit Pantoffeln. Danach kam keiner mehr zu Besuch. In jener Zeit trat Rainer Fuckel in Wandlitz seinen Dienst bei Ulbricht an.
- ↑ Vgl. Heinz Keßler/Fritz Streletz, Ohne die Mauer hätte es Krieg gegeben. Berlin 2011.
- ↑ Vgl. W. I. Lenin: Lieber weniger, aber besser, Moskau 1947, S. 1007
- ↑ Vgl. Herbert Graf: Mein Leben. Mein Chef Ulbricht. Meine Sicht der Dinge, Berlin 2008, und ders.: Interessen und Intrigen. Wer spaltete Deutschland, Berlin 2011
- ↑ Dokument Nr. 158 »Protokoll der Berliner Konferenz der drei Großmächte«, in: Die Potsdamer (Berliner) Konferenz der Höchsten Repräsentanten der drei alliierten Mächte UdSSR, USA und Großbritannien Dokumentensammlung, Progress Verlag Moskau/ Staatsverlag der DDR 1986, S. 285
- ↑ Vgl. Schreiben von Rudolf Herrnstadt an W. S. Semjonow vom 28. November 1962, in: Rudolf Herrnstadt: Das Politbüro der SED und die Geschichte des 17. Juni 1953, Hrsg. von Nadja Stulz-Herrnstadt, Reinbek bei Hamburg 1990, S. 264ff.
- ↑ Vgl. Brief von Mitgliedern des Politbüros des ZK der SED an L. I. Breshnew vom 21. Januar 1971, SAPMO-BArch DY 30/2119, Bl. 65-98
- ↑ Vgl. Wolfgang Leonhard und Mario Frank im Beitrag des MDR »Historische sächsische Persönlichkeiten« vom 26. November 2006
- ↑ Sebastian Haffner: Ulbricht. Ein Essay«, in: konkret, Zeitschrift für Politik und Kultur, Hamburg, September 1966
- ↑ Gerhard Zwerenz, zitiert in: Sebastian Haffner: Ulbricht. Ein Essay, a. a. O.
- ↑ Wolfgang Leonhard: Meine Geschichte der DDR, Berlin 2007, S. 59
- ↑ Vgl. »Zur Stalinismus-Debatte. 50 Jahre nach dem XX,. Parteitag der KPdSU«, Erklärung der Historischen Kommission beim Parteivorstand der Linkspartei/PDS vom 7. Februar 2006
- ↑ Fritz Stern: Fünf Deutschlands und ein Leben, München 2009, S. 225
- ↑ Julij A. Kwizinskij: Vor dem Sturm. Erinnerungen eines Diplomaten, Berlin 1993. S. 165
- ↑ Zentralarchiv des FSB Nr. 33543, Band 1, Blatt 200-202
- ↑ Georgi Dimitroff: Tagebücher 1933-1945, Berlin 2000, S. 249
- ↑ Vgl. Mario Frank: Walter Ulbricht, eine deutsche Biographie, Berlin 2001, S. 137; Herbert Wehner: Persönliche Notizen 1929 1942, Köln 1982, S. 189
- ↑ SAPMO-BArch NY 4036/736
- ↑ »70 Jahre Kampf für Frieden und das Wohl des Volkes, Thesen des ZK der SED zum 70 Jahrestag der KPD«, Beschluss der 6. Tagung des ZK der SED an 9./10. Juni 1988, Berlin 1988, S. 49f.
- ↑ Vgl. Werner Eberlein: Geboren am 9. November. Erinnerungen, Berlin 2000
- ↑ Werner Eberlein: Mein Leben war eine Achterbahn, in: Neues Deutschland vom 2./3. September 2000, S. 19
- ↑ Vgl. Markus Wolf: Spionagechef im geheimen kalten Krieg, Düsseldorf und München 1997, S. 118
- ↑ Vgl. Zweiter Tätigkeitsbericht des Forschungsbeirates für Fragen der Wiedervereinigung. Hrsg. Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen, Bonn 1957
- ↑ a. a. O., S. 81
- ↑ P. A. Thiessen: Begegnungen mit Walter Ulbricht«, Berlin-Weimar 1968 , S. 331f.
- ↑ Telegramm Walter Ulbrichts an das Präsidium des ZK der KPdSU vom 19. März 1956; SAPMO-BArch, DY 30J IV2/202/315
- ↑ Walter Ulbricht: Antwort auf Fragen der Berliner Bezirksdelegiertenkonferenz der SED, In: Neues Deutschland vom 18. März 1956, S. 3
- ↑ Dokument Nr. 158 »Protokoll der Berliner Konferenz der drei Großmächte«, in: Die Potsdamer (Berliner) Konferenz der Höchsten Repräsentanten der drei alliierten Mächte UdSSR, USA und Großbritannien Dokumentensammlung, Progress Verlag Moskau/ Staatsverlag der DDR 1986, S. 285
- ↑ Protokoll der 3. Parteikonferenz der SED, 24. bis 30. März 1956, Beitrag Willi Bredel, S. 259
- ↑ Beitrag Ulbrichts: Bundesarchiv Berlin (BA) DC 20/3798 Bl. 34
- ↑ W. I. Lenin: Lieber weniger, aber besser, a. a. O., S. 1011f.
- ↑ a. a. O., S. 1013
- ↑ Veröffentlicht in: Julij A. Kwizinskij: Vor dem Sturm. Erinnerung eines Diplomaten, Berlin 1993 S. 176
- ↑ Walter Ulbricht: Programmatische Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrates vor der Volkskammer der DDR am 4. Oktober 1960, in: Schriftenreihe des Staatsrates der DDR Nr. 2/1960, S. 38
- ↑ a. a. O., S. 57
- ↑ a. a. O., S. 58
- ↑ Vgl. Hans Joachim Semler/Herbert Kern: Rechtspflege – Sache des gesamten Volkes, Berlin 1963, S. 125 und 119-148
- ↑ Walter Ulbricht, Erklärung vor dem Kreistag Forst am 25. Februar 1961, BA Berlin DA 5/7871, Bl. 8
- ↑ SAPMO-BArch NY 30/3306, Bl. 57
- ↑ Zitiert aus: Was man gestohlen hat, in: Spiegel 15/1959
- ↑ Aus: »Lotte und Walter«, herausgegeben von Frank Schumann, Berlin 2003, S. 242
- ↑ Vgl.: » Lotte und Walter« …, a. a. O., S. 239
- ↑ Siehe: Ernst Reuß: Kriegsgefangen im 2. Weltkrieg. Wie Deutsche und Russen mit ihren Gegnern umgingen, Berlin 2010.
- ↑ Hans Reichelt: Die deutschen Kriegsheimkehrer. Was hat die DDR für sie getan, Berlin 2007
- ↑ 44,0 44,1 SAPMO-BArch NY 4182/1191
- ↑ vgl. Hans Loch: Entscheidende Tage, Berlin 1953, S. 45
- ↑ Karandasch, mit bürgerlichem Namen Michail N. Rumjanzew (1901-1983), galt als einer der berühmtesten Clowns seiner Zeit; er stand über ein halbes Jahrhundert in der Manege.
- ↑ Hans Loch: Entscheidende Tage … a. a. O.
- ↑ BArch DA/4/366
- ↑ SAPMO-BArch DY 30/3503
- ↑ 50,0 50,1 SAPMO-BArch NY 4090/472
- ↑ 51,0 51,1 SAPMO-BArch NY 4090/206
- ↑ »Unser Mann, sagen die Aktivisten«, in: Erinnerungsberichte, Bd. 3, SAPMO-BArch NY 4189/97, S. 73.
- ↑ Hannelore Graff-Hennecke: Ich bin Bergmann, wer ist mehr?, Berlin 2009, S. 122f.
- ↑ SAPMO-BArch NY 4177
- ↑ 55,0 55,1 Walter Ulbricht: Rede auf der ersten Funktionärkonferenz der KPD Groß-Berlins, in: Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung II, Berlin 1953, S. 446.
- ↑ Walter Ulbricht: Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin 1958, Bd. IV, S. 127.
- ↑ Dokumente zur Geschichte der FDJ, Bd. 3, S. 413.
- ↑ 58,0 58,1 SAPMO-BArch DY 30/ IV 2/1/152
- ↑ Junge Welt vom 18. November 1955.
- ↑ SAPMO-BArch DY 30/ J IV2/ 2A/ 468
- ↑ Protokoll der 3. Parteikonferenz der SED, Berlin 1956, Bd. 1, S. 316.
- ↑ Zitiert nach Karl Schirdewan: Aufstand gegen Ulbricht, Berlin 1994, S. 181ff.
- ↑ Erich Honecker: Bericht des Politbüros an die 35. Tagung des ZK der SED, 3. bis 6. Februar 1958.
- ↑ SAPMO BA DY 30/ J IV 2/ 2 A 555.
- ↑ Dokumente zur Geschichte der FDJ, Bd. 4, S. 66ff.
- ↑ Neues Deutschland vom 13. April 1957.
- ↑ Walter Ulbricht: Grundlegende Aufgaben im Jahre 1970, Berlin 1969, S. 17
- ↑ W. I. Lenin: Der »linke Radikalismus«, die Kinderkrankheit im Kommunismus, in: Ausgewählte Werke in sechs Bänden, Bd. V, Berlin 1971, S. 533
- ↑ siehe: VI. Parlament der FDJ, Rostock 12.-15.5.1959, Verlag Junge Welt, Berlin 1959, S. 16
- ↑ a. a. O., S. 361
- ↑ Neues Deutschland vom 29. November 1963
- ↑ Dieses wie auch alle nachfolgenden Zitate, so nicht anders ausgewiesen, in: Neues Deutschland vom 16. Juni 1961, S. 1-5
- ↑ Vgl. »Schreiben von Marschall der Sowjetunion Kulikow und Armeegeneral Gribkow« in: Klaus-Dieter Baumgarten und Peter Freitag (Hrsg.), Die Grenzen der DDR. Geschichte, Fakten, Hintergründe, Berlin 2005, S. 8-12
- ↑ Konrad Adenauer: Erinnerungen 1945-1953, 1953-1955, 1955-1959, 1959-1961 Fragmente, Stuttgart 1965-1968.
- ↑ Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR im Bundesarchiv (SAPMO-BArch), NY 4617, Karton 3, Heft 25.
- ↑ Erich Honecker: Aus meinem Leben, Berlin 1981.
- ↑ SAPMO-BArch, a. a. O., Heft 30.
- ↑ Siehe Walter Ulbricht: Der Zusammenbruch Deutschlands im Ersten Weltkrieg und die Novemberrevolution. In: Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. I: 1918 1933, Berlin 1953, S. 9-40.
- ↑ Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki). Kurzer Lehrgang, Moskau 1939.
- ↑ Walter Ulbricht: Die Legende vom deutschen Sozialismus. Ein Lehrbuch für das schaffende Volk über das Wesen des deutschen Faschismus, Berlin 1946.
- ↑ SAPMO-BArch, NY 4182/888, Bl. 189-206.
- ↑ Walter Ulbricht: Des deutschen Volkes Weg und Ziel. In: ders.: Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Aus Reden und Aufsätzen, Bd. VIII: 1959-1960, Berlin 1965, S. 375.
- ↑ Die geschichtliche Aufgabe der Deutschen Demokratischen Republik und die Zukunft Deutschlands. In: Programmatische Dokumente der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, hrsg. u. eingel. v. Helmut Neef, Berlin 1967, S. 200-238.
- ↑ Grundriss der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Berlin 1963, S. 110.
- ↑ Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Chronik, Berlin 1967.
- ↑ 86,0 86,1 Einheit Jg. 1962, Sonderheft.
- ↑ Hermann Weber: Ulbricht fälscht Geschichte. Ein Kommentar zum »Grundriss der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung«, Köln 1964.
- ↑ Siegfried Lokatis: Der rote Faden. Kommunistische Parteigeschichte und Zensur unter Walter Ulbricht, Köln/Weimar/Wien 2003, S. 328.
- ↑ Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. 1, Berlin 1966, S. 10
- ↑ Siehe Walter Ulbricht: Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, Bd. X: 1961 1962, Berlin 1966, S. 558.
- ↑ SAPMO-BArch, NY 4617, Karton 6.
- ↑ Gerhard Zwerenz: Walter Ulbricht. Archiv der Zeitgeschichte. München/Bern/Wien 1966, S. 25.
- ↑ Vgl. Siegfried Prokop: Walter Ulbrichts Wirken in den 50er Jahren, in: GeschichtsKorrespondenz, Berlin 2008, Nr. 3, S. 20-25
- ↑ Zwerenz, Walter Ulbricht …, S. 25
- ↑ 95,0 95,1 Boris Chavkin: Moskau und der Volksaufstand in der DDR, in: Ders.: Verflechtungen der deutschen und russischen Zeitgeschichte. Ediert von Markus Edlinger sowie mit einem Vorwort versehen von Leonid Luks. Stuttgart 2008, S. 234
- ↑ Vgl. Wilfriede Otto: Die SED im Juni 1953. Interne Dokumente. Berlin 2003, S. 39.
- ↑ Protokoll der II. Parteikonferenz der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Berlin 1952, S. 58
- ↑ Vgl. Walter Ulbricht: Lehren des XIX. Parteitages der KPdSU für den Aufbau des Sozialismus in der DDR, Berlin 1952
- ↑ Vgl. Gustav Just: Deutsch, Jahrgang 1921. Ein Lebensbericht. Potsdam 2001, S. 92f.
- ↑ Vgl. Siegfried Prokop: Paukenschlag im Kalten Krieg. Die Churchill-Initiative vom 11. Mai 1953 zur deutschen Frage, in: junge Welt, 10./11. Mai 2003, S. 10f.
- ↑ Karl Schirdewan: Aufstand gegen Ulbricht. Berlin 1994, S. 79
- ↑ Aus dem Bericht Karl Schirdewans an die 29. Tagung des ZK. Überarbeitetes Protokoll des 29. Plenums des ZK der SED vom 12. bis14. November 1956. Als parteiinternes Material gedruckt Nr. 00843, S. 6
- ↑ Vgl. FKK in der DDR. Zusammengestellt von Thomas Kupfermann. Berlin 2008, S. 45
- ↑ Vgl. Zwerenz, a.a.O., S. 17
- ↑ Archiv der Gegenwart. Cd-Rom 1999, S. 05826
- ↑ Domenico Losurdo: Den Widerspruch des Sozialismus beherrschen. In: junge Welt, 10. April 2008, S. 11
- ↑ SAPMO-BArch, DY30 IV 2/1/123
- ↑ SAPMO-BArch, NY 4182/502, Bl. 7
- ↑ Vgl. Jochen Czerny: Die 29. ZK-Tagung, die Arbeiterkomitees und das Dilemma der Mitbestimmung und Siegfried Prokop: Die internationale Beratung über Veränderungen in der Gewerkschaftsarbeit sozialistischer Länder im Oktober 1956 in Sofia. Beide in: Gewerkschaften und Betriebsräte im Kampf um Mitbestimmung und Demokratie 1919-1994. Bonn 1994, S. 97ff. und S. 182ff.
- ↑ Wolfgang Harich: Keine Schwierigkeiten mit der Wahrheit. Zur nationalkommunistischen Opposition in der DDR. Berlin 1993, S. 45
- ↑ SAPMO-BArch, DY 30/IV 2/1.01/314, Bl. 43/44
- ↑ Vgl. Siegfried Prokop: 1956 – DDR am Scheideweg. Opposition und neue Konzepte der Intelligenz. Berlin 2006, S. 164-166
- ↑ Vgl. Siegfried Prokop: 1956 – DDR am Scheideweg. Opposition und neue Konzepte der Intelligenz. Berlin 2006, S. 200.
- ↑ Guntolf Herzberg: Anpassung und Aufbegehren. Die Intelligenz der DDR in den Krisenjahren 1956/58. Berlin 2006
- ↑ Siegfried Prokop: Immer in der Attacke. Walter Ulbricht, vor 100 Jahren geboren: Berufsrevolutionär, Apparatschik, Staatsmann, Erzdogmatiker und Reformer, in: Neues Deutschland, 30. Juni 1993, S. 9
- ↑ SAPMO-BArch, DY 30 2/1.10/308, Bl. 25
- ↑ Erläuterungen Walter Ulbrichts zur Politik der DDR zum Friedensvertrag und zur Westberlinfrage auf einer internationalen Pressekonferenz, in: Neues Deutschland, Berlin, 16. Juni 1961
- ↑ Vgl. Hans Kroll: Lebenserinnerungen eines Botschafters. Köln/Berlin 1967, S. 512
- ↑ Ausführlicher vgl. Siegfried Prokop: Der 13. August 1961 – Geschichtsmythen und historischer Prozess, in: Kurt Frotscher/Wolfgang Krug (Hrsg.): Die Grenzschließung 1961. Im Spannungsfeld des Ost-West-Konfliktes. Schkeuditz 2001, S. 55ff.
- ↑ Franz Josef Strauß: Erinnerungen, Berlin 1989, S. 390
- ↑ Siehe dazu: Kurt Gossweiler: Hintergründe des 17. Juni 1953, in: Marxistische Blätter 3/1993, S. 77-83
- ↑ Hermann Matern auf dem 33. ZK-Plenum der SED, 16. bis 19. Oktober 1957: »Wir haben auf der Parteilinie den jugoslawischen Genossen mitgeteilt, dass die diplomatische Anerkennung des militaristischen Westdeutschlands durch Jugoslawien und die Nichtanerkennung der Deutschen Demokratischen Republik unhaltbar ist.«
- ↑ Als Beilage zur Einheit Heft 1, Januar 1957, erschien ein Artikel von A. Rumjanzew: Die sozialistische Wirklichkeit und die »Theorien« des Genossen E. Kardelj. – Als Beilage zum Heft 4, April 1958, der Einheit erschien ein Artikel von Fedossejew/Pomelow/Tscheprakow: Über den Entwurf des Programms des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens, beide Übersetzungen aus der sowjetischen Zeitschrift Kommunist.
- ↑ Walter Ulbricht: Die Bedeutung des Werkes »Das Kapital« von Karl Marx für die Schaffung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR und den Kampf gegen das staatsmonopolistische Herrschaftssystem in Westdeutschland, Berlin 1967
- ↑ a. a. O., S. 38
- ↑ Siehe dazu: Sahra Wagenknecht: Marxismus und Opportunismus. Kämpfe in der sozialistischen Bewegung Gestern und Heute, in: Weißenseer Blätter 4/1992, S. 13/14. Wolfgang Berger, Zu den Hauptursachen des Unterganges der DDR, in: ebd., S. 29 bis 33
- ↑ Siehe dazu: Kurt Gossweiler: Hatte der Sozialismus nach 1945 keine Chance? in: Weißenseer Blätter 2/1991, S. 56
- ↑ Mathias Tullner in: Der Tod des Diktators. Ereignis und Erinnerung im 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Thomas Grossbölting und Rüdiger Schmidt, Göttingen 2011
- ↑ vgl. Julij Kwizinskij: Zeit und Fall. Aufzeichnungen, in: Diplomatisches Dossier, Moskau 1999, S. 210ff.
- ↑ Julij Kwizinskij: Zeit und Fall …, a. a. O., S. 213f.
- ↑ Valentin Falin: Politische Erinnerungen, München 1993
- ↑ Protokoll der Unterredung des SED Generalsekretärs Egon Krenz mit dem Beauftragten von M. S. Gorbatschow, Valentin Falin, am 24. November 1989 in der sowjetischen Botschaft in Berlin.
- ↑ 133,0 133,1 133,2 Egon Bahr: Das musst du erzählen. Erinnerungen an Willy Brandt, Berlin 2013, S. 91
- ↑ vgl. »Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung«, Berlin 1966, Bd. 6, S. 240ff.
- ↑ Lotte und Walter …, a. a. O., S. 8f.
- ↑ Manfred Gerlach: Mitverantwortlich. Als Liberaler im SED-Staat, Berlin 1991, S. 132ff.
- ↑ 137,0 137,1 137,2 137,3 »Die Frauen – der Frieden und der Sozialismus«, Kommuniqué des Politbüros des Zentralkomitees der SED, Neues Deutschland vom 23. Dezember 1961
